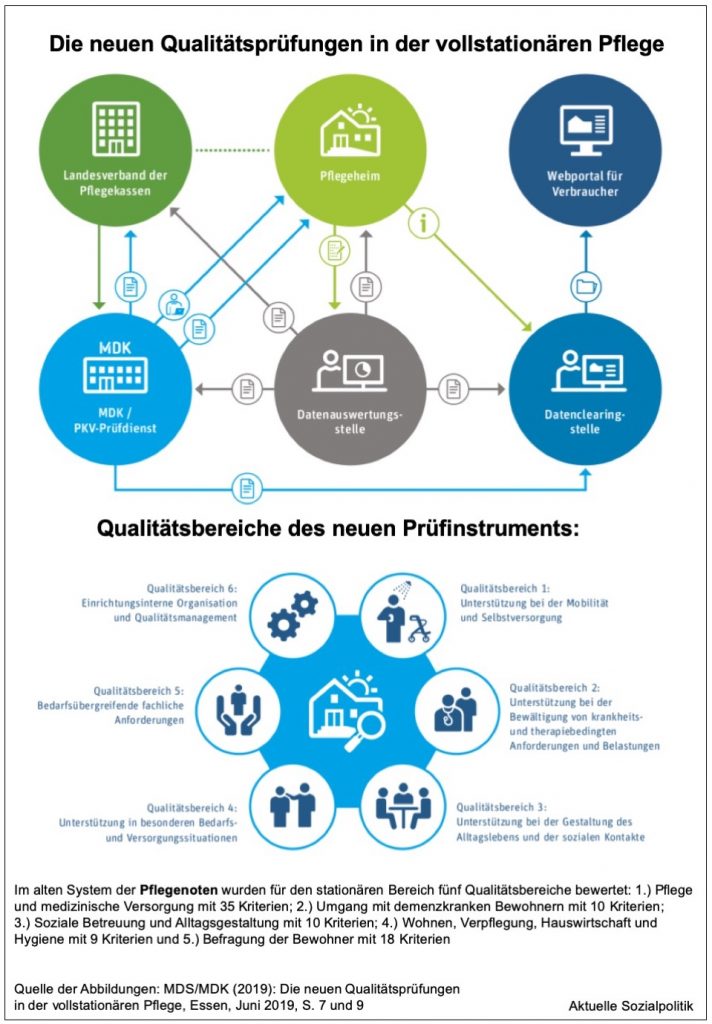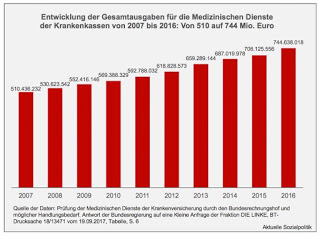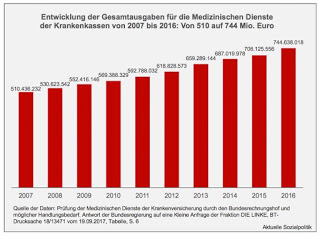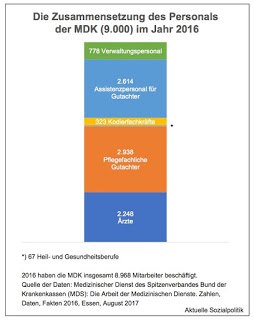„Als ich noch zur Schule ging, konnte man eine Fünf in Mathe nicht durch Singen ausgleichen. Aber in Heimen geht das.“
(Staatssekretär Karl-Josef Laumann, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, zitiert nach Pflege-TÜV ist Laumann ein Dorn im Auge).
Das mit Noten ist ja so eine Sache – wir alle haben unsere eigenen, mehr oder weniger oder gar nicht schönen Erfahrungen und Assoziationen, wenn wir an den Notenraum von 1 bis 6 (zurück)denken. Aber davon abgesehen verstehen wir alle, was es bedeutet, eine 1 oder eine 4 oder gar eine 5 – zumeist in roter Signalfarbe – testiert zu bekommen. Und genau daran wollte man anknüpfen, als man das Anliegen hatte, die Ergebnisse von Qualitätsprüfungen der Pflegeheime und Pflegedienste, die vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) durchgeführt werden, für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen verständlich, übersichtlich und vergleichbar zu machen. Eine an sich gute Sache. Und seit 2009 werden Pflegenoten (vgl. dazu www.pflegenoten.de) nach dem Muster der Schulnoten (allerdings hört das bei der 5 auf) vom MDK verteilt. Diese Pflegenoten sollen nicht nur den Verbraucher informieren, Transparenz schaffen und die Auswahl eines Pflegedienstes und Heimes erleichtern. Sie sollen auch für Qualität sorgen, denn und auf den ersten Blick durchaus plausibel: Wer kann es sich schon leisten, dass eine schlechte Note über seine Einrichtung veröffentlicht wird?
Wie passt dann aber so eine Nachricht in diese schöne kompakte Notenwelt? In dem Artikel Umstrittenes Bonner Heim geschlossen vom 06.02.2015 wurde berichtet: Es geht um das Seniorenheim Haus Dottendorf der Dortmunder Betreibergesellschaft Senator GmbH in Bonn. »Die Bonner Heimaufsicht hatte im Januar gefährliche Mängel in der Pflege festgestellt. Im Dezember waren zwei Bewohner in der Einrichtung zu Tode gekommen, die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf. Die Heimaufsicht beschloss eine Teilschließung, bei der zunächst Bewohner mit den Pflegestufen zwei und drei umquartiert wurden. Nachdem erneut Mängel in der Pflege auftauchten, entschied die Aufsicht die komplette Schließung.« Die erfolgte dann im Februar 2015.
Was das mit unserem Thema zu tun hat: »Wie fast alle Einrichtungen in Deutschland hatte das Haus Dottendorf zuletzt die Bestnote 1,0 erhalten.« Ganz offensichtlich ist es gar nicht das Problem, dass eine Einrichtung vor das Problem gestellt wird, eine schlechte Note ausweisen zu müssen. Der bundesweite Durchschnitt der meist auf der ersten Seite des MDK-Prüfberichts veröffentlichten Noten liegt derzeit bei 1,3. Die Spitzennoten kommen zustande, weil pflegerische Mängel zum Beispiel durch gute Küche und Freizeitangebote ausgeglichen werden können.
Die Vorgänge um das Bonner Heim mit der Spitzen-Benotung war dann wieder einmal Auslöser einer politischen Debatte, die Pflegenoten grundsätzlich in Frage zu stellen. Anfang Februar dieses Jahres wird beispielsweise der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jens Spahn, in dem Artikel Pflegenoten vor dem Aus? mit en folgenden Worten zitiert: „Aus heutiger Sicht muss man feststellen, dass das System der Pflegenoten gescheitert ist. Das System der Pflegenoten hat bei maximalem Aufwand und Ärger bisher nichts, aber auch gar nichts gebracht“, so Spahn.
In diesem Artikel findet man schon alle Ingredienzien der aktuellen und durchaus kontroversen Debatte über Sinn und Unsinn der Pflegenoten. Die in der großen Koalition mitregierenden Sozialdemokraten halten von einer „Fundamentalkritik“ nichts und die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Hilde Mattheis, warnt vor einer „Verteufelung“ des Instruments.
»Die Opposition übt ebenfalls heftige Kritik an den Pflegenoten: „Das System der Pflegenoten ist gescheitert. Und das war von Anfang an absehbar. Es ist schwierig, die Frage nach guter Qualität zu einer Verhandlungssache zu machen“, sagte Elisabeth Scharfenberg, pflegepolitische Sprecherin der Grünen … „Wir fordern eine sofortige Aussetzung der Veröffentlichung der Pflegenoten“, so Scharfenberg. Sie schlägt ein unabhängiges und multidisziplinär besetztes Institut für Qualität in der Pflege vor, das die künftigen Qualitätsanforderungen in der Pflegeentwickeln soll.«
Aber auch diese Position wurde vorgetragen: „Das Aussetzen der Pflegenoten ist der falsche Weg, weil damit die Transparenz für lange Zeit auf Eis gelegt würde“, so wird Peter Pick vom Medizinischen Dienst zitiert.
Ebenfalls im Februar dieses Jahres wurde erkennbar, in welche Richtung die Entwicklung geht: Pflegeorganisationen wollen mitreden, so die Überschrift eines Artikels. Sozialverbände wie der SoVD und VdK sowie der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatten sich gegenüber der Bundesregierung positioniert: „Den Pflege-TÜV abzuschaffen, wäre fahrlässig“, so wird SoVD-Präsident Adolf Bauer zitiert. Aber: „Bereits der Verzicht auf die Gesamtnote wäre ein großer Schritt nach vorn. Denn dann wird es schwieriger, schlechte Bewertungen zu verschleiern.“
Genau das hat dann der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, aufgegriffen. Notensystem ist am Ende, so kurz und bündig Anno Fricke in der Ärzte Zeitung in einem Bericht über den Vorstoß von Laumann: »Der Pflege-TÜV wird umgekrempelt: Das umstrittene Notensystem soll nächstes Jahr abgeschafft werden, ein neues Bewertungssystem kommt aber nicht vor 2018 … Das umstrittene Bewertungssystem für Pflegeheime soll zum 1. Januar ausgesetzt werden. Eine entsprechende Regelung hat der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatssekretär Karl Josef Laumann (CDU) … angekündigt.«
Diese Ankündigung kann man im Original hier nachlesen: Endlich gute Pflege erkennen – Neues Konzept für den Pflege-TÜV, so ist die Pressemitteilung von Laumann überschrieben. Zu Beginn des kommenden Jahres soll zunächst ein Pflegequalitätsausschuss errichtet werden, der bis Ende 2017 ein neues Qualitätsprüfungs- und Veröffentlichungssystem ausarbeiten soll. Laumann schlägt vor, den Ausschuss beim Pflegebevollmächtigten anzusiedeln – also bei sich selbst. Statt der wenig aussagefähigen Gesamtnoten soll spätestens ab kommendem Januar eine Kurzzusammenfassung der Prüfergebnisse auf dem Deckblatt der Prüfberichte stehen.
Wie aber stellt sich Laumann eine Neukonzeption des Pflege-TÜV vor?
Zum 1. Januar 2016 soll eine Pflegequalitätsausschuss eingerichtet werden, der ein neues Qualitätsprüfungs- und Veröffentlichungssystem für Pflegeeinrichtungen berät und als Richtlinie beschließt. In diesem Ausschuss müssen neben den Einrichtungs- und Kostenträgern künftig auch die Verbände der Pflegebedürftigen und der Pflegeberufe gleichberechtigt mit Stimmrecht vertreten sein. Der Pflegequalitätsausschuss erhält eine gesetzliche Frist bis 31. Dezember 2017, um die Richtlinie für ein neues Qualitätsprüfungs- und Veröffentlichungssystem zu erlassen, wenn er das nicht schafft, dann kann das Bundesgesundheitsministerium auf dem Wege der Ersatzvornahme eine solche in die Welt setzen. Und dann kommt in der Pressemitteilung des Pflegebevollmächtigten eine aufschlussreicher Passus:
»Der Pflegequalitätsausschuss wird bei seiner Arbeit durch ein neu zu gründendes Pflegequalitätsinstitut mit unabhängigen Wissenschaftlern unterstützt … Das Institut muss schlank sein und aus bereits vorhandenen Mitteln finanziert werden.«
Das hört sich nicht beruhigend an. Ein „schlankes“ Institut, das „aus bereits vorhandenen Mitteln finanziert werden“ muss. Was soll da angesichts der Komplexität des Thema herauskommen?
Natürlich haben sich die Bedenkenträger sogleich zu Wort gemeldet: Dem neuen, geplanten Pflegequalitätsausschuss begegnen die gesetzlichen Krankenkassen mit Skepsis, wie man dem Artikel GKV pocht auf Staatsferne entnehmen kann. »Der GKV-Spitzenverband reklamiert die Zuständigkeit für eine Reform des Bewertungssystems für Pflegeheime für sich … dem GKV-Spitzenverband sollte im Rahmen einer Richtlinienkompetenz der Auftrag erteilt werden, für die Pflegetransparenz die Kriterien der Veröffentlichung einschließlich der Bewertungssystematik zu entwickeln.«
Zur Einordnung sollte man wissen: »Für die Entwicklung des aktuell geltenden Bewertungssystems wurden der GKV-Spitzenverband, die kommunalen Spitzenverbände, Sozialhilfeträger und 14 Pflegeverbände mit unterschiedlichen Interessenslagen an den Verhandlungstisch gezwungen. Ihre Entscheidungen über ein Bewertungssystem müssen seither einstimmig gefällt werden. Das lässt wunderliche Kompromisse blühen … nach wie vor werden die Transparenzkriterien dieses Marktes in der beschriebenen Konstellation reguliert. Das musste schief gehen.«, so Anno Fricke in seinem Artikel Eine Ad hoc-Reform überfordert das System.
Wenn man sich den – wohlgemerkt – Vorschlag von Laumann anschaut, wie eine Neukonzeption des Pflege-TÜV erfolgen soll, dann wird schnell erkennbar, dass die von Fricke kritisch beschriebene Konstellation fortgeschrieben und sogar angereichert werden soll um „Verbände der Pflegebedürftigen und der Pflegeberufe“, was die Komplexität weiter erhöhen würde.
An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass eine fundamentale Infragestellung des Systems der Pflegenoten keine neue Erkenntnis ist, sondern wertvolle Zeit für einen anderen Ansatz verloren wurde. Am 31. März 2011 veröffentlichte der bekannte Pflegeexperte Thomas Klie ein Moratorium Nein zu Pflege-Noten mit 10 Argumenten. Daraus nur einige Aspekte:
»Die Qualitätsprüfungen und die Pflegenoten sollen auf wissenschaftlich fundierter Basis ermittelt werden – so der Gesetzgeber. Selbst die Pflegekassen gestehen ein, dass es derzeit keine validen Grundlagen für Qualitätsindikatoren hinsichtlich der Ergebnisqualität in der Pflege gibt … Über die Kriterien in den Transparenzberichten und die Pflegenoten sollen sich Pflegekassen und Pflegeheime und -dienste verständigen. Sie sind Pflegesatzparteien. Sie verfolgen jeweils auch ökonomische Interessen. Sie sind nicht die geeigneten Akteure, um unabhängig relevante Kriterien für die Lebens- und Versorgungsqualität zu definieren. Den state-of-the-art, den Stand der Künste, kann man nicht im Konsens zwischen Kostenträger, Leistungsträger und Leistungserbringer verhandeln … Es ist ordnungspolitisch falsch, die Leistungsträger, die Pflegekassen, mit der Aufgabe des Verbraucherschutzes zu betrauen. Notengebung außerhalb der Schule ist nicht Sache des Staates, sondern Sache eines unabhängigen Verbraucherschutzes. Den Pflegekassen ist in Fragen der Pflege eine hochproblematische Omnipotenz zugeordnet, die angesichts ihrer begrenzten Leistungen und ihrer fiskalischen Steuerungsinteressen unangemessen ist … Qualitätsprüfungen und insbesondere die Pflegenoten führen zu einer Aufmerksamkeitsverlagerung sowohl in den Diensten und Einrichtungen als auch in der Öffentlichkeit. Für relevant wird das erklärt, was geprüft wird. Pflegedienste und Heime lernen, wie man gute Noten erzielt, und dies unabhängig von den Qualitätseffekten für die Pflegebedürftigen. Der bürokratische Aufwand ist enorm, der Aussagewert der Pflegenoten in der Tendenz immer unbedeutsamer … Die Prüflogik führt zu einer gefährlichen Konzentration auf eine Pflege, die im Zentrum nicht mehr der Beantwortung der komplexen Situationen und Bedürfnisse Pflegebedürftiger gilt, sondern sich an den Erfordernissen von Prüfsituationen und –katalogen ausrichtet … Der bürokratische Aufwand, der mit den Qualitätsprüfungen verbunden ist, ist gigantisch. Nicht nur die Pflegedokumentation – unbestritten wichtig als professionelles Arbeitsmittel in der professionellen Pflege – wird mit Blick auf die Qualitätsprüfungen zum Zeitfresser, auch die Prüfungen selbst und die Auseinandersetzung mit den Prüfinstanzen binden Zeit und mindern die Zuwendung für den Menschen, um den es geht. Der Aufwand für die Qualitätsprüfungen und die Ermittlung von Pflegenoten steht in keinem Verhältnis zum Ertrag für die auf Pflege angewiesenen Menschen.«
Es gab also von Anfang an und frühzeitig eine fundierte mehrdimensionale Kritik an den Pflegenoten, aus der sich schon längst hätte ableiten lassen müssen, dieses System einzudampfen.
Und wieder zurück in die Gegenwart: Der von vielen sicher begrüßte Vorstoß des Pflegebeauftragten der Bundesregierung hinsichtlich einer Aussetzung der Pflegenoten zum 1. Januar 2016 und dem beschriebenen Verfahren einer Neukonzeption stößt nicht nur auf den Widerstand innerhalb der eigenen Regierung, also bei der SPD, sondern die Aufgabe eines „Systemwechsels“, der allerdings nur in Aussicht gestellt wird, weil noch gar kein anderes System entscheidungsreif vorliegt, muss bewältigt werden in einem sehr schwierigen Umfeld, in dem sich die Pflege befindet. Der Streit über den Pflege-TÜV versperrt die Sicht auf die eigentliche Reformbaustelle, meint Anno Fricke. Er sieht das eingebettet in diese Herausforderungen – wobei er Pflege nicht nur begrenzt auf die Altenpflege:
1. »Es gibt keine einheitliche Vorstellung von der Qualität, die Pflege leisten sollte. Die Aufteilung des Pflegekomplexes auf mehrere Sozialgesetzbücher verhindert Pflegepolitik aus einem Guss.« Beispiel: »Der Gemeinsame Bundesausschuss kann Qualitätssicherungsvorgaben zum Beispiel für die Dekubitusprophylaxe in Krankenhäusern beschließen, in die Altenpflege- oder Rehabilitationseinrichtungen hinein reicht sein Einfluss nicht.«
2. »Um Qualität herzustellen, bedarf es Personal, Arbeitszeit und Material. Die ersten beiden Güter sind äußerst knapp. In den Krankenhäusern verändern sich die Personalschlüssel kontinuierlich zuungunsten der Pflege.« Und die Perspektiven sind düster: »Spätestens 2018, so die Berechnungen, werde dem Pflegearbeitsmarkt die Luft ausgehen.«
3. »Den Pflege-TÜV zu streichen bringt nicht über Nacht ein neues Bewertungssystem hervor. Es ist richtig, die Gesamtnoten in Frage zu stellen … Im Gespräch ist nun, eine Gruppe von Pflegewissenschaftlern ein neues Notenschema ausarbeiten zu lassen. Mit dem nach dem Bielefelder Wissenschaftler Dr. Klaus Wingenfeld benannten Modell liegt allerdings schon eine im Feldversuch erprobte Alternative vor. Es stützt sich auf eine Reihe von Indikatoren zur Messung von Ergebnis- und Lebensqualität.« Zum Wingenfelder Modell vgl. beispielsweise die Studie Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe aus dem Jahr 2011.
4. »Kosten und Nutzen von Qualität in der Pflege sind höchst unterschiedlich verteilt … Von der Steigerung der Qualität hat der Anbieter jedoch nicht direkt etwas. Den Nutzen heimsen die Gepflegten und die Krankenkassen ein, die weniger Geld für Krankenhauseinweisungen und Arztbehandlungen aufwenden müssen. Hier liegt Potenzial für Wettbewerb über leistungsorientierte Vergütungen für Einrichtungen mit ausgewiesen hoher Qualität … «
Fazit: Weg mit den Pflegenoten? Experten uneins, so auch die Überschrift eines Artikels, der über eine entsprechende Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages berichtet. Während die Fraktion der Grünen die unmittelbare Aussetzung der Pflegenoten fordern, warnt der GKV-Spitzenverband vor einer Abschaffung der Noten: »Dann bestünde die Gefahr, dass Verbraucher mehrere Jahre keine Anhaltspunkte hätten, um Einrichtungen zu vergleichen. Auch der Sozialverband VdK plädierte dafür, „nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten“. Prüfungen seien wichtig zum Schutz der Menschen.«
Wie auch immer das ausgehen wird, absehbar ist eine nächste Runde der mehr als mühsamen Erarbeitung von Prüfungskriterien in einem ähnlichen, sogar noch erweiterten institutionellen Setting, das auch schon den ersten Versuch produziert hat. Und vielleicht wird es auch zu einer stärkeren „Verstaatlichung“ dergestalt kommen, dass das Bundesgesundheitsministerium mit dem Damoklesschwert der „Ersatzvornahme“ hantieren kann.
Aber das alles verbleibt gewissermaßen im bestehenden System – und das bewegt sich in den gängigen Vorstellungen von Qualität als eine Komposition aus Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Beschränkt man sich darauf, dann wird man in der Pflege (aber auch in vielen anderen Bereichen der personenbezogenen Dienstleistungen) immer wieder mit dem dilemmatischen(?) Grundproblem konfrontiert werden, wie man denn die Ergebnisqualität abbilden kann. An dieser Stelle stehen auch andere Bereiche, hier sei nur beispielhaft auf die Diskussion über „Qualität der Krankenhausbehandlung“ hingewiesen. Dazu die Gesprächssendung Auf Herz und Nieren: Lässt sich die Qualität von Krankenhäusern messen? (SWR, 21.05.2015), u.a. mit Dr. Christof Veit, dem Leiter des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG), das eine wichtige Rolle in der zukünftigen Qualitätsmessung im Gesundheitswesen einnehmen soll und wird.
Man kann sicher noch mehr optimieren, genauer werden und besser messen. Keine Fragen. Aber ein Grundzweifel bleibt. Es ist erwartbar, dass die Systeme sich in diese Richtung werden entwickeln müssen – aber ist das auch wirklich anstrebenswert? Besteht nicht die Gefahr, dass die eigentlichen Qualitätsfragen dadurch gar nicht mehr gestellt, geschweige denn beantwortet werden können, weil sie nicht zugelassen sind in dem immer enger eingezäunten Gelände dessen, was wir messen?
Dieser Grundzweifel findet Nahrung in dem folgenden der zehn Punkte, die der Pflegeexperte Thomas Klie in seinem Moratorium Nein zu Pflege-Noten aus dem Jahr 2011 so formuliert hat:
»Das Konzept der Pflegenoten basiert auf einem Verständnis von Pflege als marktgängige Dienstleistung. Ein solches Verständnis von Pflege greift sowohl fachlich als auch gesellschaftlich und kulturell zu kurz. Es reflektiert nicht das, was lebensweltlich für Menschen mit Pflegebedarf individuell bedeutsam ist, was es an unterschiedlichen kulturellen Prägungen zu respektieren gilt, was im Gesetz als zu entwickelnde Kultur des Helfens verankert ist. Es sieht nicht den auf Pflege angewiesenen Menschen als Koproduzent und vernachlässigt die Qualitätsverantwortung von Angehörigen und Bürgerschaft. Pflege ist mehr als Dienstleistung. In der Pflege zeigt sich die Solidaritätsbereitschaft und Mitverantwortung von Angehörigen und Bürgerinnen und Bürgern. Die Pflegenoten reduzieren Pflege auf eine Dienstleistung, gaukeln eine Souveränität der Kunden vor und gehen an den zentralen – infrastrukturellen – Entwicklungsaufgaben vorbei.«