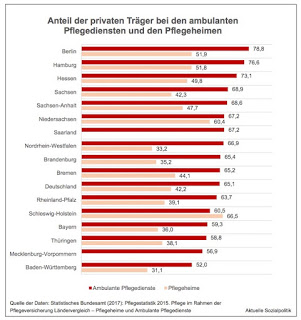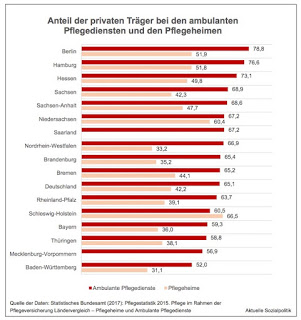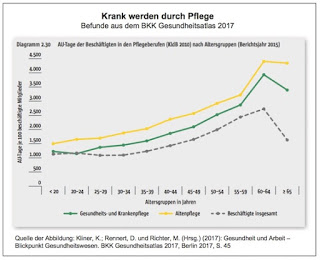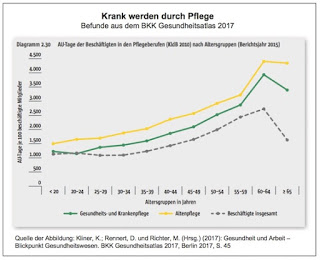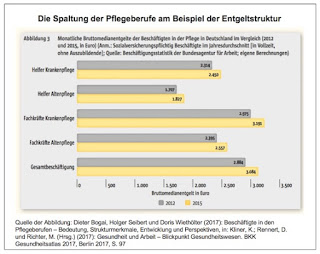Im Frühjahr 2016 rauschte das ein paar Tage durch die Medienlandschaft – „Pflegemafia“ konnte man da lesen, sogar von einer „russischen“ Pflegemafia auf deutschem Boden war die Rede. Auslöser der damaligen Beschäftigung mit einer besonderen Ausprägung des Abrechnungsbetrugs im Bereich der ambulanten Pflege war der Beitrag So funktioniert der Milliarden-Betrug der Pflege-Mafia von Dirk Banse und Anette Dowideit. Das wurde auch in diesem Blog aufgegriffen: Eine russische Pflegemafia inmitten unseres Landes? Über milliardenschwere Betrugsvorwürfe gegen Pflegedienste und politische Reflexe, so ist der Beitrag vom 18. April 2016 überschrieben. »Ambulante Pflege ist ein lukrativer Markt, auf dem sich viele dubiose Anbieter tummeln. Seit Jahren gibt es Berichte über osteuropäische Firmen, die Kranken- und Pflegekassen abzocken, indem sie Senioren als Pflegefälle ausgeben, die in Wahrheit noch rüstig sind«, so hatten das Banse und Dowideit formuliert. Ute Krogull hat das kurze Zeit später in ihrem Artikel Die schmutzigen Geschäfte der Pflegemafia aufgegriffen: »Es gibt ein System des organisierten Betrugs, in das angeblich sogar Ärzte verwickelt sind. Viele wissen davon. Doch keiner kommt dagegen an, wie das Beispiel Augsburg zeigt.«
Branchenkenner sprechen von einem „riesigen grauen Markt in einem abgeschotteten System“. Wie funktioniert das? Krugall beschreibt das in ihrem Artikel so:
»Dienste kreuzen – teilweise in Absprache mit Pflegebedürftigen bzw. deren Angehörigen – Leistungen auf den Abrechnungsbögen an, die nie erbracht wurden. Menschen werden instruiert, sich gegenüber dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen, der die Pflegestufe vergibt, hinfälliger zu stellen, als sie sind. Hilfskräfte übernehmen Aufgaben von Fachkräften. Überschüsse aus dem Betrugsgeschäft teilt man sich, macht Gegengeschäfte oder stellt Angehörige pro forma als Pfleger an – ohne dass sie einen Finger rühren.«
Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch in Augsburg gegen einen Pflegedienst. Dieser soll in über 600 Fällen betrügerische Abrechnungen erstellt und so in vier Jahren über 200.000 Euro ergaunert haben. Krugall hat natürlich die naheliegende Frage gestellt: Warum fällt das – wenn es denn so weit verbreitet sei – so selten auf?
»Eckard Rasehorn, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Augsburg-Stadt, sagt: „Kassen und Sozialhilfeträger können nichts beweisen.“ Was passiert, ist offensichtlich hochprofessionell organisiert und spielt sich hinter verschlossenen Türen ab. Und das in einer regelrechten Parallelgesellschaft, die gegen „den Staat“ zusammenhält. Klaus Kneißl, Sozialplaner beim Augsburger Sozialreferat, sagt: „Der Nachweis ist wahnsinnig schwer zu führen.“ Möglich sei es nur bei besonders dreisten Fällen. Wenn zum Beispiel das Sozialamt, das für Patienten ohne Versicherung die Kosten übernimmt, eine Rechnung aus dem Krakenhaus erhält – und parallel die Forderung eines Dienstes, der den Menschen angeblich zur selben Zeit zu Hause gepflegt hat.«
Und immer wieder wurde damals von einer „russischen“ Pflegemafia gesprochen, eine etwas ungenaue Formulierung, aber auch in Augsburg war (ist?) das relevant, was man diesen Erläuterungen entnehmen kann:
»Die russische Parallelgesellschaft ist in Augsburg immer wieder Thema. 25.000 der 284.000 Bürger haben Wurzeln in postsowjetischen Staaten. Es gibt ein ganzes System von Geschäften, Dienstleistungsunternehmen, Pflegediensten und Ärzten. Kneißl schätzt, dass mindestens zehn der 50 Augsburger Sozialstationen in russischer Hand sind. Teilweise sind sie erkennbar an typischen Namen aus dem Sprachraum, gerne Frauenvornamen oder mythologische Figuren. Großteils sind sie auf russischsprachige Klienten spezialisiert, das Personal ist oft schlecht bezahlt und spricht teilweise kaum Deutsch.«
Man muss allerdings anmerken, dass die betrügerischen Aktivitäten im vergangenen Jahr kein wirklich neues Phänomen waren, bereits 2011 gab es Diskussionen darüber anlässlich von Vorgängen in Berlin. Dort ging es um „normale“ Pflege im häuslichen Kontext, Im vergangenen Jahr hingegen wurde vor allem die Expansion des betrügerischen Pflegemodells auf „lukrative“ Beatmungspatienten beklagt.
Es ging also um einen Betrug der Sozialsysteme mit Schwerstkranken, die rund um die Uhr Betreuung brauchen und aus Sicht der Kriminellen deutlich lukrativer sind. Mit ihnen lassen sich pro Monat bis zu 15.000 Euro illegal abzweigen.
Aber auch hier wieder stoßen wir auf das gleiche Muster wie bei der „normalen“ häuslichen Pflege. So wurde im vergangenen Jahr berichtet und beklagt: „Patienten und Angehörige wirken häufig an den Betrugshandlungen mit“, so ein Ermittler aus Nordrhein-Westfalen. „Dafür erhalten sie einen Teil der Beute.“
Das stellt sich nicht nur dem einen oder anderen die Frage, was eigentlich mit diesen Beteiligten des betrügerischen Handelns passiert, wenn denn Fälle tatsächlich ans Tageslicht gezogen werden können. Dazu konnte man beispielsweise am 2. November 2016 lesen: »Kooperieren Pflegemafia und Patienten, kommt das dem Staat teuer zu stehen. Das Sozialgericht Berlin hat nun entschieden: Ein Amt darf betrügerischen Sozialhilfeempfängern die Leistung kürzen«, berichtete Matthias Wallenfels in seinem Artikel Amt darf Rentnerin Sozialhilfe kürzen: Das Sozialamt darf die Sozialhilfe einer Pflegebedürftigen rückwirkend um Geldbeträge kürzen, die diese von einem kriminellen Pflegedienst als Kick-Back für ihr Mitwirken beim Abrechnungsbetrug erhalten hat, so das Sozialgericht Berlin. Und die daraus folgenden Rückforderungen darf das Sozialamt durch Anrechnung auf die laufende Grundsicherung sofort durchsetzen.
Was genau ist passiert und auf welcher Grundlage hat das Sozialgericht seine Entscheidung (S 145 SO 1411/16 ER) getroffen? Schauen wir uns den geschilderten Sachverhalt genauer an:
»Im konkreten Fall stand ein Berliner Pflegedienst im Fokus der Staatsanwaltschaft. Sichergestellte Kassenbücher und Dienstpläne begründen laut SG den Verdacht, dass hier rund 300 Patienten in den Abrechnungsbetrug verwickelt waren.
Die 1949 geborene Klägerin beziehe vom Sozialamt Steglitz-Zehlendorf, seit Jahren Grundsicherung im Alter. Zugleich sei sie Patientin des beanstandeten Pflegedienstes.
Mit Bescheid vom 11. August 2016 habe das Sozialamt sämtliche Bescheide zurückgenommen, mit denen der Antragstellerin Sozialleistungen für den Zeitraum November 2014 bis Februar 2015 bewilligt worden waren.
Die Antragstellerin habe in diesem Zeitraum für ihre Mitwirkung am Abrechnungsbetrug des Pflegedienstes ein Einkommen aus Kick-Back-Zahlungen zwischen 245 und 336 Euro monatlich erzielt. Dadurch sei ihre Hilfebedürftigkeit entsprechend verringert worden.«
1.125 Euro zu viel gezahlte Sozialhilfe seien zurückzuzahlen. Zur Begleichung der Erstattungsforderung werde die laufende Grundsicherung ab sofort um monatlich 73 Euro gekürzt, so das zuständige Sozialamt – und dagegen hatte die Betroffene Klage beim Sozialgericht eingelegt, die von diesem zurückgewiesen wurde (vgl. dazu auch Sozialgericht Berlin: Leistungskürzungen wegen Pflegebetrugs – Sozialgericht bestätigt Linie der Sozialämter, 02.11.2016). Darin erfahren wir zu den Gründen für die Ablehnung der Klage seitens des Berliner Sozialgerichts:
»Die Anrechnung der „Kick-Back-Zahlungen“ als Einkommen und die darauf gestützte Rückforderung von Sozialleistungen seien nicht zu beanstanden. Laut den von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Kassenbüchern habe die Antragstellerin über die Jahre von dem Pflegedienst insgesamt sogar Zahlungen in Höhe von 12.064 Euro erhalten. An der Richtigkeit der Kassenbücher habe das Gericht keine Zweifel. Offensichtlich habe der Pflegedienst derartige Unterlagen führen müssen, um angesichts von rund 300 am Betrugssystem beteiligten Patienten den Überblick über seine „Wirtschaftlichkeit“ zu behalten. Die Kassenbücher würden durch die ebenfalls beschlagnahmten Dienstpläne bestätigt.
Die Einwände der Antragstellerin seien in keiner Weise nachvollziehbar. Die Antragstellerin habe nämlich Nachweise über tägliche Pflege unterschrieben, obwohl sie laut Abschlussbericht des Landeskriminalamtes überhaupt nicht gepflegt worden sei. Die Unzuverlässigkeit des Pflegedienstes sei dem Gericht im übrigen aufgrund einer Vielzahl weiterer Verfahren bereits bekannt.«
Das Sozialgericht betonte auch das Vorliegen ein überwiegendes öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung der Rückforderung, u.a. mit Hinweis darauf, angesichts »des Ausmaßes des Leistungsbetrugs mit einem Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro sei auch aus generalpräventiven Gründen eine sofortige Reaktion des Sozialhilfeträgers erforderlich.«
Das Vorgehen diene dem Schutze des Sozialversicherungssystems und der Gesamtheit der Steuerzahler.
Eigentlich nachvollziehbar. Aber dann stoßen wir bereits in der Pressemitteilung des Sozialgerichts am Ende nach dem Hinweis, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig sei, weil Beschwerdemöglichkeit beim Landessozialgericht bestehen würde, auf diesen Passus, bei dem der Nicht-Jurist zwei- oder mehrmals hinschauen muss:
»Der Beschluss gibt die überwiegende Rechtsauffassung am Sozialgericht wieder. Eine abweichende Auffassung hat die 146. Kammer vertreten (Beschluss vom 21. Oktober 2016 – S 146 SO 1487/16 ER). Die 146. Kammer hält den vom Sozialamt gewählten Weg, Einkommen aus Straftaten auf erhaltene Sozialhilfe anzurechnen, aus dogmatischen Gründen für falsch. Es sei inkonsequent, Gewinne aus kriminellen Handlungen auf die Sozialhilfe anzurechnen, denn Hilfeempfänger dürften grundsätzlich nicht auf Einnahmequellen verwiesen werden, die von der Rechtsordnung missbilligt werden.«
Offensichtlich muss diese Unstimmigkeit auf der nächst höheren Instanzenebene geklärt werden. Genau das ist mittlerweile passiert, mit diesem Ergebnis: Keine Sozialhilfekürzung wegen Pflegebetrugs: »Pflegebedürftigen, die sich am Pflegebetrug beteiligt haben, darf die Sozialhilfe dennoch nicht die Leistungen für den täglichen Lebensunterhalt kürzen. Sogenannte Kick-back-Zahlungen, die Pflegebedürftige für ihre Unterschrift unter nicht erbrachte Leistungen erhalten haben, sind kein „Einkommen“ das auf die Sozialhilfeleistungen angerechnet werden kann, entschieden zwei Senate des Landessozialgerichts (LSG) Berlin-Brandenburg in Potsdam. Sie hoben damit gegenteilige Eilentscheidungen des Sozialgerichts Berlin auf. Das Sozialamt könne nicht verlangen, Einkünfte aus strafbaren Handlungen zum Bestreiten des Lebensunterhalts einzusetzen.«
Die Pressemitteilung des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 2. Februar 2017 ist so überschrieben: Leistungskürzungen wegen Pflegebetrugs – Landessozialgericht bremst Sozialämter. Auch beim LSG haben sich gleich zwei Senate mit der Materie parallel beschäftigt, denn dort sind zwei Senate (bestehend aus jeweils drei Berufsrichtern) mit der Sparte der Sozialhilfe befasst. Beide Senate haben übereinstimmend entschieden, dass die Sozialämter die „sofortige Vollziehung“ ihrer Bescheide nicht anordnen durften. Unterschiede gab es nur in der Begründung:
- Der 15. Senat hat die Rechtsfrage, ob Kick-Back-Zahlungen Einkommen im Rechtssinne seien, ausdrücklich offen gelassen (Beschluss vom 21. Dezember 2016, L 15 SO 301/16 B ER, rechtskräftig). Allerdings sei der Erhalt von Kick-Back-Zahlungen nicht hinreichend belegt, denn hierfür spreche einzig ein Eintrag in einem Kassenbuch des Pflegedienstes. Umgekehrt sei z.B. nicht erwiesen, dass die Antragstellerin Pflegeleistungen in einem geringeren als mit der Pflegekasse abgerechneten Umfange erhalten habe.
- Der 23. Senat hat offen gelassen, ob der Erhalt von Kick-Back-Zahlungen erwiesen sei und entschieden (z.B. Beschluss vom 9. Januar 2017, L 23 SO 327/16 B ER, rechtskräftig), dass Kick-Back-Zahlungen als Gewinne aus begangenen Straftaten kein „Einkommen“ im Sinne des Sozialhilferechts darstellten. Ein solcher Zufluss an Geld stamme aus einem gemeinschaftlich begangenen Betrug und sei von vornherein mit einer Rückzahlungspflicht belastet. Eine Behörde könne nicht verlangen, Einkünfte aus strafbaren Handlungen zum Bestreiten des Lebensunterhalts einzusetzen, um so den Anspruch auf staatliche Sozialleistungen zu mindern.
Der entscheidende Punkt ist natürlich die Argumentation des 23. Senats hinsichtlich einer Nich-Anrechenbarkeit des gemeinsam erwirtschafteten Profits durch das betrügerische Handeln, da es „kein Einkommen“ sei. Sollte sich diese Linie im Hauptsacheverfahren durchsetzen, dann wird damit ein – nun ja – irritierendes Signal ausgesendet, denn dass man das Mitwirken der Betroffenen bzw. ihrer Angehörigen braucht, um richtig abzuzocken, ist wohl mehr als offensichtlich.
Zugleich lehrt uns dieser Ausflug in die Tiefen und Untiefen der Sozialrechtsprechung, dass das Aufdecken von Missbrauch das eine ist, das andere hingegen die sich über sehr lange Zeit hinziehende juristische Aufarbeitung mit teilweise mehr als bedenkenswerten Ergebnissen. In der Zwischenzeit könnte der Rubel weiter gerollt sein, was man natürlich nur vermuten kann.