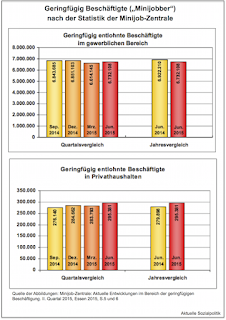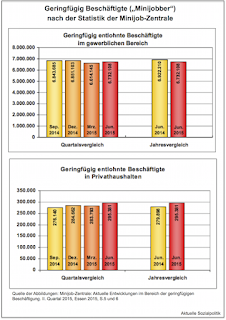Man kann sein Vollzeit-Leben derzeit verbringen nur mit dem Sammeln der Vorschläge, wie es gelingen könnte, „die“ Flüchtlinge in absehbarer Zeit in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Wobei diese Perspektive an sich schon mehr als verengt daherkommt, wenn die – zugegeben mit hoher Symbolkraft ausgestattete – Zahl von einer Million Menschen, die allein in diesem Jahr als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, als Maßstab für eine anstehende Arbeitsmarktintegration verwendet wird, beispielsweise in einem Vorstoß des Verbandes Die Familienunternehmer, die ausdrücklich auf dieser durch alle Medien verbreiteten Zahl aufsetzen und ein Diskussionspapier vorgelegt haben mit dem bezeichnenden Titel: 1 Million neue Arbeitsplätze – wie schaffen wir das? Es ist eben nicht kleinlich, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass wir eben nicht eine Million Arbeitsplätze für die eine Million Flüchtlinge brauchen (werden), denn hinter dieser Zahl verbergen sich eben nicht nur arbeitsfähige bzw. -willige Menschen, sondern auch viele Kindern und die, die sich um diese kümmern und die auf absehbare Zeit gar keine Arbeitsmarktintegration wollen oder brauchen. Das wird – vor allem, wenn sich in den vor uns liegenden Jahren der Familiennachzug ausbreiten wird – noch erhebliche Diskussionen auslösen und angesichts der Tatsache, dass diese arbeitsmarktlicht gesehen „inaktiven“ Teile über Transferleistungen finanziert werden, kann das ein zentrales Einfallstor werden für die Kräfte, denen an einer Skandalisierung und Problematisierung gelegen ist. Nur – die Finanzierung des Lebensunterhalts dieser Menschen ist unvermeidlich und sollte nicht verschwiegen werden.
Gerade vor diesem Hintergrund müssen alle Vorschläge für eine bessere oder überhaupt gelingende Arbeitsmarktintegration der anderen Flüchtlinge erst einmal ohne Vorbehalte geprüft werden.
Unter der Überschrift Familienunternehmer fordern Reformpaket für eine Million Jobs berichtet Thomas Öchsner in der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung über die Forderungen des Unternehmerverbandes an die Bundesregierung. Der selbst gesetzte Anspruch hat es in sich:
„Ein drittes deutsches Wirtschaftswunder nach dem nach 1949 und dem nach 2009 ist nötig – und möglich“, heißt es in einem Positionspapier des Verbandes, der 5.000 Familienfirmen vertritt. Nötig sei dafür ein Reformpaket, das weit über die Agenda 2010 des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) hinausgehe, berichtet Öchsner in seinem Artikel.
Die Formulierung „weit über die Agenda 2010“ hinausgehend wird nun schon reflexhaft bei den einen oder anderen Magenschmerzen auslösen. Und ein genauerer Blick verdeutlich tatsächlich, dass sich die meisten Vorschläge des Familienunternehmer-Verbandes tatsächlich einordnen lassen in die Logik, mit der auch die Agenda 2010 hausieren gegangen ist: Deregulierung und angebotsseitige Wirtschaftspolitik ist gut. Früher für „die“ Arbeitslosen, jetzt für „die“ Flüchtlinge.
Wie sehen die Vorschläge des Familienunternehmer-Verbandes aus?
»Die Familienunternehmer wollen … neben der dualen Ausbildung eine triale Ausbildung einführen, zu der neben der Praxis im Betrieb und der Berufsschule auch der Erwerb der deutschen Sprache gehört. Diese dritte Säule könne dazu führen, dass sich die Ausbildungszeit auf vier Jahre verlängert.«
Darüber kann und muss man diskutieren. Alle Möglichkeiten eines möglichst schnellen Zugangs zu einer qualifizierten Ausbildung für die Flüchtlinge, die können und wollen, macht Sinn.
Der Vorschlag wird erweitert:
»Gleichzeitig schlägt der Wirtschaftsverband vor, Unternehmen, die Auszubildende ohne ausreichende Sprachkenntnisse beschäftigen, durch staatliche Zuschüsse mit 1000 Euro pro Azubi im Monat für zwei Jahre zu unterstützen. Das Geld soll aber keine zweckungebundene Subvention sein, sondern nachweisbar in den Sprachunterricht fließen.«
Auch das ist diskussionswürdig, wenn es sich um eine zweckgebundene Subventionierung handelt, wobei sogleich zahlreiche Anschlussfragen aufgeworfen werden. Beispielsweise die nach der Infrastruktur für den Abruf der Sprachschulungen, die dann aus den Mitteln finanziert werden können. Ist die vorhanden? Also wer soll das (wo?) machen?
Aber offensichtlich verfolgen die Wirtschaftsfunktionäre das Ziel, wenn man schon mal dabei ist, dann kann man ja auch noch Dinge gleich mitfordern, die man immer schon gerne gehabt hätte. Und dann kommt so was dabei raus:
»Zugleich fordern die Familienunternehmer für alle zusätzlichen Stellen, die in Deutschland bis 2020 geschaffen werden, ob für Migranten oder für einheimische Arbeitslose, die Sozialversicherungsbeiträge zu halbieren.«
Offensichtlich berauscht von der angebotsseitigen Lehre der Kostenentlastung ist dieser Passus „reingerutscht“. Aber a) wieso soll eine derart enorme Entlastung der Unternehmen für alle zusätzlichen Jobs in Anspruch genommen werden und wesentlich bedeutsamer b) wie will man denn eine Abgrenzung der „zusätzlich“ geschaffenen Jobs zu denen hinbekommen, die ansonsten auch entstanden wären? Eine nur als putzig zu charakterisierende Vorstellung.
Aber damit nicht genug – und klar, der Mindestlohn darf nicht fehlen:
»Für die große Zahl der wenig bis unqualifizierten Flüchtlinge sei der Mindestlohn von 8,50 Euro „eine echte Barriere für den Einstieg in den Arbeitsmarkt“. Am besten wäre deshalb eine gegebenenfalls zeitlich befristete Abschaffung der Lohnuntergrenze … .«
Und wenn man schon auf Betriebstemperatur ist, dann kann man auch das ewige Thema mit dem Kündigungsschutz gleich mitnehmen:
»Um die Hemmschwelle für Einstellungen zu senken, müsse auch der strenge Kündigungsschutz schrittweise in ein Abfindungsmodell umgewandelt werden.«
Und um möglichen Kritikern gleich von Anfang an ein schlechtes Gewissen zu machen, wird dann auch noch ein Hinweis gegeben auf den Aufstieg des Front National in Frankreich, was man natürlich bei uns vermeiden wolle.
Wirklich interessant und relevant für die aktuelle Debatte ist der Vorschlag zur „trialen“ Ausbildung und der zweckgebundenen Subventionierung, wenn denn diese tatsächlich der Sprachschulung zugute kommen würde.
Damit sind wir angekommen bei denen, die für die Sprachkurse verantwortlich sind, also nicht nur die Volkshochschulen und andere Träger, die das machen (müssen). sondern auch bei den so genannten Kostenträgern, wie das in Deutschland immer sich heißt. Also denjenigen, die das finanzieren. Und angesichts des nun mittlerweile für jeden unübersehbaren Bedarfs an Sprach- und Integrationskursen lässt eine solche Meldung aufhorchen:
GEW: „Kein großer Wurf!“ Bildungsgewerkschaft zur Erhöhung der Trägerpauschale für Integrationskurse, eine Pressemitteilung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vom 10.12.2015.
Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wird die Trägerpauschale für Integrationskurse zum 1. Januar 2016 von 2,94 Euro auf 3,10 Euro erhöht. Das Mindesthonorar für eine mehrjährige Trägerzulassung steigt von 20 auf 23 Euro. „Nach Abzug der Sozialabgaben bleibt vielen der akademisch qualifizierten Lehrkräfte von den Honoraren ein Einkommen, das knapp über dem Hartz-IV-Niveau liegt“, wird Ansgar Klinger, für berufliche Bildung und Weiterbildung verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied, zitiert. Er forderte, die Trägerpauschale auf 4,40 Euro zu erhöhen. Nur so könnten die Träger der Kurse Lehrkräfte anstellen und ihrer Qualifikation entsprechend bezahlen.
Über die miserable Situation der Fachkräfte, die sich im Bereich der Sprach- und Integrationskurse bewegen, ist hier schon berichtet worden, vgl. dazu beispielsweise nur den Beitrag 1.200 Euro im Monat = „Top-Verdienerin“? Lehrkräfte in Integrationskursen verständlicherweise auf der Flucht oder im resignativen Überlebenskampf vom 02.09.2015.
Aber selbst die Pressemeldung der GEW ist angesichts der realen Verhältnisse in diesem Teilbereich des Bildungssystems, die man nur als Wilder Westen bezeichnen kann, noch zahm und „liebevoll“. Angesichts der gerade bei uns manifesten Herausforderungen durch die Zuwanderung von mehr als einer Million Menschen in diesem Jahr müssten erhebliche Ressourcen für den „Flaschenhals“ der Sprachschulung und der Integrationsarbeit mobilisiert werden. Ein Anstieg der Trägerpauschale von 2,94 Euro auf 3,10 Euro ist sicher keine auch nur annähernd angemessene Antwort.
Wie ein solche aussehen müsste? Dazu nur einige wenige Zahlen:
Wenn man die Lehrkräfte in den Kursen halbwegs angemessen vergüten wollte angesichts ihrer überaus schwierigen und zugleich gesellschaftlich so substanziell wichtigen Arbeit, dann müsste man mit einem Stundensatz in Höhe von 5,50 Euro kalkulieren, denn erst damit würden die Träger in die Lage versetzt, den Fachkräften eine Vergütung zu ermöglichen, die sich auf dem TVöD 12-Niveau bewegt.
Zwischen der in Aussicht gestellten Anhebung der Trägerpauschale auf 3,10 Euro und den 5,50 Euro besteht schon ein Welten-Unterschied. Erschwerend kommt hinzu, was sich ergibt, wenn man in andere Länder schaut: So beträgt der Stundensatz für Integrationskursteilnehmer in Spanien 8 Euro, damit eine tarifliche Vergütung rebfinanzierbar ist.
Fazit: Wieder einmal erweist sich Deutschland als der Billigheimer, der anspruchsvollste Ziele mit möglichst wenig Geld und vor allem mit möglichst wenig Personal zu realisieren versucht. Aber das wird in diesem Bereich nicht funktionieren.