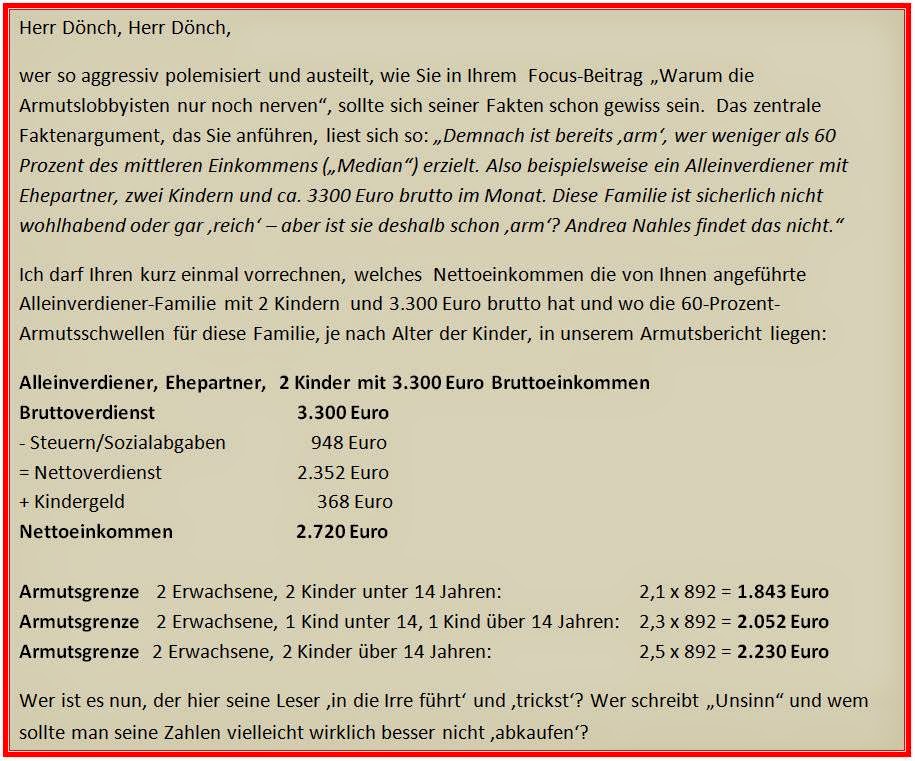Da muss man schon ein wenig um die Ecke denken: „Wer die Verhärtung von Armut bekämpfen will, muss möglichst früh ansetzen – also bei den Kindern“. Und um das zu schaffen will man bei den Eltern ansetzen, die als Voraussetzung mitbringen müssen, dass beide Elternteile im Hartz IV-Bezug (also im Regelfall seit längerem in dieser prekären Situation) sind und von denen keiner irgendeine ergänzende Beschäftigung, nicht einmal einen Minijob, ausübt und auch keiner an irgendeiner arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahme teilnimmt und deren Kind bzw. Kinder nicht jünger sein dürfen als sechs Jahre. Wir können begründet annehmen, dass man mit dieser Definition der – da kommt er, der deutsche Folterbegriff – „Zielgruppe“ wirklich auch die „harten Fälle“ erreichen wird, also Menschen, von denen wahrscheinlich sehr viele seit Jahren im Leistungsbezug sind.
Aber beginnen wir lieber mit der guten Absicht: Sozialpartner verbünden sich gegen Hartz-IV-Karrieren, meldet beispielsweise die FAZ unter der Rubrik „Kinderarmut“.
Dietrich Creutzburg beschreibt den Ausgangspunkt für den gemeinsamen Vorstoß von DGB und BDA: »Von den gut 6 Millionen Menschen im Hartz-IV-System leben allein 2,8 Millionen schon seit mindestens vier Jahren von der staatlichen Grundsicherung. Unter ihnen sind 640.000 Kinder. Vor allem eine Gruppe fällt dabei nach gemeinsamer Überzeugung von Arbeitgebern und Gewerkschaften bisher zu oft durch das Raster der Aufmerksamkeit und auch der Förderpolitik: Es gibt darunter 112.000 Familien, deren Kinder das schulpflichtige Alter erreicht haben und bei denen dennoch keiner der beiden Elternteile arbeiten geht. Die Kinder wachsen dann mit der Erfahrung auf, dass Hartz-IV-Bezug und Arbeitslosigkeit normal sind (…).« Die beiden Spitzenverbände der Gewerkschaften und Arbeitgeber haben vor diesem Hintergrund einen „Aktionsplan gegen Kinderarmut“ ausgearbeitet, der es den Jobcentern ermöglichen soll, solche Familien gezielter auf dem Weg in Arbeit voranzubringen und damit Kinder vor sogenannten Hartz-IV-Karrieren zu bewahren. Dieser Vorschlag für einen Aktionsplan trägt den Titel „Zukunft für Kinder – Perspektiven für Eltern im SGB II“. Die dazu gehörende Pressemitteilung ist überschrieben mit DGB und BDA stellen Aktionsplan gegen Kinderarmut vor. Das verdeutlicht sowohl den Handlungsauftrag wie auch das Problem des Ansatzes, denn „Kinderarmut“ als Singularität gibt es nun mal nicht, es handelt sich immer um eine abgeleitete Armut der Kinder von der ihrer Eltern. An denen kommt man partout nicht vorbei, wenn man die Situation der Kinder verbessern möchte, zugleich aber verdeutlicht das Herausstellen der Bekämpfung der Kinderarmut, dass sich dieses Anliegen irgendwie besser „verkaufen“ lässt als wenn man gleich offen diejenigen adressieren würde, um die es auch bei diesem Vorschlag wieder geht: eben die Eltern.
Den Erläuterungen von DGB und BDA kann man den folgenden Ansatz entnehmen:
»Qualifizierte Fallmanager würden gemeinsam mit den Hilfesuchenden eine individuelle Eingliederungsstrategie entwickeln und vereinbaren. Ergänzende Leistungen, wie Kinderbetreuung und psychosoziale Beratung, würden von den Kommunen bereitgestellt.
Sollte es nach etwa einem Jahr nicht gelungen sein, zumindest ein Elternteil in den Arbeitsmarkt zu integrieren – und das hat stets Vorrang -, schlagen BDA und DGB eine zeitlich befristete, öffentlich geförderte und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor. Als gezielte finanzielle Anreize für Jobcenter, die sich engagieren wollen, schlagen die Sozialpartner 280 Mio. Euro vor. Das Programm soll zunächst auf drei Jahre angelegt sein und wissenschaftlich begleitet werden.«
An dieser Stelle werden nicht wenige Insider der Arbeitsmarktpolitik unter Schmerzen aufstöhnen. Nicht schon wieder ein Sonderprogramm. Denn Programmitis und Modellprojektionitis sind bekanntlich zumindest aus Sicht der meisten Praktiker zwei der Grundübel (nicht nur) in der Arbeitsmarktpolitik, die oftmals, von einzelnen sinnvollen Ergebnissen abgesehen, enorme Ressourcen verschlingen, zu einer Anpassung der real existierenden Menschen an die Zielgruppenvorgaben der Programme zwingen und letztendlich – aufgrund der zeitlichen Befristung – kaum bis gar nicht „nachhaltig“ wirken (können). Außerdem sind wir hier konfrontiert mit einer systemischen Eigendynamik dergestalt, dass je genauer und abgrenzender die Zielgruppen der einzelnen Programme und Maßnahmen gestrickt werden, um so größer wird der Expansionsbedarf zur Abdeckung der anderen, davon nicht erfassten, aber weiter existenten Fälle, die man nun auch irgendwie bedienen müsste und sollte. Ein Teufelskreis.
Schauen wir einmal genauer in den „Aktionsplan“ hinein – und man muss konzedieren, dass man die angesprochene Problematik zwar nicht wirklich aufzulösen, sie aber zumindest etwas abzumildern versucht. Neben dem im Rechtskreis SGB II mit seinen vielen Sanktionstatbeständen wichtigen Hinweis, dass die Teilnahme seitens der Betroffenen freiwillig sein sollte, kommt mit Blick auf diejenigen, die das hauptsächlich und federführend machen müssen, also die Jobcenter, der folgende Passus:
»Jobcenter, die sich an dem vorgeschlagenen Aktionsplan beteiligen, sollen dies ebenfalls freiwillig tun. Es ist nicht unsere Absicht, deren Arbeit durch ein aufgezwungenes Sonderprogramm zu verkomplizieren.« (DGB/BDA 2015: 3)
Stattdessen soll es es Anreize geben, sich daran zu beteiligen – eben der Zugang zu zusätzlichen Mitteln: »Für zusätzliche Aktivitäten der Jobcenter im Rahmen des hier vorgeschlagenen Aktionsplans „Zukunft für Kinder – Perspektiven für Eltern im SGB II“ sollte der Bund mittels eines Sonderprogramms zusätzlich zum regulären Eingliederungsbudget (EGT) ein Finanzvolumen von ca. 280 Mio. Euro zur Verfügung stellen … Zusätzliche finanzielle Mittel aus dem Sonderprogramm erhalten nur jene Jobcenter, die zusätzliche Anstrengungen gegen Kinderarmut unternehmen.« (DGB/BDA 2015: 4). Was natürlich dazu führen muss, dass in den Jobcentern, die sich beteiligen, entsprechende Anstrengungen notwendig werden, den Vorgaben des zusätzlichen Programms zu folgen und diese in der täglichen Arbeit auch abzubilden. Dazu der „Aktionsplan“: »Das Jobcenter sollte in eigener Verantwortung überlegen, ob gesonderte Strukturen, z.B. spezielle Teams, sinnvoll sind. Eine gesonderte Organisationseinheit würde den Charakter des vorgeschlagenen Aktionsplans auch mit Blick auf das Zielsystem betonen. Es kann aber auch örtlich sinnvoll sein, vorhandene Strukturen und Aktivitäten „nur“ gezielt zu verstärken.«
Die Durchsicht der weiteren Elemente der inhaltlichen Ausgestaltung verdeutlicht, dass hier die als erfolgreich oder wenigstens als irgendwie wirksam erkannten Bausteine aus anderen Modellversuchen und praktischen Erfahrungen vor Ort zusammengestückelt werden:
»Die zuständigen Fallmanager/innen oder Vermittler/innen brauchen flexible Handlungsmöglichkeiten im Rahmen eines Budgets, um den Elternteilen sinnvolle Angebote machen zu können. Wir schlagen eine Ausweitung der Möglichkeiten vor, die § 44 f. SGB III (Vermittlungsbudget, Aktivierungs- und Eingliederungsmaßnahmen) den Vermittler/innen einräumt. So könnte Langzeitarbeitslosen ein Coach an die Seite gestellt werden, der die Jobsuche und den Beginn einer neuen Erwerbstätigkeit begleitend unterstützt. Die in einzelnen Arbeitsagenturen und Jobcentern durchgeführten Modellprojekte („INA“) zum Coaching waren erfolgreich. Dieser Ansatz sollte im vorgeschlagenen Aktionsprogramm genutzt werden können. Die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen könnte dort, wo dies sinnvoll und nötig erscheint, durch einen finanziellen Anreiz im Sinne einer Erfolgs- oder Durchhalteprämie stimuliert werden. Diese Hilfen und Anreize sollen gezielt mit Blick auf den Einzelfall eingesetzt werden, als Teil des zwischen Vermittler/in und Elternteil vereinbarten Vorgehens.« (DGB/BDA 2015: 5)
Im weiteren Gang der Beschreibung werden dann alle irgendwie relevanten Partner der Jobcenter bei der Integrationsarbeit aufgezählt und mitverhaftet – von den Kommunen mit ihren Angeboten natürlich bis hin zu den Krankenkassen, örtliche „Paten“ aus der „Zivilgesellschaft“ und in besonderen Fällen auch »eine familienbegleitende Betreuung durch eine/n Familiencoach/in«.
Nun sind Gewerkschaften und Arbeitgeber keine Traumtänzer und sie formulieren in ihrem Papier (S. 5) selbst das zentrale Problem: »Die Integration von arbeitslosen Eltern kann nur gelingen, wenn entsprechende geeignete Arbeitsplätze gefunden werden.«
Und was, wenn das trotz aller Netzwerke und Anstrengungen nicht gelingt? Dann taucht sie auf, die „öffentlich geförderte Beschäftigung“ – oder sagen wir an dieser Stelle schon: das, was von ihr überhaupt noch übrig geblieben ist, nach Jahren nicht nur der budgetären, sondern vor allem der förderrechtlichen Verstümmelung:
»Gelingt es innerhalb eines bestimmten Zeitraums (z.B. ein Jahr) nicht, zumindest ein Elternteil zu integrieren, wird – ultima ratio – eine zeitlich befristete öffentlich geförderte Beschäftigung in sozialversicherungspflichtiger Form im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Fördermöglichkeiten angestrebt … Den Sozialpartnern in den Beiräten der Jobcenter sollte die Aufgabe zukommen, die Einsatzfelder öffentlich geförderter Beschäftigung vorab zu prüfen, ob eine Verdrängung regulärer Beschäftigung zu erwarten ist.«
Kein Wort dazu, dass man nun wirklich neue Wege der öffentlich geförderten Beschäftigung gehen müsste, um halbwegs vernünftig arbeiten zu können. Wenigstens ein Hinweis auf den desaströsen rechtlichen Zustand hätte man sich gewünscht. Alles wird irgendwie passungsfähig gemacht zu dem, was da ist. Egal, ob das, was da ist, von vielen Praktikern und Experten als untauglich und sogar in vielerlei Hinsicht als kontraproduktiv bewertet wird.
Damit das nicht missverstanden wird – den neuen Vorstoß der Gewerkschaften und der Arbeitgeber sollte man als eine wirklich gute Absicht bewerten, einer der vielen Teilgruppen im Hartz IV-System zu helfen, die bislang entweder durch den Rost gefallen oder die aus ganz unterschiedlichen Gründen mit den vorhandenen Instrumenten nicht zu erreichen sind.
Aber irgendwie erinnert das Vorgehen an den höchst problematischen „Windows-Effekt“. Damit ist gemeint, dass man das bestehende Betriebssystem mit immer neuen zusätzlichen und anderen Funktionen angereichert hat, in dem man diese „add-on“ gepackt hat, bis irgendwann zahlreiche Schnittstellen-Fehler auftreten mussten, weil sich unten immer mehr Müll angesammelt hat, der nicht beseitigt worden ist. Bildlich gesprochen stehen wir in der Arbeitsmarktpolitik vor einem ähnlichen Problem. Man packt oben immer mehr drauf und weigert sich aber, zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach mal einen Schnitt zu machen und eine Generalrevision vorzunehmen.
Für die Arbeitsmarktpolitik würde das bedeuten – was übrigens seit Jahren gefordert wird -, dass man das Förderrecht radikal entschlackt und den Profis vor Ort ein Instrumentarium an die Hand gibt, das sie flexibel einsetzen können. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass gerade eine sich verhärtende Langzeitarbeitslosigkeit auch bei einem wesentlich flexibleren Förderrecht nicht bekämpft werden kann, wenn man gleichzeitig die Fördermittel bei – wie gesagt – zunehmender Problemschwere zusammenstreicht, dann hätte man die beiden zentralen Ansatzpunkte für eine echte Reform, die ihren Namen verdienen würde.