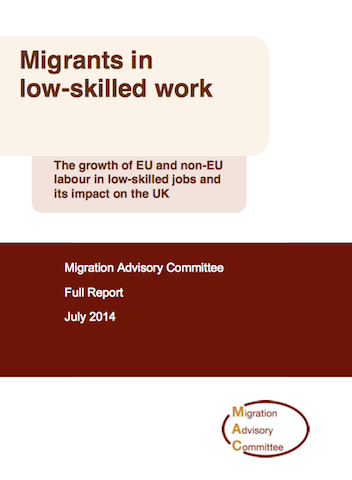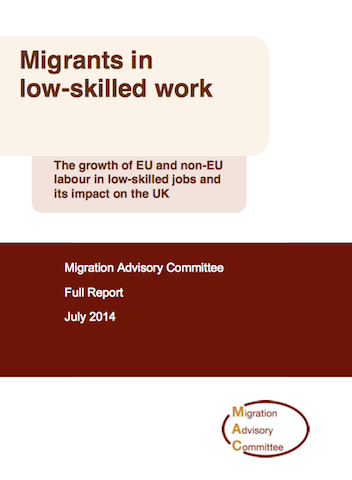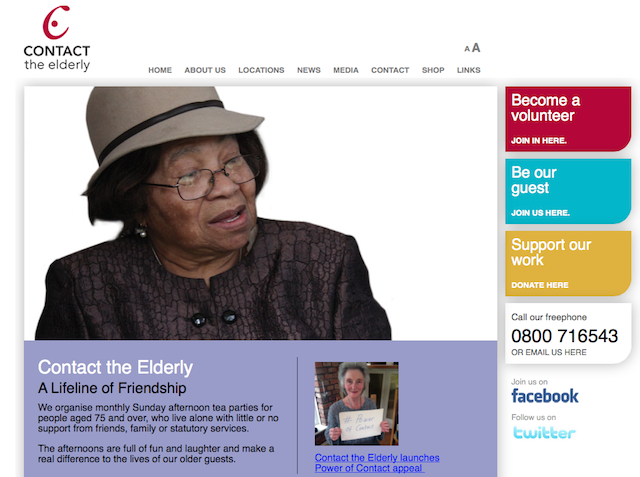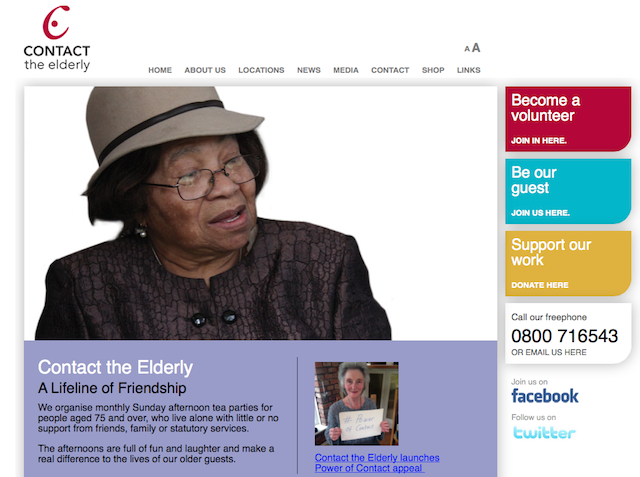In Großbritannien gibt es in weiten Teilen der Bevölkerung erhebliche Bedenken und Vorurteile, was die Zuwanderung von Migranten und deren Auswirkungen beispielsweise auf den Arbeitsmarkt angeht. Auf der anderen Seite wurde hier nicht die Abschottungspolitik betrieben, wie wir sie aus Deutschland und Österreich kennen, als im Zuge der EU-Osterweiterung die Arbeitnehmerfreizügigkeit mehrere Jahre lang aufgehalten werden konnte. Insofern bietet sich Großbritannien für eine Analyse der Auswirkungen langjähriger Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt im allgemeinen und die Beschäftigungschancen der einheimischen Bevölkerung im Bereich der niedrig qualifizierten Arbeit an. Genau das leistet eine neue Studie des Migration Advisory Commitee (MAC), die mit dem Titel „Migrants in low-skilled work. The growth of EU and non-EU labour in low-skilled jobs and its impact on the UK“ veröffentlicht worden ist. diese Studie liefert nicht nur eine interessante Bestandsaufnahme der Auswirkungen bzw. der Nicht-Auswirkungen der Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt, sondern man kann ihr zugleich wertvolle Hinweise für die deutsche Mindestlohndiskussion entnehmen.
Sustained immigration has not harmed Britons‘ employment, say government advisers – so ist ein Artikel von Nigel Morris über die neue Studie überschrieben, der eine gute Zusammenfassung der zentralen Aussagen enthält.
Insgesamt kommt die Studie zu dem Befund, dass die nachhaltige Einwanderung über die letzten zwanzig Jahre hinweg die Beschäftigungschancen der britischen Arbeitnehmer nicht negativ beeinflusst und nur einen minimalen Einfluss auf das Lohnniveau hatte.
Allerdings weist das Migration Advisory Committee darauf hin, dass die starke Zuwanderung von Arbeitnehmern aus Mittel- und Osteuropa in den vergangenen zehn Jahren in einigen Kommunen zu erheblichen Problemen mit der Bewältigung der massiven Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung geführt hat. Das erinnert an die vergleichbaren Probleme, die eine Handvoll Großstädte in Deutschland derzeit mit der Zuwanderung aus den Armenhäusern der EU hat, man denke hier beispielsweise nur an Duisburg oder bestimmte Stadtteile in Berlin.
Immer wieder gibt es das Vorurteil, dass die Zuwanderer die Sozialkassen in dem aufnehmenden Land belasten. An dieser Stelle ist der Befund der vorliegenden Studie aus Großbritannien interessant, denn dort wurde kalkuliert, dass jeder Migräne pro Jahr einen Netto-Beitrag zu den öffentlichen Finanzen in Höhe von 162 £ leistet, wenn man nur die Migration aus den EU-Ländern betrachtet, dann beläuft sich der Betrag sogar auf 2.732 £ pro Person.
Nicht wirklich überraschend, aber immer wieder erwähnenswert ist die Beschreibung der Beschäftigungsfelder, in denen die Migranten vor allem tätig werden: In der Ernährungsindustrie, der Landwirtschaft und im Bereich der Hotel- und Gaststätten. Alles Bereiche, in denen die Arbeitgeber erhebliche Schwierigkeiten haben, einheimische Arbeitskräfte für eine Tätigkeit zu gewinnen.
Trotz der insgesamt positiven Bestandsaufnahme für die zurückliegenden Jahre warnt der MAC vor den möglichen Auswirkungen einer weiteren Vergrößerung der Europäischen Union hinsichtlich des Arbeitsmarktes in Großbritannien. Es wird darauf hingewiesen, dass in den acht Kandidaten-Ländern, die Mitglied der EU werden wollen, 90 Millionen Menschen leben, die zwischen einem Drittel und der Hälfte der durchschnittlichen EU-Einkommen haben, was natürlich einen starken Wanderungsanreiz darstellen würde.
In dem Report wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass die zwei Millionen Jobs im Bereich niedrig qualifizierter Tätigkeiten, die mit ausländischen Arbeitnehmern besetzt sind, mit erheblichen Ausbeutungsrisiken verbunden sind. Beklagt wird vor allem eine schwache Durchsetzung des nationalen Mindestlohnes in diesem Bereich und Arbeitgeber, die sich nicht an die Gesetze halten, weil sie sich sicher fühlen, dass sie nicht von den Kontrollbehörden verfolgt werden. In der Studie wird darauf hingewiesen, dass ein typischer Arbeitgeber einen Kontrollbesuch einmal in 250 Jahren und eine Strafverfolgung einmal in einer Million Jahre zu erwarten hat. Diese statistische Relationen kennen natürlich viele Arbeitgeber auch.
Diese Hinweise aus einem Land, was schon seit mehreren Jahren einen nationalen Mindestlohn kennt, sollte man vor dem Hintergrund der anstehenden Einführung eines gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohns bei uns in Deutschland ernst nehmen. Dies vor allem, weil es auf eine Schwachstelle verweist, die auch während des Gesetzgebungsverfahrens im Rahmen des „Tarifautonomiestärkungsgesetzes“, in denen der Mindestlohn enthalten ist, von Kritikern vorgetragen wurde: Gemeint ist die ausreichende personelle Ausstattung der Kontrollbehörde für die Durchsetzung des Mindestlohns, das ist in Deutschland die Zollverwaltung mit der „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“. Schätzungen im Vorfeld des nunmehr verabschiedeten Gesetzes haben einen zusätzlichen Personalbedarf von 2.000 bis 5.000 Mitarbeitern postuliert. Herausgekommen sind 1.600 neue Stellen, die besetzt werden können – die Betonung liegt hier auf besetzt werden können, denn man muss geeignete Leute auch finden. Hinzu kommt, dass nicht nur eine ausreichende Quantität bei den Kontrollbehörden notwendig ist, sondern überhaupt ausreichend Möglichkeiten bestehen, Verstöße gegen die Mindestlohnregelung entdecken und dementsprechend verfolgen zu können. Dies verweist auf die zahlreichen Umgehungsstrategien, beispielsweise im Bereich der unbezahlten Mehrarbeit, mit denen wir in Zukunft noch stärker als bislang konfrontiert sein werden. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in Großbritannien, von denen in der vorliegenden Studie ausreichend berichtete wird, sollten sich die Kontrollbehörden unbedingt fokussieren auf ganz bestimmte Branchen und Unternehmen, in denen wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von Umgehungsstrategien konfrontiert sein werden.
Das alles muss auch gesehen werden vor dem Hintergrund, dass es in Großbritannien mit der Low Pay Commission eine mit nur neun Mitgliedern sehr schlanke, allerdings überaus effektive Institution gibt, die als Blaupause für die geplante Mindestlohnkommission in Deutschland fungiert – jedenfalls eigentlich. Schaut man sich allerdings die Konstruktionsvorgaben an, die man im Gesetz hinsichtlich der Mindestlohnkommission findet, dann wird klar, dass es sich um eine wesentlich schwächere Variante handelt als das, was es in Großbritannien seit mehreren Jahren gibt: »Die Mindestlohnkommission wird alle fünf Jahre neu berufen. Sie besteht aus einer oder einem Vorsitzenden, sechs weiteren stimmberechtigten ständigen Mitgliedern und zwei Mitgliedern aus Kreisen der Wissenschaft ohne Stimmrecht (beratende Mitglieder)«, so steht es nunmehr im Gesetz. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn der Arbeitsauftrag an die Kommission vor allem zwei Punkte klar und das bedeutet eben auch im Gesetz ausformuliert worden wäre:
- Zum einen die Ausarbeitung eines Vorschlags zur Anpassung des Mindestlohnsatzes auf der Basis genauer und differenzierter Arbeitsmarktanalysen, wie man sie auch in den Berichten der Mindestlohnkommission in Großbritannien findet, die sich sehr genau anschaut, wie sich der Mindestlohn auf bestimmte Branchen und Regionen auswirkt.
- Zum anderen sollte es eine wichtige Aufgabe der Kommission sein, der Frage nachzugehen und die Wirklichkeit dahingehend zu beobachten, wo und in welchem Umfang und wie Umgehungsstrategien realisiert werden und welche auch rechtlichen Voraussetzungen möglicherweise verhindert werden müssen, um eine effektive Durchsetzung des gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn sicherstellen zu können.