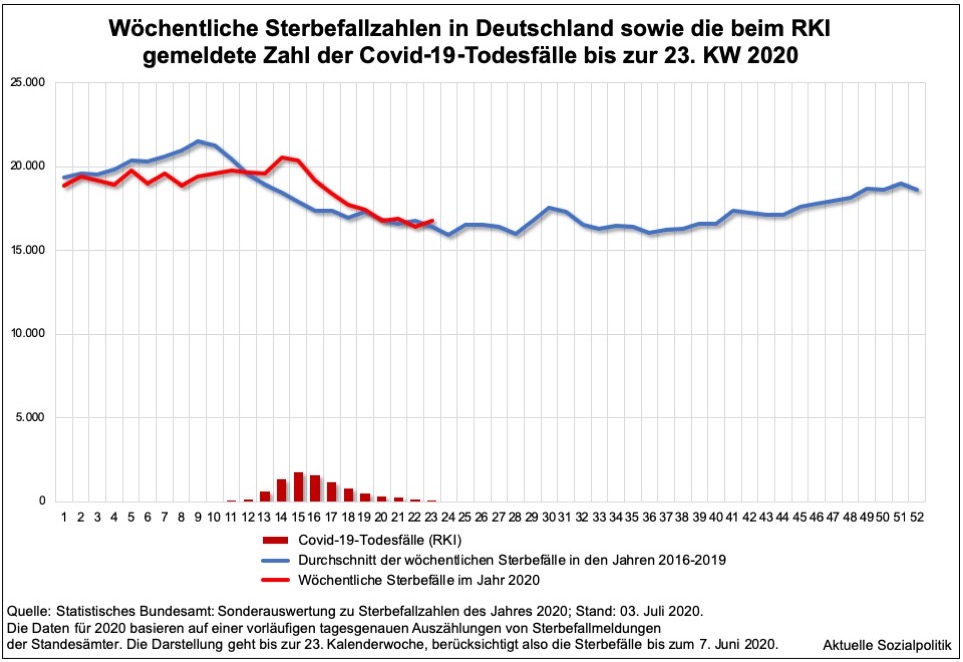Man möge einen Moment mal wieder an den März dieses Jahres denken: Die Bilder aus Bergamo, aber auch die viele sicher sehr überraschenden Katastrophenmeldungen aus den völlig überlasteten Krankenhäusern im benachbarten Elsass haben rückblickend sicher einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, dass die Menschen in Deutschland das gesellschaftliche Herunterfahren akzeptiert und mitgemacht haben. Frankreich ist hart getroffen worden von der Corona-Pandemie und wie in anderen Ländern auch wurden die vor Corona produzierten Mängel des Gesundheitssystems schmerzhaft erfahrbar. Gerade in Frankreich gab es lange vor der aktuellen Corona-Krise eine intensive Debatte und auch zahlreiche Proteste gegen die Sparmaßnahmen und den Abbau von Kapazitäten beispielsweise in den Krankenhäusern.
»Nach acht Monaten Protest in öffentlichen Krankenhäusern in Frankreich reagiert die Regierung in Paris mit einem Notfallplan.« So beginnt der Artikel Notfallplan für die Notaufnahmen, der am 21. November 2019 veröffentlicht wurde, um nur ein Beispiel von vielen zu zitieren. »Das Pflegepersonal wehrt sich mit seinem Protest gegen zusehends verschlechterte Arbeitsbedingungen vor allem in Notaufnahmen.« Und zu Vergütung kann man dem Beitrag entnehmen: »Den Pflegefachleuten und HilfspflegerInnen in Paris und Umgebung versprach Philippe eine Prämie von jährlich 800 Euro zum Ausgleich ihrer relativ hohen Lebenskosten. Alle anderen sollen sich mit einem individuellen und ihrer Leistung angepassten Bonus von maximal 300 Euro begnügen. Dieser erfüllt aber nur sehr bedingt die Forderungen der Personals, das echte Lohnerhöhungen verlangt.« Schon damals ging es um Prämien, was wiederum den einen oder anderen hier an die mittlerweile zum Trauerspiel mutierte Diskussion über eine einmalige Prämie für bestimmte, nicht alle Pflegekräfte in Deutschland erinnern könnte. Zumindest da ist Frankreich schon weiter.