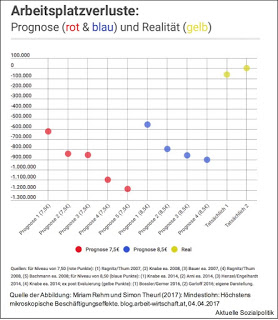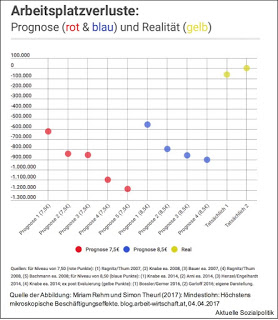Das Arbeitsrecht ist eine komplizierte Angelegenheit. Dies auch deshalb, weil weite Teile des Arbeitsrechts Richterrecht sind, also durch die Rechtsprechung konstituiert werden. Ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch gibt es in Deutschland nicht – immer wieder hatte es dazu Aufforderungen und Absichtserklärungen gegeben. Nach der Wiedervereinigung hat man beispielsweise im Einigungsvertrag im Art. 30 EinigVtr ein solches Vorhaben als Auftrag an den Gesetzgeber formuliert: Dort heißt es im Absatz 1 unter der Nummer 1:
1) Es ist Aufgabe des gesamtdeutschen Gesetzgebers,
1. das Arbeitsvertragsrecht sowie das öffentlich-rechtliche Arbeitszeitrecht einschließlich der Zulässigkeit von Sonn- und Feiertagsarbeit und den besonderen Frauenarbeitsschutz möglichst bald einheitlich neu zu kodifizieren.
Das ist bis heute nicht erfolgt und es sieht auch nicht so aus, als ob das demnächst in Angriff genommen wird. Also muss man neben dem Rückgriff auf zahlreiche Einzelgesetze weiter vor allem die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung verfolgen.
Hinzu kommt, dass sich das Arbeitsrecht nicht in einem gleichsam aseptischen Raum gleichwertiger Interaktionen bewegt, sondern Fragen und vor allem Konflikte betrifft, die stattfinden in asymmetrischen Machtverhältnissen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Aus dieser Konfiguration entspringt dann auch die – wie manche von der anderen Seite meinen: überspannte – Funktion eines Schutzrechtes für Arbeitnehmer.
Hierzu ein konkretes und aktuelles Beispiel, das zugleich von grundsätzlicher Bedeutung ist. Es geht um einen Grundtatbestand des Arbeitsverhältnisses – die Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers. Der hat Weisungen des Arbeitgebers Folge zu leisten, hat dieser ihn doch ökonomisch gesprochen „eingekauft“ und vergütet ihn dafür.
Wir ahnen schon, was jetzt kommt. Denn es gibt solche und andere Weisungen und ein nicht seltener Streitfall in der Lebenswirklichkeit bezieht sich darauf, dass der Arbeitnehmer der Ansicht ist, eine konkrete Weisung des Arbeitgebers sei unangemessen, überzogen – oder dient nicht wirklich der Erfüllung des Arbeitsverhältnisses, sondern man versuche, über eine solche überzogene Weisung den Arbeitnehmer unter Druck zu setzen, ihn möglicherweise aus dem Arbeitsverhältnis heraus zu drängen. Das kann man sich durchaus vorstellen, man denke hier an die Fälle, in denen unliebsame Mitarbeiter, die beispielsweise einen Betriebsrat ins Leben rufen wollen, „bearbeitet“ werden.
Auf der anderen Seite steht das für sich genommen durchaus nachvollziehbare Interesse des Arbeitgebers, dass die Beschäftigten sich an seine Vorgaben halten, auch wenn die denen nicht schmecken. Und dass sie Weisungen, auch wenn sie unangenehm sein sollten, nicht über eine längere Zeit blockiert werden können.
Wir haben es hier mit fließenden und nicht immer klar abgrenzbaren Übergängen zwischen „noch in Ordnung“ und „nicht mehr in Ordnung“ zu tun. Die Juristen haben für den letzten Fall einen eigenen Terminus zur Hand: „unbillige Weisungen“. Die muss ein Arbeitnehmer nicht befolgen, aber das muss erst einmal arbeitsgerichtlich festgestellt werden. Und bis das passiert ist, gilt bzw. galt bislang die höchstrichterliche Rechtsprechung, dass der Arbeitnehmer auch (später als solche festgestellte) „unbillige Weisungen“ erst einmal befolgen muss, ansonsten riskiert er Folgen wie eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses.
Aber wie weit geht das Weisungsrecht des Arbeitgebers? Hierzu der Beitrag Unbillige Weisungen im Arbeitsrecht – Umschwung der Rechtsprechung? von Sebastian Schröder aus dem vergangenen Jahr, der zugleich schon im Titel noch mit Fragezeichen andeutet, was aktuell passiert ist:
Auf die Frage nach der Reichweite des Weisungsrechts des Arbeitgebers gibt das Gesetz »eine – zunächst – simple Antwort: Nach § 106 Gewerbeordnung (GewO) kann er Inhalt, Ort und Zeit (gemeint ist die Lage der Arbeitszeit) der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind.« Dazu ein Beispiel:
»Legt ein Arbeitsvertrag ohne Versetzungsvorbehalt abschließend fest, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung ausschließlich in einer bestimmten Filiale in einer bestimmten Stadt zu erbringen hat, ist das Versetzungsrecht beschränkt. Versetzungen in andere Filialen des Unternehmens sind ausgeschlossen. Eine entsprechende Weisung verstieße gegen den Arbeitsvertrag. Sie ist schlicht nichtig und muss nicht befolgt werden.«
Aber es gilt eben auch: »Wurde die Festlegung des Arbeitsortes jedoch mit einem üblichen Versetzungsvorbehalt kombiniert und verfügt das Unternehmen über weitere Filialen im gesamten Bundesgebiet, ist eine Versetzung auch in andere Städte zulässig. Das örtliche Versetzungsrecht gilt grundsätzlich bundesweit!« Und Schröder weist auf eine nicht selten zu beobachtende Quelle für Konflikte hin: »Arbeitnehmer, die bereits seit vielen Jahren am selben Standort eines bundesweit tätigen Unternehmens eingesetzt werden, wähnen sich oft in vermeintlicher Sicherheit, was eine Versetzungsmöglichkeit angeht.« Die Enttäuschung folgt dann für die Arbeitnehmer oft auf dem Fuße: »Hier ist die Rechtsprechung zugunsten der Arbeitgeber jedoch sehr großzügig. Auch wenn der Arbeitgeber von seinem Versetzungsrecht über Jahre hinweg keinen Gebrauch gemacht hat, bedeutet das nicht unbedingt, dass er diesbezüglich eingeschränkt ist.«
Auch bei der Lage der Arbeitszeit gelten vergleichbare flexible Spielräume für den Arbeitgeber, wenn nichts anderes im Arbeitsvertrag fixiert wurde.
Und jetzt kommt das arbeitsrechtliche „aber“: Die schier grenzenlose Reichweite des Weisungsrechts wird durch die „Billigkeitskontrolle“ kompensiert, ein ganz praktischer Ausdruck der eingangs hervorgehobenen Schutzfunktion des Arbeitsrechts:
»Die Arbeitsgerichte prüfen hierbei, ob die Interessen des Arbeitgebers an der Befolgung der Weisung und die Interessen des Arbeitnehmers miteinander abgewogen wurden. Hierbei spielen in der Praxis unter anderem die Vermögens- und Einkommensverhältnisse oder familiäre Pflichten und Unterhaltsverpflichtungen des Arbeitnehmers eine Rolle. Im Kern gilt freilich, dass nur eklatant willkürliche oder rechtsmissbräuchliche Weisungen unbillig sein werden.«
Das hört sich erst einmal sehr abstrakt an, aber der Verfasser des Beitrags liefert uns ein konkretes Beispiel, was das bedeuten kann:
»Ein Arbeitnehmer – ledig, kinderlos – ist in einer Kölner Filiale eines bundesweit tätigen Einzelhandelsunternehmens als Metzger beschäftigt. Sein Arbeitsvertrag enthält eine zulässige Versetzungsmöglichkeit. Er wird (mit einer angemessenen Ankündigungsfrist) angewiesen, seine Tätigkeit künftig in einer Hamburger Filiale zu erbringen. Die Weisung ist im Ergebnis wirksam und billig. Der Mitarbeiter wird seinen Wohnort verlegen und der Weisung nachkommen müssen.
Anders sieht es aus, wenn er verheiratet und seiner schwangeren Frau sowie den drei schulpflichtigen Kindern zum Unterhalt verpflichtet ist. Dann dürfte die Weisung in einem ersten Schritt von der arbeitsvertraglichen Regelung zwar gedeckt sein. Jedoch wird die Versetzung nicht mehr billigem Ermessen entsprechen.«
Die Ähnlichkeiten zu dem aktuell für einige Diskussionen sorgenden Fall sind offensichtlich. Dazu Christoph Bergwitz in seinem Artikel Divergenz am BAG vom 16.06.2017:
»Der Arbeitnehmer des zugrunde liegenden Falls war als Immobilienkaufmann am Standort Dortmund des beklagten Unternehmens beschäftigt. Mehrere Mitarbeiter seines Teams lehnten im März 2014 gegenüber dem Betriebsratsvorsitzenden eine weitere Zusammenarbeit mit dem als unkollegial und unkooperativ bezeichneten Arbeitskollegen ab. Daraufhin versetzte der Arbeitgeber ihn für die Zeit vom 16. März bis 30. September 2015 an den Standort Berlin. Der Arbeitnehmer leistete dieser Versetzungsanordnung trotz zweimaliger Abmahnung nicht Folge und wurde deshalb fristlos gekündigt. Der entsprechende Kündigungsrechtsstreit ist noch beim 2. Senat des BAG anhängig (Az. 2 AZR 329/16).
Mit seiner vor dem 10. Senat anhängigen Klage wandte sich der Kläger gegen seine Versetzung sowie die Abmahnungen und machte die Fortzahlung seiner Vergütung geltend. Die Vorinstanzen haben festgestellt, dass der Arbeitnehmer nicht verpflichtet war, seine Arbeitsleistung am Standort Berlin zu erbringen. Sie haben das Unternehmen verurteilt, die Abmahnungen aus der Personalakte zu entfernen und dem Kläger die vorenthaltene Vergütung nachzuzahlen. Ausdrücklich hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm dem 5. Senat des BAG die Gefolgschaft verweigert und eine vorläufige Bindungswirkung der als unbillig erachteten Versetzungsanordnung verneint.«
Das Kernargument des LAG Hamm gegen die (bisherige) Rechtsprechung geht so: »Die Rechtsprechung des 5. Senats führe zu einer für den Arbeitnehmer untragbaren Risikoverlagerung. Er müsse auch einer unbilligen Leistungsanordnung zunächst Folge leisten, wenn er nicht Gefahr laufen will, seine Vergütungsansprüche zu verlieren oder wegen Arbeitsverweigerung gekündigt zu werden (Urt. v. 17.03.2016, Az. 17 Sa 1660/15).«
Man muss dazu anmerken, dass die (bisherige) Rechtsprechung des 5. Senats zur vorläufigen Verbindlichkeit einer unbilligen Arbeitgeberweisung auch bei anderen auf Kritik gestoßen ist: »Sie belaste den Arbeitnehmer als „Gestaltungsopfer“ einseitig, weil er zunächst eine gerichtliche Klärung über die Rechtmäßigkeit der Weisung herbeiführen müsse, wenn er keine arbeitsrechtlichen Sanktionen riskieren will.«
Offensichtlich gibt es nun innerhalb des Bundesarbeitsgerichts Differenzen, denn der 10. Senat hat sich der skizzierten Kritik angeschlossen. Bergwitz berichtete dazu, dass der 10. Senat die Auffassung vertreten möchte, dass der Arbeitnehmer einer unbilligen Weisung des Arbeitgebers nicht – auch nicht vorläufig – folgen muss. Er hat daher nach § 45 Abs. 3 Satz 1 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) beim 5. Senat angefragt, ob dieser an seiner gegenteiligen Rechtsauffassung festhält.
Und der hat nun geantwortet: Unter der Überschrift Versetzung – Verbindlichkeit einer unbilligen Weisung – Antwort des 5. Senats hat das Bundesarbeitsgericht eine Pressemitteilung veröffentlicht, die eine offensichtliche Änderung der bisherigen Rechtsprechung in Aussicht stellt – und das mit einem einzigen Satz:
»Der Fünfte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat auf die Anfrage mitgeteilt, dass er an dieser Rechtsauffassung nicht mehr festhält.«
Der DGB Rechtsschutz hat seine Berichterstattung dazu unter diese Überschrift gestellt: Unbillige Weisungen: 5. Senat gibt bisherige Rechtsprechung auf. Mit der Antwort des 5. Senats steht einer Entscheidung des 10. Senats in der Sache nichts mehr entgegen. Die vielkritisierte Rechtsprechung zu unbilligen Weisungen findet also in naher Zukunft ein Ende, was hier offensichtlich begrüßt wird.
Es gibt aber auch kritische Stimmen, so die von Günther Heckelmann in seinem Beitrag Senat gibt Rechtsprechung auf. Seine Argumentation geht so:
»Nach der bevorstehenden Rechtsprechungsänderung des Zehnten Senats trägt der Arbeitnehmer das Abschätzungsrisiko, will er der angeblich unbilligen Weisung nicht unter Vorbehalt bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung nachkommen. Stellt sich nach einer häufig mehrere Monate dauernde arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung heraus, dass die Weisung doch wirksam war, muss er auch die arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zu einer Kündigung tragen.
Aber selbst wenn sich am Ende die Unbilligkeit der Weisung herausstellt, wird das Arbeitsverhältnis in aller Regel irreparabel beschädigt sein. Der Arbeitnehmer wird nach einem langen Rechtsstreit bei ausgesprochener außerordentlicher Kündigung über einen längeren Zeitraum freigestellt gewesen und damit nicht mehr in den Arbeitsablauf integriert sein. In der Praxis werden die Arbeitsvertragsparteien danach nicht mehr erfolgreich zusammenarbeiten können und am Ende wird häufig die (einvernehmliche) Beendigung des Arbeitsverhältnisses stehen. Gewonnen hat damit keine Seite etwas.«
Aber was ist mit dem Argument der Kritiker der bisherigen Rechtsauffassung, dass angesichts der unsachgemäßen, weil langen Verfahrensdauer vor den Arbeitsgerichten und des damit fehlenden Rechtsschutzes gegen unbillige Weisungen der Arbeitnehmer durch die Verweigerungsmöglichkeit geschützt werden müsse? Hierzu Heckelmann:
»Genau für diese Fälle sieht das Gesetz das einstweilige Verfügungsverfahren vor, in dem eine schnelle Klärung der Verbindlichkeit der Weisung erfolgen kann. Da jede Partei im ersten Rechtszug nur ihre eigenen Kosten trägt und viele Arbeitnehmer rechtschutzversichert sind, bleiben die Kosten überschaubar. Für den betroffenen Arbeitnehmer ist es regelmäßig zumutbar für die Dauer des einstweiligen Verfügungsverfahrens der Weisung in jedem Fall nachzukommen. Berücksichtigt man die Möglichkeit, durch einstweiligen Rechtsschutz schnell eine Entscheidung zu erhalten, sind durch dieses Instrument die Interessen beider Parteien des Arbeitsvertrages ausgewogen berücksichtigt.«
Wie immer – ein kompliziertes Ding, das Arbeitsrecht.