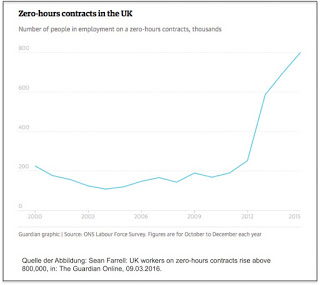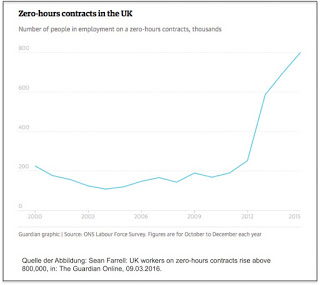Es gibt diese Tage, an denen der Beobachter der sozialpolitischen Landschaft konfrontiert wird mit Zahlen, vielen Zahlen, die versuchen, ein wenig Licht auf die überaus komplexen gesellschaftlichen Verhältnisse zu werfen.
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hat den WSI-Verteilungsbericht 2016 veröffentlicht und den unter die Überschrift gestellt: „Soziale Mobilität nimmt weiter ab“. Nun muss man gleich an den Anfang einer näheren Befassung mit diesem Report den Hinweis stellen, dass die Zahlen, die darin präsentiert werden, nur bis in das Jahr 2013 reichen, neuere Daten seien nicht verfügbar. Insofern könnte der Titel Verteilungsbericht 2016 den einen oder anderen etwa irre führen, aber man kann das ja einfach auf das Jahr der Veröffentlichung beziehen. Aber interessant sind die Daten in der sich weiter aufheizenden Verteilungsdebatte schon, die man dem Bericht entnehmen kann – und sie wurden bereits zügig von den Online-Medien aufgegriffen: „Die Reichen bleiben reich, die Armen arm“, so Spiegel Online oder Schwache Aufstiegschancen, so der Artikel von Stefan Sauer in der Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau.
Stefan Sauer fasst einen wichtigen Befund aus dem WSI-Bericht so zusammen:
»Für die einen scheint die Sonne. Sie zählen zu den Spitzenverdienern mit Nettoeinkommen von mehr als 58.791 Euro pro Jahr. Für diese Gruppe ist das Risiko, eine Einkommenseinbuße zu erleiden, in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten deutlich gesunken. Für die anderen mit Jahreseinkommen von weniger als 11.758 Euro haben sich die Aussichten eingetrübt. Die Chancen auf mehr Wohlstand stehen für die Einkommensschwächsten schlechter als vor 25 Jahren. Arm bleibt arm und reich bleibt reich.«
Das ist die einfache Formel, die man ableiten kann.
Die Einkommensverteilung hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verfestigt. Vor allem in Ostdeutschland ist die Durchlässigkeit zwischen Einkommensklassen seit der Wiedervereinigung stark rückläufig. Die Einkommensreichen können sich ihrer gehobenen sozialen Lage immer sicherer sein. Wer hingegen einmal arm ist, für den wird es immer schwieriger, diese defizitäre Situation zu überwinden. Immer mehr Menschen werden so dauerhaft an den Rand der Gesellschaft gedrängt. So die Worte des WSI selbst.
Um herauszufinden, wie sich Aufstiegschancen und Abstiegsrisiken in den Einkommensgruppen entwickelt haben, wurden zwei Fünfjahresperioden, 1991 bis 1995 sowie 2009 bis 2013, untersucht.
Die Daten zeigen folgende Entwicklung:
»Die Ungleichheit der Einkommensverteilung hat demnach ein neues Höchstmaß angenommen. Innerhalb von fünf Jahren schafften es deutlich weniger Menschen aufzusteigen, als noch in den Neunzigerjahren.
Zwischen 1991 und 1995 schafften es demnach noch rund 58 Prozent der Armen, in eine höhere Einkommensgruppe aufzusteigen. Zwischen 2009 und 2013, gelang das innerhalb von fünf Jahren nur noch 50 Prozent.
Zugleich bleiben die Reichen immer häufiger reich. Zwischen 1991 und 1995 konnten sich rund 50 Prozent der sehr Reichen in der obersten Einkommensklasse halten. Von 2009 bis 2013 waren es fast 60 Prozent.«
Da ist es wieder, das an vielen Stellen beschriebene Muster der Polarisierung zwischen unten und oben. Und die vielbeschworene, zugleich immer auch irgendwie ominöse „Mitte“?
»Besonders in der unteren Mittelschicht gebe es wachsende Abstiegsrisiken.«
In kaum einem anderen OECD-Land seien die Chancen, aus den niedrigeren Einkommensgruppen aufzusteigen so schlecht wie in Deutschland, heißt es in der Studie. „Die Verfestigung der Armut ist besonders problematisch, denn aus der Forschung wissen wir: Je länger eine Armutssituation andauert, desto stärker schlägt sie sich auf den Alltag durch“, so wird die Studienautorin Dorothee Spannagel zitiert.
Parallel haben uns weitere Daten erreicht, deren Rezeption in den Medien auch nicht gerade vielversprechend daherkommen: Überstunden, Schmerzen, Schlafstörungen oder Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer leidet unter Termin- und Leistungsdruck lauten die Überschriften.
Es geht um den von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin herausgegebenen Arbeitszeitreport 2016:
A. M. Wöhrmann, S. Gerstenberg, L. Hünefeld, F. Pundt, A. Reeske-Behrens, F. Brenscheidt, B. Beermann: Arbeitszeitreport Deutschland 2016, Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2016
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) selbst hat ihre Pressemitteilung zu dem neuen Report so überschrieben: Flexibilisierung durchdringt Arbeitszeitrealität in Deutschland. Der Arbeitszeitreport 2016 ist eine repräsentative Befragung von rund 20.000 Beschäftigten in Deutschland, die zwischen Mai und Oktober des vergangenen Jahres stattgefunden hat. Die Daten geben differenziert Aufschluss über die Arbeitszeitrealität der Beschäftigten.
Einige Eindrücke aus der Zahlenwelt, die von der BAuA zusammengestellt wurden:
Zwar geben immerhin 80 Prozent der Beschäftigten an, in der Regel Wochentags zwischen 7 und 19 Uhr zu arbeiten. Allerdings berichten 43 Prozent der Beschäftigten, mindestens einmal monatlich auch am Wochenende zu arbeiten. Über regelmäßige Rufbereitschaft sind 8 Prozent auch außerhalb ihrer Arbeitszeit an ihre Arbeit gebunden. 22 Prozent geben zudem an, dass ihr Arbeitsumfeld erwartet, dass sie im Privatleben für dienstliche Belange erreichbar sind.
Tatsächlich werden 12 Prozent der Beschäftigten häufig außerhalb der Arbeitszeit wegen dienstlicher Angelegenheiten kontaktiert; immerhin 23 Prozent geben an, dass sie manchmal kontaktiert werden. Führungskräfte sind häufiger betroffen als Beschäftigte ohne Führungsverantwortung. Aber auch viele Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten sind betroffen. Die ständige Erreichbarkeit ist zudem kein primäres Phänomen in Großbetrieben. Hier liegt der Anteil Betroffener unter dem Durchschnitt.
Etwa vier von zehn Beschäftigten haben selber großen Einfluss darauf, wann sie mit ihrer Arbeit beginnen und sie beenden (38 Prozent) oder wann sie ein paar Stunden frei nehmen (44 Prozent). Gleichzeitig erlebt mehr als jeder siebte Beschäftigte häufig und jeder vierte Beschäftigte manchmal kurzfristige Änderungen der Arbeitszeit aufgrund betrieblicher Belange. Zudem arbeiten etwa 7 Prozent der Beschäftigten auf Abruf.
Die Studie zeigt zudem, dass überlange Arbeitszeiten weiterhin für viele Beschäftigte relevant sind. So arbeiten 17 Prozent der Beschäftigten durchschnittlich 48 Stunden und mehr in der Woche. Ein Fünftel der Beschäftigten arbeiten im Rahmen versetzter Arbeitszeiten oder in verschiedenen Schichtsystemen.
Nicht wirklich überraschend sind die großen Unterschiede in der Arbeitszeitrealität von Männern und Frauen, über die auch in dem Report berichtet wird. Arbeiten immerhin 42 Prozent der Frauen in Teilzeit, so sind es bei den Männern lediglich 7 Prozent. Der größte Teil der Frauen nennt als Grund persönliche oder familiäre Verpflichtungen.
In dem Arbeitszeitreport der BAuA wurde auch die „Arbeit auf Abruf“ untersucht – zu dieser besonderen Arbeitszeitform vgl. auch den Beitrag Kapo – was? Der DGB nimmt mit der Arbeit auf Abruf das Schmuddelkind der Arbeitszeitflexibilisierung ins Visier vom 26. September 2016.
Auf den Seiten 66 ff. des Arbeitszeitreports wird ein Blick geworfen auf „Betriebsbedingte Änderungen der Arbeitszeit und Arbeit auf Abruf“. 14 Prozent der Erwerbstätigen geben an, dass sich ihre Arbeitszeiten häufig aufgrund betrieblicher Anforderungen ändern.
Nur 5 Prozent der hoch qualifizierten, aber 13 Prozent der niedrig qualifizierten Beschäftigten arbeiten auf Abruf.
Interessant ist der Blick auf die Branchen bzw. Tätigkeitsfelder: Unter den Beschäftigten sind häufig vertreten Krankenpflegekräfte, Verkaufspersonal und Servicepersonal in der Gastronomie.
Nun gibt es ja – eigentlich – die gesetzliche Verpflichtung (bzw. den Anspruch), dass die Beschäftigte mindestens 4 Tage im Voraus über die Lage ihrer Arbeitszeit informiert werden müssen (§ 12 TzBfG – Teilzeit- und Befristungsgesetz).
Von den 14 Prozent der Beschäftigten, die von Arbeit auf Abruf betroffen sind, wird jeder Zweite entweder am selben Tag (26 Prozent) oder am Vortag (23 Prozent) über die geänderten Arbeitszeiten informiert. Am schwierigsten vorherzusehen ist die Arbeitszeit für die Beschäftigten im Handwerk, denn mehr als jeder dritte Beschäftigte dort wird erst am selben Tag über die Änderung der Arbeitszeit informiert.