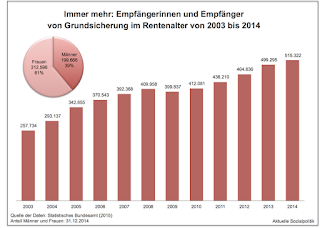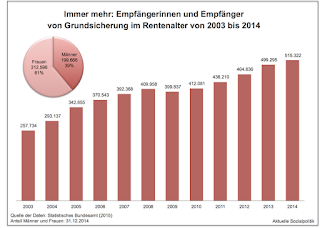Bekanntlich fällt es oftmals leichter, eine passgenaue und
ernüchternde Analyse sozialpolitischer Zusammenhänge vorzulegen, als
Lösungsvorschläge zu präsentieren oder wenigstens zur Diskussion zu stellen.
Dieser Aspekt wird manchem durch den Kopf gegangen sein bei der
Auseinandersetzung mit einer neuen Studie, die aufzeigen kann, dass das
„Drei-Säulen-System“ der Alterssicherung in Deutschland erhebliche Baumängel
aufweist: Ingo Schäfer zeigt in seiner Veröffentlichung Die
Illusion von der Lebensstandardsicherung. Eine Analyse der Leistungsfähigkeit
des „Drei-Säulen-Modells“: „Auch wer heute über alle drei Wege spart, wird
nicht an das einstige Leistungsniveau der gesetzlichen Rente herankommen.“
Das Hauptproblem: Die Renten aus allen drei Säulen steigen nicht so stark wie
die Löhne und verlieren dadurch während des Bezugs massiv an Wert. Höchstens
zum Zeitpunkt des Renteneintritts kann eine idealtypische Umsetzung des
„Drei-Säulen-Modells“ wie von der Bundesregierung behauptet die
„Lebensstandardsicherung“, also das Verhältnis zwischen der Rente und
dem versicherten Einkommen (auch „Versorgungsniveau“ genannt),
zusagen – aber dann hört ja die Geschichte nicht auf und das Problem breitet sich
aus: Über die Jahre wird die Rente gemessen an den Löhnen erheblich an Wert
verlieren und das Verhältnis ständig schlechter, so Ingo Schäfer (vgl. hierzu
den Beitrag Die
Rente ist sicher. Immer weniger wert. Auch wenn man sich idealtypisch verhält
und alle drei Säulen bedient vom 22.08.2015).
Aber was sollte und könnte
man tun, wenn man denn wollte? Dazu hat nun der Rentenexperte Johannes Steffen
eine interessante Veröffentlichung vorgelegt: Für
eine Rente mit Niveau. Zum Diskurs um das Niveau der Renten und das
Rentenniveau, so hat er seine Ausarbeitung überschrieben. Darin findet man
nicht nur eine prägnante Zusammenfassung der rentenpolitischen Entwicklung vor
allem seit den „Rentenreformen“ der damaligen rot-grünen Bundesregierung Anfang
des Jahrtausends, sondern er zeigt Wege auf, die man gehen könnte, um das
Kardinalproblem des gesetzlichen Rentenversicherungssystems, also das sinkende
Rentenniveau, in den Griff zu bekommen. Seine besonders hervorzuhebende
Leistung besteht darin, dass die damals politisch beschlossene Absenkung des
allgemeinen Rentenniveaus, die seitdem gleichsam einen unantastbaren Charakter
zugeschrieben bekommen hat, nicht nur infrage gestellt, sondern auch eine
Umkehrung dieses rentenpolitischen Entwicklungspfades gefordert und mit
konkreten Schritten versehen wird.
»Zu Beginn des Jahrhunderts beschloss die rot-grüne
Bundesregierung eine drastische Absenkung des Rentenniveaus. Bis Anfang der
2030er Jahre wird der allgemeine Leistungsstandard der gesetzlichen Rente
demnach um rund 20 Prozent sinken. Staatlich geförderte betriebliche
Altersversorgung sowie private Altersvorsorge sollen die im Solidarsystem politisch
aufgerissene Sicherungslücke schließen.« Genau das ist nicht erreicht worden,
wie auch die Studie von Ingo Schäfer hat aufzeigen können.
allgemeinen Renten-Diskussion allerdings grob vernachlässigten Zusammenhang
hin:
– dies gilt für große Teile des
„Rentenpakets“ aus dem Jahr 2014 – und Placebo-Projekte die Oberhand, so
die in der vergangenen Wahlperiode gescheiterte und nun im Koalitionsvertrag
wieder aufgewärmte und mit dem Adjektiv „solidarisch“ drapierte „Lebensleistungsrente“. Dazu Steffen: »Maßnahmen,
die immer auch als Ablenkungsmanöver vom derweil ungebremst weiter sinkenden
Rentenniveau politisch in Szene gesetzt werden – und Maßnahmen, die zwar das
Niveau der von ihnen begünstigten Renten anheben, die aber unter der geltenden
Anpassungsformel gleichzeitig zu einer Forcierung der Niveauabsenkung für alle
Renten beitragen.«
Punkt: Leistungsverbesserung für einige führen in der Gesamtheit aufgrund der
Mechanik der Rentenanpassungsformel dazu, dass das Kollektiv mit einer
Verschärfung der Rentenniveauabsenkung für alle konfrontiert wird, weil man
eben nicht an die Mechanik der Formel herangegangen ist.
überhaupt kommen? Steffen verweist hier auf den fundamentalen Paradigmenwechsel
in der Rentenpolitik Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre und meint:
»Den Wechsel von einer am Leistungsziel orientierten
Einnahmepolitik (das Sicherungsziel
bestimmt die Beitragssatzhöhe) hin zu einer am Beitragssatz orientierten
Ausgabenpolitik (die Beitragssatzhöhe
bestimmt das Sicherungsziel).«
demografische Entwicklung verwiesen sowie zum anderen aus der
„Standort“-Debatte der 1990er Jahre auf die angeblich nicht mehr stemmbaren
„Lohnnebenkosten“ für die Arbeitgeber aufgrund der steigenden Beitragssätze.
Hinzu kam damals »eine auf geradezu kindlichem Glauben an die unerschöpfliche
„Ergiebigkeit“ der kapitalmarktabhängigen Altersvorsorge gründende Lobpreisung
des Kapitaldeckungsverfahrens«, das dann in Form der „Riester-Rente“ in das
Alterssicherungssystem als weitere staatlich geförderte Säule eingezogen wurde.
hin zu einer am Beitragsziel orientierten Ausgabenpolitik: Der Beitragssatzanstieg
zur allgemeinen Rentenversicherung wurde faktisch auf maximal 20 Prozent bis
zum Jahr 2020 und maximal 22 Prozent bis zum Jahr 2030 gedeckelt. Und diese
Deckelung hatte Konsequenzen, denn auf der Ausgabenseite musste es nun
Ausgabenkürzungen geben – und diese nicht einmalig, sondern systematisch. Und
diese Systematik hat man realisiert über eine neue Rentenanpassungsformel, über
die dann die drastische Senkung des Rentenniveaus um rund ein Fünftel bis zu
Beginn der 2030er Jahre modelliert worden ist.
die Absenkung des Rentenniveaus im Zusammenspiel mit unterdurchschnittlichen
Einkommen (man denke hier an die vielen Niedriglöhner) und unvollständigen
Erwerbsbiografien aufgrund von Arbeitslosigkeit oder durch andere Gründe
bedingte Ausstiege aus der Beitragszahlung aus Erwerbsarbeit dazu führen muss,
dass es für bestimmte Personengruppen erhebliche Sicherungslücken im Alter
geben wird, die dazu führen werden, dass die Betroffenen auf ergänzende Leistungen
aus dem Grundsicherungssystem für Ältere angewiesen sind bzw. mit steigender
Tendenz sein werden. Darauf hat die Politik zu reagieren versucht, allerdings
wenig systematisch, wie Steffen argumentiert:
»So konzentrieren sich die wenig systematischen Ansätze von
CDU/CSU, SPD und GRÜNEN denn auch in der Hauptsache auf Maßnahmen und/oder
Instrumente, die eine Erhöhung von Anwartschaften im Einzelfall – Summe der
(persönlichen) Entgeltpunkte – zum Ergebnis haben (Anhebung des Niveaus der
Renten). Dieser Ansatz war schon für das zunächst gescheiterte Konzept der
sogenannten Lebensleistungsrente aus der vergangenen Wahlperiode kennzeichnend
und es findet seinen Niederschlag auch in dem von der großen Koalition für die
laufende Legislaturperiode angekündigten Vorhaben einer „solidarischen Lebensleistungsrente“. So
sollen langjährig Versicherte mit 35 (bis 2023) bzw. 40 Versicherungsjahren und
nach Einkommensprüfung eine Aufwertung ihrer Pflichtbeitragszeiten erfahren,
sofern sie ansonsten – und bei (ab 2024) kontinuierlich betriebener privater
Vorsorge – im Alter auf weniger als 30 Entgeltpunkte kommen. Wird dieses Ziel
im Einzelfall verfehlt, so soll bei vorliegender sozialhilferechtlicher
Bedürftigkeit ein weiterer Zuschlag bis zu einer Gesamtsumme von 30
Entgeltpunkten gewährt werden. – Ähnlich der Ansatz der GRÜNEN in ihrem Konzept
einer Garantierente, die Versicherten bei Vorliegen von 30 und mehr
Versicherungsjahren mindestens 30 Entgeltpunkte garantieren soll.«
den Bezug von bedürftigkeitsabhängigen Grundsicherungsleistungen nach
langjähriger Zugehörigkeit zum Pflichtversicherungssystem zu verhindern bzw. zu
reduzieren. Wer kann schon etwas dagegen haben? Aber:
»All diese Maßnahmen führen zweifelsohne zu einer
Verbesserung des Niveaus der Renten. Eine Wirkung, die im Übrigen allen
Maßnahmen zukommt, die die Guthaben auf den Versichertenkonten erhöhen. Vom
Niveau der (einzelnen) Renten streng zu unterscheiden ist das Rentenniveau und
dessen Entwicklung.«
zumindest teilweise sofort wieder kompensiert durch die negativen Wirkungen,
die sich aus einer anderen Mechanik im Rentensystem ergeben, denn beim »Rentenniveau
… geht es nicht um den Umfang der Anwartschaften, also die Summe der
(persönlichen) Entgeltpunkte, sondern um deren Wert oder Bewertung.
Ausschlaggebend für den Wert der Anwartschaften ist die Höhe des aktuellen
Rentenwerts (AR). Infolge der politisch vorgegebenen Abkoppelung der Renten von
der Lohnentwicklung verlieren die Rentenanwartschaften (Entgeltpunkte) aber
kontinuierlich an Wert – immer verglichen mit dem jeweiligen Stand der Löhne.
Dieser Prozess der Entwertung von Anwartschaften wird von keiner der
aufgeführten Maßnahmen verzögert und erst recht nicht gestoppt; auch die
genannten Leistungsverbesserungen selbst sind daher von der Rentenniveausenkung
betroffen und verlieren im Laufe der Zeit kontinuierlich an Wert.«
zweiten Hammer zu berücksichtigen:
»Im Zusammenhang mit der geltenden Anpassungsformel führen
sämtliche Leistungsverbesserungen ihrerseits zu einer Beschleunigung des
Wertverlustes der bereits berenteten wie auch aller noch nicht berenteten,
selbst der in Zukunft erst noch zu erwerbenden Anwartschaften.«
muss:
»Ein steigendes Niveau einzelner Renten führt unter der
geltenden Anpassungsformel zwingend zu einer (zusätzlichen) Verminderung des
Rentenniveaus für alle. Daher würden auch jene Maßnahmen, die der
Rentenversicherung derzeit beispielsweise zur Vermeidung steigender Altersarmut
politisch angedient werden, mit einer Dämpfung der Rentenanpassung und damit
einer zusätzlichen Senkung des Rentenniveaus für alle erkauft.«
allgemeinen Aspekt detailliert.
rentenpolitischen „Reset“. Gemeint ist damit: Anhebung des Rentenniveaus auf
den Status quo ante. Es geht ihm also um eine sozialpolitische Rückbesinnung
auf die lebensstandardsichernde gesetzliche Rente.
und dessen Stabilisierung im Zeitablauf erfordert eine neue
Rentenanpassungsformel. Hierbei sind unterschiedliche Wege möglich, je nachdem,
ob die Zielvorgabe Ausgangs- oder Endpunkt des Verfahrens ist (vgl. dazu
ausführlicher Steffen 2015: 22 ff.). Er präsentiert uns zwei Modifikationen der
Rentenanpassungsformel, mit denen man den einen Weg – „Die Renten folgen den
Löhnen“ – wie auch den anderen Weg – „das Leistungsziel dient als Vorgabe für
die Anpassungshöhe“ – beschreiten könnte.