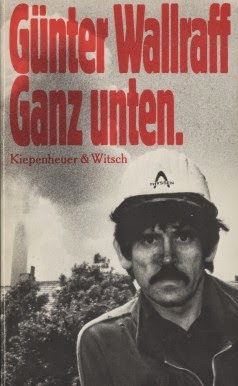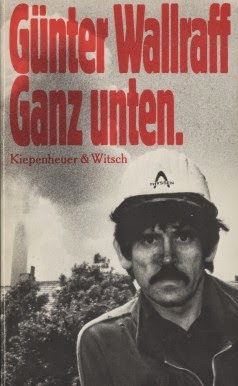Wir kennen das gerade in Deutschland: Erfolgsmeldungen hinsichtlich der Arbeitsmarktentwicklung – vom deutschen „Jobwunder“ ist da immer wieder die Rede. Anlässlich der neuen Arbeitsmarktzahlen meldete sich die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zu Wort: »Der Arbeitsmarkt ist in guter Form … Neue Höchststände mit fast 42 Millionen Erwerbstätigen und 29,4 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; dazu eine starke Frühjahrsbelebung nach den ohnehin schon guten Winterzahlen«, so die Ministerin. Nun auch in Großbritannien. Polly Toynbee berichtet von erwartbaren „triumphant headlines for the latest employment figures“ – und ergänzt mit einem sarkastischen Unterton: „More people will be in work, which is good news: far better to have half a job than no job at all.“ Allerdings entzaubern sich die schönen Zahlen bei genauerer Draufsicht und gleichzeitig – im Schatten der scheinbar guten Arbeitsmarktentwicklung – werden die Daumenschrauben für die Langzeitarbeitslosen richtig angezogen mit einem „Hilfsprogramm“, das den Begriff „workfare“ praktisch werden lässt.
Bleiben wir in einem ersten Schritt bei der – angeblich – so guten Arbeitsmarktentwicklung in Großbritannien. Polly Toynbee legt in ihrem Artikel den Finger auf die Wunde: »the last three-monthly figures showed that all the increase – yes, all of it – was not in jobs but in soaring self-employment, says Jonathan Portes of the National Institute for Economic and Social Research.« 80% der gesamten Beschäftigungszuwächse seit 2007 haben im Bereich vor allem der Solo-Selbständigkeit stattgefunden – vor allem aufgrund eines Mangels an alternativen Möglichkeiten der Erwerbsarbeit. Der „Notnagel“-Charakter wird auch hier erkennbar: »The TUC finds that 540,000 of the jobs created since 2010 are self-employed roles, with the over-50s in the majority and over-65s the fastest growing group.« Selbständigkeit als Fluchtweg vor allem für die älteren Erwerbslosen und für die armen Rentner. Die durchschnittlichen Einkommen der solo-selbständigen Frauen ist unter die 10.000 Pfund-Grenze gefallen. Auch über andere problematische Entwicklungen hinsichtlich der Qualität der Beschäftigung wird berichtet – über Leiharbeit und „Null-Stunden-Arbeitsverträge“: »Agency work and zero-hours contracts are growing ever more deeply embedded in the economy – no replacement for the good jobs lost.«
- Zu dem Phänomen der in Großbritannien um sich greifenden „zero-hour-contracts“ vgl. auch den Blog-Beitrag Ein „Arbeitgeber-Traum“ und ein Albtraum für Arbeitnehmer am Tag der Arbeit – ein Blick in das Land der „Null-Stunden-Arbeitsverträge“ auf der Facebook-Seite von „Aktuelle Sozialpolitik“, der sich auf Berichte über neue Zahlen zu dieser Beschäftigtengruppe bezieht (vgl. dazu Number of workers on zero-hours contracts tripels): »Es geht hier um mittlerweile 1,4 Millionen Menschen, die ohne irgendeine garantierte Stundenzahl und damit verbundener Bezahlung arbeiten. Mal viel, mal wenig, mal gar nichts. Je nach Bedarf des Arbeitgebers. Dem Artikel kann man entnehmen, dass jeder 10. Arbeitgeber in Großbritannien diese „Null-Stunden-Verträge“ nutzt. Und es überrascht nicht wirklich, dass von diesen Verträgen besonders Frauen, Jugendliche und ältere Arbeitnehmer jenseits der 65 betroffen sind.
Jetzt aber – und vor diesem Hintergrund – zu den Langzeitarbeitslosen. Polly Toynbee schreibt in ihrem Artikel: Je besser die Arbeitsmarktzahlen daherkommen (und seien diese rein kosmetischer Natur), desto einfacher wird es für die Regierung, die Daumenschrauben anzuziehen für diejenigen, die noch in der Arbeitslosigkeit verbleiben. Und genau das passiert derzeit in Großbritannien – wieder einmal unter dem Deckmantel eines als Hilfsprogramms für die Langzeitarbeitslosen getarnten Maßnahmepakets, mit dem im Ergebnis das Workfare-Regime weiter verschärft werden soll. Die verantwortlichen Politiker drücken das natürlich ganz anders aus – und beziehen sich explizit auf die angeblich so tolle Arbeitsmarktentwicklung und der „Sorge“ um die, die trotzdem arbeitslos bleiben: „We are seeing record levels of employment in Britain, as more and more people find a job, but we need to look at those who are persistently stuck on benefits. This scheme will provide more help than ever before, getting people into work and on the road to a more secure future,“ so wird der Premierminister David Cameron zitiert.
New Help to Work programme comes into force for long-term unemployed – hier erfahren wir Details über das neue Programm, dass in wenigen Tagen in Kraft treten wird. Die Regierung sagt, die Mitarbeiter der Jobcenter bekommen mehr Möglichkeiten „to support those who are hardest to assist under Help to Work“. Wenn man sich dem „Hilfsangebot“ verweigert, werden die Betroffenen mit dem Entzug ihrer Leistungen sanktioniert. Das „Help to Work“-Programm besteht aus drei Komponenten, die von den Jobcenter-Mitarbeitern eingesetzt werden: So soll es ein „intensives Coaching“ geben für die Arbeitslosen, eine Verpflichtung, täglich einen Berater im Jobcenter aufzusuchen sowie als dritter Baustein die Ableistung von „community work“ – alles über einen Zeitraum von sechs Monaten. Bereits im letzten Herbst hatte der Finanzminister des Landes, George Osborne, auf einem Parteitag der regierenden Konservativen ausgeführt:
»We are saying there is no option of doing nothing for your benefits, no something-for-nothing any more. They will do useful work to put something back into the community, making meals for the elderly, clearing up litter, working for a local charity. Others will be made to attend the jobcentre every working day.«
Die angesprochene „community work“ (formal als Community Work Placement (CWP) bezeichnet und für eine Zielgruppe von 200.000 Langzeitarbeitslose vorgesehen) wird dann auch noch in einem Orwellschen Sinne konsequent als „voluntary work“, also als „Freiwilligenarbeit“ oder „Ehrenamt“ tituliert. Die Beschreibung ähnelt dem, was wir in Deutschland kennen, wenn wir über Arbeitsgelegenheiten oder „Bürgerarbeit“ sprechen:
»The voluntary work could include gardening projects, running community cafes or restoring historical sites and war memorials. The placements will be for 30 hours a week for up to six months and will be backed up by at least four hours of supported job searching each week.«
Das setzt natürlich voraus, dass genügend „Freiwilligen-Arbeitsplätze“ bereitgestellt werden. Die Gewerkschaft Unite hat die Wohlfahrtsverbände und -organisationen aufgefordert, sich nicht an dem Programm zu beteiligen, denn es handele sich um eine „workfare“-Maßnahme, also um das Gegenteil von Freiwilligenarbeit oder Ehrenamt: Charity bosses urged to shun ‘workfare’ scheme by Unite. Für die Unite-Gewerkschaft handelt es sich um nichts weiter als unbezahlte Zwangsarbeit. Die Warnung an die Wohlfahrtsorganisationen kommt nicht von ungefähr, denn viele von ihnen leiden unter erheblichen Finanzierungsproblemen und könnten sich deshalb als „leichtes Ziel“ für das vergiftete Angebot der Regierung erweisen – allerdings mit fatalen Folgewirkungen, worauf die Gewerkschaft auch hinweist:
»The government sees cash-starved charities as a soft target for such an obscene scheme, so we are asking charity bosses to say no to taking part in this programme. This is a warping of the true spirit of volunteering and will force the public to look differently at charities with which they were once proud to be associated.«
Es bleibt abzuwarten, wie die angesprochenen Organisationen reagieren.
Help to Work? Britain’s jobless are being forced into workfare – so wie die Überschrift eines Blog-Beitrags von Anna Coote kann man das zusammenfassen, was hier abläuft. Das kann man grundsätzlich kritisieren, man kann es aber auch im Lichte der bisherigen Erfahrungen mit den workfare-Ansätzen tun, darauf stützt sich beispielsweise die Argumentation von Polly Toynbee, die ihren Artikel prägnanterweise überschrieben hat mit: Help to Work is a costly way of punishing the jobless.
Auf einen diskussionswürdigen Aspekt hat Anna Coote hingewiesen: »The ground has been well prepared by the government’s divisive narrative that separates the population into two opposing camps: strivers and skivers«. Also die Separierung in gute und schlechte Arbeitslose, ein ewig wiederkehrendes Muster. Hier die „Streber“ und da die „Drückeberger“, um in der Begrifflichkeit von Coote zu bleiben:
»… strivers are people who are paid for the work they do; they work hard, investing copious effort and often long hours for low pay in order to earn a living, support their families and get on in the world. They are insiders: socially dependable, economically productive and morally righteous. Skivers, on the other hand, are lazy, unreliable and manipulative, choosing to live at others‘ expense so that they can sleep, watch television, abuse various substances and fritter away their time. They are outsiders: untrustworthy, unproductive and morally disreputable.«
Es geht am Ende um ein „punitive welfare regime“. In diesem ist es richtig, den Druck auf die Menschen zu erhöhen – „and make the worthless skivers suffer“. Und das Schlimme ist: Durch die moralisch aufgeladene Trennung in die „guten“ und „schlechten“ Arbeitslosen erleichtert man das Wegschauen, wenn die angeblichen Drückeberger leiden müssen. Und schon beginnt der Kreis sich zu schließen.