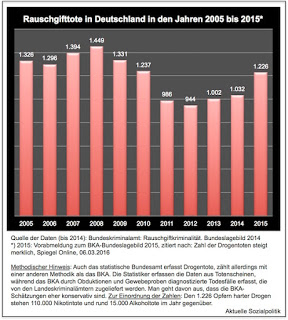Wenn man die zurückliegenden Wochen und Monate Revue passieren lässt und in Rechnung stellt, dass im Herbst des kommenden Jahres Bundestagswahlen anstehen, dann werden wir einen Wahlkampf erleben, bei dem vieles um das Thema Rente kreisen wird. Da kann es aus parteipolitischer Sicht durchaus Sinn machen, so schnell wie möglich ein eigenes Konzept in den öffentlichen Raum zu stellen und dazu noch ein oder zwei marktgängige Begriffe zu besetzen. Das können wir gerade am Fallbeispiel der Grünen besichtigen, die am 3. Juni 2016 sichtlich zufrieden unter der Überschrift Grüne Rente mit Zukunft mitgeteilt haben: »Viele Menschen machen sich große Sorgen um ihre Altersvorsorge. Der grüne Bundesvorstand hatte deshalb vor zwei Jahren eine Rentenkommission damit beauftragt, Konzepte auszuarbeiten, wie die Alterssicherung in Deutschland weiterentwickelt werden kann.« Und nun liegt das Ergebnis vor: Abschlussbericht der Grünen Rentenkommission, so trocken ist das Dokument überschrieben. Und es enthält unter anderem auch einen eingängig daherkommenden Begriff, der schon seit einigen Jahren immer wieder im grünen Sprachgebrauch auftaucht: Eine „Garantierente“. Also eine grüne Garantierente.
Wenn etwas garantiert wird, dann hat das gerade in den heutigen Zeiten einen ganz eigenen Wert, wie viele gebeutelte Bürger wissen, wenn sie beispielsweise an „Garantiezinsen“ bei Lebensversicherungen denken, deren garantierte Höhe in den vergangenen Jahren geschmolzen ist wie die Butter in der Sonne.
Man habe ein Konzept für eine steuerfinanzierte Garantierente erarbeitet, die allen Menschen, die mindestens 30 rentenversicherungspflichtige Jahre vorweisen können, eine Rente ermöglicht, die oberhalb der Grundsicherung liegt. Viele werden sich natürlich für die Höhe interessieren. 900 Euro könnten es werden. Denn die Garantierente soll sich auf 30 Entgeltpunkte belaufen (ein Punkt entspricht im Westen vom 1. Juli an einem Rentenwert von 30,45 Euro). Dann kommt man auf die genannten 900 Euro.
Nun könnte der eine oder andere an dieser Stelle einwerfen, dass sich das aber sehr nach der „Lebensleistungsrente“ anhört, die bei der Großen Koalition auf der Liste noch zu erledigender Punkte steht – wobei nicht nur die Sprachwissenschaftler ihre Freude an der Begrifflichkeit haben werden, wenn man bedenkt, dass es ganz korrekt „solidarische Lebensleistungsrente“ heißen muss, folgt man dem Koalitionsvertrag, denn die Union hatte vor der Regierungsbildung für eine „Lebensleistungsrente“ geworben, während die SPD mit einer „Solidarrente“ hausieren gegangen ist. Bei der Koalitionsbildung hat man dann die beiden Begriffe vereinigt zu eben einer „solidarischen Lebensleistungsrente“, damit sich jeder wiederfinden kann (vgl. dazu den Beitrag Mehr als ein rentenpolitischer Sturm im Wasserglas? Die „Lebensleistungsrente“ erhitzt die Gemüter vom 1. April 2016).
Und wie soll die „Lebensleistungsrente“ nun aussehen?
Wer lange Jahre Vollzeit gearbeitet, für sich vorgesorgt hat und dennoch keine Rente bezieht, die die Sozialhilfe übersteigt, soll die Lebensleistungsrente erhalten. Sie soll mit rund 880 Euro im Monat knapp oberhalb der Grundsicherung liegen und den Betroffenen den Gang zum Sozialamt ersparen, so das Konzept dieses Ansatzes, der immerhin im Koalitionsvertrag steht.
Dieses Ansinnen ist bei vielen aus ganz unterschiedlichen Gründen auf Kritik gestoßen. Für eine besonders heftige Ablehnung reicht es bei Franz Ruland. Er war von 1992 bis 2005 Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger sowie von 2009 bis 2013 Vorsitzender des Sozialbeirats der Bundesregierung. Seine Meinung dazu hat er in einen Artikel mit dieser mehr als deutlichen Überschrift gepackt: Stoppt den Unfug!
Seine Einwände sehen zusammengefasst so aus und zeigen, dass wir es hier mit einem klassischen Vertreter des Sozialversicherungssystems zu tun haben:
»Schon der Name „Lebensleistungsrente“ ist eine Irreführung. Für diejenigen, deren Lebensleistung nicht zu einer ausreichenden Rente gereicht hat, soll es eine „Sozialhilfe de luxe“ geben, die die Rentenversicherung auszahlt. Die Leistung wäre keine Rente. Sie setzt die zu prüfende Bedürftigkeit voraus, notwendigerweise auch die des Ehegatten. Auch der Effekt der Beitragszahlung ist ganz anders. Bei der Rente steigern die Beiträge den Anspruch, bei der Lebensleistungsrente mindern sie ihn. Wer für diese Leistung den Begriff „Rente“ verwendet, hat den grundlegenden Zusammenhang von Beitrag und Rente nicht verstanden oder – noch schlimmer – will ihn verwischen.
Die Begründung für die geplante Leistung ist ärgerlich. Der Gang zum Sozialamt sei diesen Personen unzumutbar. Wieso ist er es dann für die anderen, die auf Sozialhilfe angewiesen bleiben, etwa für eine Frau, die, weil sie Kinder erzieht und deswegen nicht arbeiten kann, auf Sozialhilfe angewiesen ist?«
Ruland weist zudem darauf hin, dass nur relativ wenige Personen überhaupt für diese neue Leistung in Frage kommen würden:
»2014 wären es laut Bundesregierung 66.000 Personen gewesen, die nach 35 Beitragsjahren weniger als 880 Euro Rente erhalten. Ab 2023 sollen 40 Beitragsjahre vorausgesetzt werden, die Zahl der Berechtigten würde auf 40.000 absinken, danach aber ansteigen. Doch müssen diese Personen auch noch hinreichend lange privat vorgesorgt haben. Die meisten Rentner mit niedrigen Renten bekämen sie also nicht.«
Zur Erinnerung: Wir haben heute schon über 20 Millionen Rentner. Die für die „solidarische Lebensleistungsrente“ vorgesehenen Zugangshürden seien so hoch, dass Arbeitsministerin Andrea Nahles „jeden einzelnen Lebensleistungsrentner mit Handschlag begrüßen kann“, so wird der rentenpolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, Markus Kurth, in einem Artikel von Thomas Öchsner in der Süddeutschen Zeitung vom 4. Juni 2016 zitiert. Eine Rosstäuscherei also?
Die nicht nur sehr niedrig erscheinenden Zahlen für die Gruppe der potenziell Inanspruchberechtigten lässt sich natürlich zurückführen auf die sehr restriktive Ausgestaltung der Zugangsvoraussetzung für den Leistungsbezug, also vor allem die notwendigen Beitragsjahre und dann auch noch eine nachgewiesene private Vorsorge. Das muss auch vor diesem Zusammenhang gesehen werden:
»Niedrige Renten sind meist Folge einer zu kurzen Versicherungsdauer. Wer nicht auf die 35 beziehungsweise 40 Jahre mit Pflichtbeiträgen kommt, bleibt bei der Sozialhilfe. Das betrifft insbesondere Langzeitarbeitslose, Personen, die abwechselnd selbständig tätig und abhängig beschäftigt waren, Frauen, die viele Kinder erzogen haben, oder Geringverdiener, die nicht zusätzlich privat vorgesorgt haben.«
Dem verantwortungsvollen Sozialpolitiker, der immer auch auf die Auswirkungen in den bürokratischen Systemen schauen wird, mag es angesichts der möglichen und wahrscheinlichen Fallkonstellationen und der dadurch ausgelösten Zuständigkeitsfragen die Nackenhaare sträuben. Ein Beispiel: Was machen wir, wenn bei einer hinsichtlich der Lebensleistungsrente leistungsberechtigten Person in deren Haushalt andere Personen leben, »die trotz ihrer Bedürftigkeit keinen Anspruch auf die Lebensleistungsrente haben, etwa die Ehefrau. Dies würde dazu führen, dass bei diesen Personen zweimal die Bedürftigkeit geprüft werden muss, bei der Rentenversicherung und beim Sozialamt.« So der Hinweis bei Ruland, der damit einhergehend zugleich darauf verweist, dass in der Verwaltung neue und teure Doppelstrukturen aufgebaut werden müssten.
Aber das können die (derzeit noch) oppositionellen Grünen doch nicht wirklich auch wollen? Doch, im Grunde wollen sie das auch, nur mit einem für die (potenziell) Betroffenen ganz wichtigen Unterschied: Die Zugangshürden sollen bei weitem nicht so hoch sein wie bei den „solidarischen Lebensleitsungsrenten“-Befürworter. Schauen wir in den Abschlussbericht der Grünen Rentenkommission. Da findet man diese Erläuterung:
Es geht den Grünen bei ihrer Garantierente »um Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersarmut für langjährig Versicherte. Denn niedrige Löhne, Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Pflege von Angehörigen oder der Erziehung von Kindern können dazu führen, dass Versicherte trotz langjähriger Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht auf 30 Entgeltpunkte kommen und somit auf Leistungen der Grundsicherung im Alter angewiesen wären. Für diese Versicherten wollen wir eine steuerfinanzierte Garantierente innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung schaffen, die eine Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus verspricht.«
Und an anderer Stelle erfährt man diesen wichtigen Punkt:
»Die Garantierente soll ohne Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt werden, das heißt betriebliche und private Altersvorsorge werden nicht angerechnet.«
Das hätte natürlich eine andere Qualität als die „Lebensleistungsrente“ und man mag eigentlich gar nicht sofort die zahlreichen sich anschließenden Fragen hinsichtlich einer Garantierente auflisten, die einem in den Sinn kommen hinsichtlich der Fallkonstellationen in der Wirklichkeit.
Was man allerdings grundsätzlich ansprechen muss ist die Frage nach dem Referenzsystem für die Garantierente. Bei der Lebensleistungsrente in ihrer seit dem Vorstoß der damaligen Bundesarbeitsministerin Ursula von der Lesern (CDU) im politischen Raum zirkulierenden Form ist es nur auf den ersten Blick die einzelne Person mit einer zu niedrigen Rente, denn für die Leistung soll ja die Bedürftigkeit geprüft werden und die ergibt sich eben immer aus dem Haushaltskontext. Wenn also eine auf den ersten Blick „bedürftige“ Person aufgrund einer zu niedrigen Rente mit einer anderen Person in einem gemeinsamen Haushalt zusammenlebt dann würde keine Bedürftigkeit vorliegen, da der Haushalt – wie im SGB II auch – als Bedarfsgemeinschaft betrachtet und bewertet wird.
Das wäre übrigens auch in anderen Alternativentwürfen aus den Reihen der Opposition der Fall, man denke hier nur an die Forderung der Linken, „eine steuerfinanzierte, einkommens- und vermögensgeprüfte Solidarische Mindestrente“ einzuführen (vgl. dazu bereits das rentenpolitische Papier Eine Rente zum Leben vom 10.09.2012).
Die entscheidende Frage ist also die nach dem Individualisierungsgrad der Garantie-, Mindest- oder wie sie immer auch heißen soll.
Hier bewegen wir uns im Zentrum eines grundsätzlichen und nicht aufhebbaren Unterschieds zwischen den Sozialversicherungen und einem bedürftigkeitsabhängigen Transferleitungssystems. Denn die Zahlungen in einer klassischen Sozialversicherung sind in Reimform individualisiert, da sie personenbezogene, mit einem grundsätzlichen Rechtsanspruch versehene Versicherungsleistungen darstellen. Anders formuliert: Die Rente in Höhe von x Euro bekommt die Person A auch dann, wenn sie mit Person B, die beispielsweise über eine ordentliche Beamtenpension verfügt, zusammenlebt. Bei einer bedürftigkeitsabhängigen Transferleistung wäre das nicht der Fall, denn die ist nicht nur Einkommens-, sondern auch vermögensabhängig und das bezogen auf den Haushaltskontext.
Dazu findet sich in dem zitierten Abschlussbericht der Grünen Rentenkommission (noch) nichts.
Die besprochene Garantierente, soweit man deren Umrisse einordnen kann, stehen aber nicht singulär im politischen Raum herum, sondern sie ist eingebettet in ein „grünes Rentenkonzept“, das noch andere Bausteine enthält und dann natürlich auch in dem größeren Zusammenhang bewertet werden muss. So kann man dem Abschlussbericht der Grünen Rentenkommission folgende Punkte entnehmen (vgl. dazu die Zusammenfassung Grüne Rente mit Zukunft):
»Das Rentenniveau muss stabilisiert werden, so dass … Durchschnittsverdiener mit 45 Beitragsjahren auch über das Jahr 2025 hinaus mindestens eine Rente erhalten, die 50% oberhalb der Grundsicherung liegt.« Hier wird also der von der damaligen rot-grünen Bundesregierung 2001 verabschiedete Sinkflug des Rentenniveaus angesprochen.
Auch der „alte“ Gedanke einer „Bürgerversicherung“ ist nicht verloren gegangen: »Wir wollen die Rentenversicherung mittelfristig zu einer Bürgerversicherung umbauen, in die alle Bürgerinnen und Bürger einzahlen, d.h. auch Beamte, Freiberuflerinnen und Freiberufler, Selbstständige und Abgeordnete. Das stabilisiert unsere Rentenversicherung und schützt vor Altersarmut. Als erster Schritt sollen alle nicht anderweitig abgesicherten Selbstständigen in die bestehende Rentenversicherung einbezogen werden.«
Die ebenfalls von Rot-Grün implementierte Riester-Rente wird mittlerweile als Fehlentwicklung identifiziert und anstehende Veränderungen werden mit der im derzeit schwarz-grün regierten Hessen entwickelten „Deutschland-Rente“ (vgl. dazu den Blog-Beitrag Riester in Rente und endlich eine „faire private Altersvorsorge“? Die „Deutschland-Rente“ schafft es immerhin schon in den Bundestag vom 29. Januar 2016) verknüpft: »Wir wollen die Riester-Rente grundlegend reformieren und ein neues Basisprodukt einführen, das einfach, kostengünstig und sicher ist.«
Und auch die Geschlechterfrage wird angesprochen: »Um eine gleichberechtigte Rente für Frauen und Männer zu fördern, wollen wir außerdem ein obligatorisches Rentensplitting einführen: Paare sollen ihre gesetzlichen Rentenansprüche zukünftig mitenander teilen, unabhängig davon, wer wie viel gearbeitet hat.« Und das schrittweise auf 67 ansteigende Renteneintrittsalter wird nicht grundsätzlich zur Disposition gestellt, sondern: Das Renteneintrittsalter sollte … keine starre Grenze mehr darstellen. Altersteilzeit soll bereits ab dem 60. Lebensjahr möglich sein. Da man damit aber auf einen Teil seines Gehalts verzichtet, sollten gleichzeitig die Hinzuverdienstregelungen vereinfacht werden.« Das ist passungsfähig zur derzeitigen Diskussion über eine „Flexi-Rente“.
Natürlich kann man die Hypothese aufstellen, dass solche Skizzierungen von Grundlinien der rentenpolitischen Gestaltung nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern immer auch eingebettet sind in die Frage, ob und mit wem man diese Vorstellungen oder einen Teil davon in einem möglichen Regierungsbündnis umsetzen kann. Und bei den Grünen, vor allem aber in der medialen Diskussion über sie taucht immer wieder die These auf, dass im kommenden Jahr ein schwarz-grünes Regierungsbündnis auf Bundesebene eine Option sein könnte.
Vor einem solchen Hintergrund ist es natürlich interessant, wenn parallel zu den rentenpolitischen Vorschlägen der Grünen auch aus der Union entsprechende Vorschläge in die Öffentlichkeit getragen werden – bzw. sagen wir es genauer: aus einem Teil der Union, konkret vom Arbeitnehmerflügel der CDU.
Thomas Öchsner hat darüber in der Süddeutschen Zeitung berichtet: CDU-Fachleute legen ein Konzept gegen Altersarmut vor. Konkret handelt es sich um Vorschläge von Peter Weiß, Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Rentenpolitik, und Eva Welskop-Deffaa, Chefin der Arbeitsgruppe Rente in der CDU. Die haben das unter der Überschrift Die Rente 4.0 – Das Konzept der dynamischen Rente für die Arbeitswelt der Zukunft am 5. Juni 2016 veröffentlicht.
Auch bei den beiden Unionsvertretern geht es um das sinkende Rentenniveau, fasst Öchsner zusammen:
»Die CDU-Rentenexperten fordern …, dass der Staat ein Mindestrentenniveau bis 2070 garantieren soll. Dieses sollte aber höher sein als die gesetzlich angepeilten 43 Prozent. Sonst müssten künftig auch viele langjährig Versicherte als Rentner zum Sozialamt und die staatliche Grundsicherung im Alter beantragen … Das Rentenrecht verstoße „perspektivisch gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Eine Pflichtversicherung ist nur vertretbar, wenn ein ausreichender Mehrwert/Abstand der Standardrente im Vergleich zur vorleistungsfreien Grundsicherung gesichert ist“.«
Natürlich stellt sich sogleich die Finanzierungsfrage. Die beiden Rentenexperten schlagen eine drittelparitätische Finanzierung vor: Künftig sollen Staat, Arbeitgeber und Arbeitnehmer je ein Drittel der Beiträge finanzieren.
»Bei dieser „Drittelparität“ zahlen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Bund jeweils einen gleich hohen Beitrag. Zugleich schlagen Weiß und Welskop-Deffaa eine zweite Beitragsbemessungsgrenze vor. Diese soll bei 50 Prozent über der Regelgrenze (derzeit 6200 Euro im Westen) liegen, das wären etwa 9000 Euro im Monat. Die Beiträge oberhalb der normalen Beitragsgrenze werden aber nicht staatlich ko-finanziert. Gleichzeitig sollen in die Rentenkasse künftig auch Selbständige einzahlen, „sofern sie nicht in einem berufsständischen Versorgungswerk abgesichert sind“.«
Eingedenk der Ausführungen über das grüne Rentenkonzept gibt es an einer weiteren Stelle Anknüpfungspunkte – dem Splittingmodell:
»In der Regel werden bei Scheidungen die in der Ehe erworbenen Rentenansprüche geteilt. Die CDU-Experten sprechen sich nun dafür aus, mit Beginn der Ehe die Rentenansprüche gleich zu splitten – jeder sieht so, woran sie oder er ist. Zugleich soll es die Chance geben, die Beiträge freiwillig aufzustocken, um für eine Scheidung besser abgesichert zu sein. Die, sagt Welkskop-Deffaa, „ist eines der größten Risiken für Altersarmut“.«
In der Großen Koalition versucht man derzeit, die dort ausgebrochene rentenpolitische Unruhe wieder etwas einzufangen. So wird im neuen SPIEGEL (Heft 24/2016) unter der Überschrift „Aus drei mach zwei“ berichtet:
»Horst Seehofer macht einen Rückzieher: Die CSU wird im Herbst kein eigenes Rentenkonzept präsentieren, sondern mit der CDU einen gemeinsamen Reformvorschlag vorlegen. Das Niveau der gesetzlichen Rente soll dabei, anders als von Seehofer vorgeschlagen, nicht auf dem heutigen Niveau eingefroren werden, heißt es in der Union. Man wolle sich bei einem so wichtigen Thema wie der Rente nicht schon wieder uneinig zeigen. Das Konzept soll von der bayerischen Sozialministerin Emilia Müller, CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn und dem Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Karl-Josef Laumann, erarbeitet werden.
Bundessozialministerin Andrea Nahles setzt bei ihren Vorarbeiten für die geplante Rentenreform auf externen Sachverstand. Bevor sie ein Gesamtkonzept vorlegt, will sie sich mit Wissenschaftlern, Sozialexperten und Verbänden in einem „Dialog zur Alterssicherung“ beraten, wie es im Einladungsschreiben der SPD-Politikerin heißt. Die erste Sitzung der 18 Experten soll am 8. Juli im Ministerium stattfinden, Thema wird die zusätzliche Altersvorsorge sein. Aus der Einladung geht auch hervor, dass mit einem Reformkonzept nicht vor Ende Oktober zu rechnen ist. Nahles hat bereits angekündigt, dass sie nicht allein auf das gesetzliche Sicherungsniveau abstellen, sondern vor allem die Betriebs- und Riesterrente reformieren will.«
Eines ist sicher – die rentenpolitische Diskussion hat Fahrt aufgenommen und wir werden in den vor uns liegenden Monaten mit so einigen weiteren Vorschlägen konfrontiert werden, die angesichts der näher rückenden Bundestagswahlen immer auch von eher oder gar primär parteipolitisch motivierten Verunreinigungen durchsetzt sein werden.