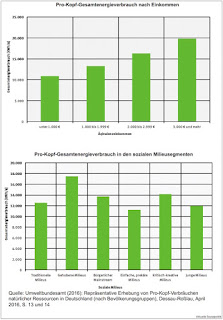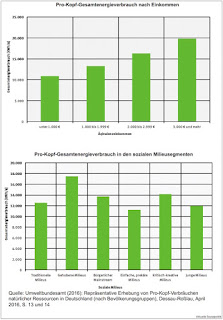Gerade in der weiten Welt der Sozialpolitik schlagen die Themen, hinter denen zumeist Probleme und zuweilen gar Systemfragen stehen, immer wieder auf. Und dann stellt man fest, dass darüber vor längerem auch auf dieser Seite bereits berichtet worden ist. So beispielsweise konkret am 18. Februar 2015. Da wurde hier der Beitrag Überlastet und unterfinanziert – die Notaufnahmen in vielen Krankenhäusern. Zugleich ein Lehrstück über versäulte Hilfesysteme. Und über einen ambivalenten Wertewandel publiziert. Darin wurde bereits vieles von dem angesprochen, was im September 2016 erneut für einen kurzen Moment durch die Medien transportiert wird bzw. wurde, denn die Haltbarkeitsdauer solcher Thematisierungen schrumpft bekanntlich auf einige wenige Tage (wenn überhaupt) zusammen, dann ist der mediale Zug schon wieder weg. Nicht aber das Problem oder – wie heißt das heute immer so gerne – die „Herausforderungen“. Und wenn wir hier von Herausforderungen sprechen, denen sich die Notaufnahmen vieler Krankenhäuser ausgesetzt sehen, dann reden wir nicht über irgendwelche abseitigen oder marginalen Themen, sondern a) über das höchste Gut für die meisten Menschen, also Gesundheit bzw. die Behandlung bei Krankheit und b) über seit Jahrzehnten (gefühlt seit Jahrhunderten) ausdifferenzierte, voneinander – wo es geht – abgeschottete, in Konkurrenz miteinander stehende und zugleich aufeinander angewiesene „Sektoren“ des Gesundheitswesens.
Und in dem Beitrag aus dem vergangenen Jahr wurde auch beschrieben, wie es eigentlich sein sollte, mit der Versorgung der Notfälle – also ein Thema, das uns alle bewegt oder bewegen sollte:
»In der Idealwelt geht das so: Die niedergelassenen Vertragsärzte sind für die ambulante, sowohl haus- wie auch fachärztliche Versorgung zuständig. Und dazu gehören eigentlich auch Hausbesuche und vor allem die Sicherstellung der ambulanten Versorgung an Wochenende oder an Feiertagen. Dafür gibt es dann einen – regional immer noch sehr unterschiedlich organisierten – ärztlichen Bereitschaftsdienst, den die niedergelassenen Ärzte bestücken müssen. Entweder selbst oder dadurch, dass die Dienste an Ärzte vergeben werden, die das auf Honorarbasis machen. Aber neben diesen Bereitschaftsdiensten der niedergelassenen Ärzte gibt es dann auch noch die Notaufnahmen der Krankenhäuser, die rund um die Uhr geöffnet sind. Nun könnte man auf die Idee kommen, dass die beiden Hilfesysteme eigentlich nichts miteinander zu tun haben und für die Idealwelt würde das auch gelten, denn die Notaufnahmen der Kliniken wären hier zuständig für Unfallopfer oder schwerere Erkrankungen, während alle leichten und mittelschweren Fälle zu den Niedergelassenen gehen. Aber bekanntlich leben wir nicht in einer Idealwelt.«
Aber wie so oft im Leben will sich die wirkliche Wirklichkeit nicht an die Schönheit und Reinheit der Vorgaben der Idealwelt halten und so kreiste bereits vor anderthalb Jahren die Diagnose und die daraus abgeleiteten Empfehlungen um „abweichendes Verhalten“ der Menschen, die an dieser „Schnittstelle“ zwischen ambulant und stationär aufschlagen.
„Die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind vielerorts stark überlastet und absolut unterfinanziert. Sie werden immer stärker zum Lückenbüßer für die eigentlich zuständigen Bereitschaftsdienste der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen)“, so wurde damals die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) zitiert, die sich unter der Überschrift Milliarden-Defizit bei ambulanter Notfallversorgung zu Wort gemeldet hatte. Und um den Vorwurf zu fundieren, hatte man ein Gutachten im Gepäck, das unter anderem zu Tage förderte, dass von den jährlich in Notaufnahmen der Kliniken versorgten 20 Millionen Patienten mehr als zehn Millionen ambulant versorgt werden. Ein Drittel der allgemeinen Notfallbehandlungen sei problemlos in ambulanten Praxen lösbar. Aber offensichtlich gelingt das nicht oder die betroffenen Menschen wollen das nicht oder die niedergelassenen Ärzte können nicht.
Für die Krankenhäuser wurde dann eine ziemlich niederschmetternde Rechnung aufgemacht: Einem durchschnittlichen Erlös von 32 Euro pro ambulantem Notfall stünden Fallkosten von mehr als 120 Euro gegenüber. Mehr als 10 Millionen ambulante Notfälle mit einem Fehlbetrag von 88 Euro pro Fall führten zu 1 Milliarde Euro nicht gedeckter Kosten.
Auch wenn man darauf hinweisen muss, dass diese – wie so oft – sehr genau bezifferten Werte auf der Basis einer hochgerechneten Stichprobe stammen – offensichtlich geht es hier um ein richtig großen Batzen Geld.
Und um Geld wie auch um das bereits beschriebene Problem geht es auch in diesen Tagen. Verharren wir einen Moment beim Gelde: Ein Minusgeschäft, so ist ein Artikel dazu überschrieben, in dem die Sichtweise der Krankenhäuser in katholischer Trägerschaft beschrieben wird. Zitiert wird darin Ingo Morell, der stellvertretende Vorsitzende des Katholischen Krankenhausverbands in Deutschland (KKVD):
„Im Schnitt bekommt ein Krankenhaus für die ambulante Behandlung pro Notfallpatient 32 Euro, während reelle Kosten von etwa 126 Euro entstehen. Wir haben außerdem bereits heute deutlich mehr ambulante als stationäre Fälle in den Krankenhäusern: Im Jahr werden allein in den katholischen Kliniken rund fünf Millionen Patienten ambulant und nur 3,5 Millionen stationär versorgt.“ Man müsse daher auch die Frage stellen, warum so viele Patienten in die Notfallambulanzen der Krankenhäuser kommen …
Und den Ball wieder ins andere Spielfeld zurück kickend: »Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) musste … in ihrer jährlichen Patientenbefragung erneut feststellen, dass ihre bundesweite Notrufnummer 116117 kaum jemand kennt.«
Dass hört sich sehr verteidigend an. Warum versucht man sich von der Klinikseite her zu rechtfertigen? Hintergrund: Die niedergelassenen Ärzte kritisieren seit längerem, dass eigentlich ambulante Versorgungsfälle in einem Volumen von drei bis fünf Milliarden Euro in Krankenhäusern landeten.
Wie kommt man nun auf solche Zahlen? Da wird man fündig beim Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) in Berlin. Die haben sich am 22. Juli 2016 unter dieser Überschrift zu Wort gemeldet: Vermeidbare Notfälle kosten das Gesundheitssystem Milliarden Euro. Deren Argumentation geht so: »Auch während der regulären Praxisöffnungszeiten suchen häufig Menschen auf Eigeninitiative und ohne ärztliche Einweisung die Krankenhäuser auf. Wie das IGES Institut im Auftrag des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) berechnet hat, summieren sich die Kosten für die Aufnahme und die stationäre Behandlung dieser Menschen, denen ein niedergelassener Arzt gut hätte helfen können, auf knapp 4,8 Milliarden Euro jährlich.« Mehr als die Hälfte aller vermeidbaren Krankenhausfälle werden ohne ärztliche Einweisung aufgenommen. Betrachtet man das Geschehen an Werktagen, entsteht rund die Hälfte der Aufnahmen ohne ärztliche Einweisung zu den üblichen Praxisöffnungszeiten. Zum angesprochenen Gutachten vgl. IGES: Ambulantes Potenzial in der stationären Notfallversorgung, Berlin 2016).
Das Zi spiegelt die Interessen er niedergelassenen Ärzte und so können die Handlungsempfehlungen auch nicht wirklich überraschen: Der Vorstandsvorsitzende des Zi, Andreas Gassen: »Eine Lösung könnten ambulante Anlaufstellen an wichtigen Krankenhausstandorten sein. Um solche Schlüsselstandorte zu ermitteln, müssten regionale Experten mit entscheiden – vor allem die Kassenärztlichen Vereinigungen.«
Jetzt haben wie die Klinikseite gehört, wir haben die Seite der niedergelassenen Vertragsärzte zur Kenntnis genommen – aber da gibt es doch noch mehr Akteure? Genau, wie wäre es mit den Krankenkassen, denn letztendlich zahlen die ja auch den größten Teil dessen, was hier unter Notfällen diskutiert wird.
Die Kassenseite hat sich ebenfalls in die Debatte eingebracht – und ja, auch sie bestückt mit einem Gutachten, um die eigenen Forderungen anzureichern: Reform der ambulanten Notfallversorgung: vdek und AQUA-Institut stellen Gutachten vor, wurde am 6. September 2016 gemeldet.
Das angesprochene Gutachten kann man sich im Original anschauen:
Köster, C et al.: Ambulante Notfallversorgung. Analyse und Handlungsempfehlungen. Göttingen: AQUA – Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH, 2016
Ausgehend von dem Gutachten präsentiert uns der Krankenkassenverband vdek folgende Vorschläge zur Verbesserung der ambulanten Notfallversorgung:
Dreh- und Angelpunkt ist die Errichtung von sogenannten Portalpraxen an allen Krankenhäusern Deutschlands, die rund um die Uhr an der stationären Notfallversorgung teilnehmen. Die Portalpraxis sollte in der Regel aus einer festen Anlaufstelle für die Notfallpatienten sowie aus einer ambulanten Notdienstpraxis bestehen, die ebenfalls am Krankenhaus angesiedelt sein sollte. In der Anlaufstelle soll eine rasche Erstbegutachtung der Patienten vorgenommen und der Behandlungsbedarf eingeschätzt werden. Die Anlaufstelle leitet die Patientinnen und Patienten dann entweder in die niedergelassene Arztpraxis außerhalb des Krankenhauses (innerhalb der Sprechstundenzeiten) oder in die ambulante Notdienstpraxis im Krankenhaus (außerhalb der Sprechstundenzeiten) bzw. in die Notaufnahme des Krankenhauses weiter. Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) sind im Rahmen ihres Sicherstellungsauftrags zuständig für die Organisation der Portalpraxen.
Auch der Kassenverband teilt die bereits angesprochene Diagnose: Immer mehr Patienten steuern im Notfall das Krankenhaus an, auch wenn sie eigentlich ambulant hätten behandelt werden können. »Unklare Sprechstundenzeiten und Anlaufstellen der niedergelassenen Ärzte, unklare Aufgabenteilung zwischen ambulantem und stationärem Notdienst und die Unsicherheit der Patientinnen und Patienten seien die Hauptgründe dafür. So werden jährlich bis zu 25 Millionen Menschen in den Notaufnahmen der Krankenhäuser behandelt, mit steigender Tendenz.«
Als Ziel wird ausgegeben, die Patienten „in den richtigen Behandlungspfad zu lotsen“. Das will man also offensichtlich über das Konzept der Portalpraxen hinbekommen, die nun kein wirklich ganz neuer Ansatz sind, denn teilweise gibt es die schon an den Krankenhäusern im Rahmen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zu den Zeiten, in den die Praxen der Niedergelassenen geschlossen sind.
Man muss sich aber vielleicht noch mal zusammenfassend klar machen, was da vorgeschlagen wird: Die Ersatzkassen fordern, dass an jeder der 1.600 Kliniken mit Notfallversorgung sogenannte Portalpraxen eingerichtet werden, die rund um die Uhr geöffnet sind. Übrigens: Die Idee mit den Portalpraxen steht bereits im Gesetz, allerdings handelt es sich um eine Soll- und keine Muss-Vorschrift. Gegenwärtig ist es so, dass die KVen spezielle Notdienstpraxen mit festem Standort eingerichtet haben, oft auch direkt bei Kliniken. 600 gibt es davon inzwischen, ihre Dichte ist aber in Ostdeutschland weit geringer als im Westen.
Dieser Vorschlag wurde in den Medien aufgegriffen: Wenn der Notfall im Krankenhaus kein Notfall ist, so ist beispielsweise einer der Artikel dazu überschrieben. Darin findet man auch eine Reaktion der Kassenärztlichen Vereinigungen auf den Ansatz: »Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) sieht das Problem dadurch aber … nicht gelöst. „Selbst da, wo die Praxen etabliert sind, sind die Notaufnahmen überlastet“, sagte der KV-Sprecher in Niedersachsen, Detlef Haffke. Wer sich schnelle Hilfe und das komplette Behandlungsprogramm wünsche – sei es verhältnismäßig oder nicht – komme nach wie vor in die Notaufnahme.«
Diese Einschätzung ist nicht von der Hand zu weisen und verweist auf die andere Seite der Medaille, die bislang auch hier noch gar nicht thematisiert wurde – also die Patienten. Rainer Woratschka und Hannes Heine schreiben dazu in ihrem Artikel Krankenkassen und Ärzte warnen vor verstopften Notaufnahmen:
»Viele kämen in die Notaufnahme, weil ihnen gar nicht bekannt sei, dass es auch ärztliche Notdienste gibt. Andere fühlten sich im Krankenhaus besser aufgehoben – wegen schnellerer Diagnosemöglichkeiten und der Vielzahl fachärztlicher Disziplinen. Oft passten die Öffnungszeiten von Notdienstpraxen nicht mit den sprechstundenfreien Zeiten einer Region zusammen. Insbesondere jüngere Patienten hätten immer seltener einen festen Hausarzt. Und Menschen, die noch nicht lang in Deutschland lebten, fehle oft das Wissen über hiesige Versorgungsstrukturen. In den Heimatländern der meisten Flüchtlinge beispielsweise gibt es kein vergleichbares Gesundheitswesen und keine soliden, flächendeckend verteilten Arztpraxen. Wer medizinische Hilfe braucht, geht auch mit Kleinigkeiten in eine Klinik. Viele Patienten … hätten auch die Erwartungshaltung, dass ihnen bei jedem Zipperlein sogleich umfassend und mit ausgewiesener Qualifikation geholfen werden müsse … Und Medizinern zufolge rücken insbesondere in Neukölln, Kreuzberg und Mitte oft ganze Familien in Kliniken an, wenn sich ein Angehöriger krank fühle.«
In dem Beitrag von Woratschka und Heine werden Aspekte angesprochen, die bereits im Februar des vergangenen Jahres in meinem Blog-Beitrag unter dem Stichwort „ambivalenter Wertewandel“ thematisiert wurden:
»So könnte ein Aspekt des Wertewandels darin bestehen, dass die Ansprüche der Patienten deutlich gestiegen sind und sie die aus ihrer subjektiven Sicht optimale Behandlung haben wollen, die sie eher im Krankenhaus vermuten als beim ärztlichen Bereitschaftsdienst der Vertragsärzte, wo möglicherweise ein völlig fachfremder Arzt alle Patienten behandeln (oder dann doch weiterschicken) muss, während man im Krankenhaus die Erwartung haben kann, dass je nach Indikation gleich der „richtige“ Facharzt konsultierbar ist. Insofern würde die Nicht-Inanspruchnahme auch bei grundsätzlich vorhandener Infrastruktur stattfinden.
Die angesprochene Ambivalenz des Wertewandels bezieht sich darauf, dass es – folgt man vielen Berichten aus der Praxis – eine durchaus frag- oder zumindest diskussionswürdige Verschiebung der Inanspruchnahme einer Notfallaufnahmeeinrichtung bei einem Teil der Patienten gegeben hat hin zu einer Nutzung auch bei Beschwerden, die nun sehr weit weg sind von einem Notfall und wo man auch warten könnte auf die normalen Praxisöffnungszeiten. Teilweise kommen die Patienten in die Notfalleinrichtungen, um ansonsten aufzubringende Wartezeiten bei den normalerweise dafür zuständigen Haus- und Fachärzten zu umgehen.«
Und auch damals schon wurde die Forderung nach der flächendeckenden Einrichtung von Notfallpraxen an den Krankenhäusern in den Raum gestellt.
Allerdings – darauf soll hier nur hingewiesen werden – sind es gerade die Krankenkassen, die vehement eine weitere Ausdünnung der Krankenhauslandschaft fordern und zugleich – im Zusammenspiel auch mit den Effekten des auf Fallpauschalen basierenden Krnakenhausvergütungssystems – eine fortschreitende Spezialisierung der einzelnen Kliniken vorantreiben bzw. als Benchmark der weiteren Entwicklung vertreten. Wie das dann mit einer zwangsläufigerweise sehr breit angelegten Notfallversorgung kompatibel sein soll, erschließt sich nicht wirklich.
Was könnte man noch machen? Hannes Heine hat einen weiteren Ansatz so kommentiert: Gebt den Kliniken mehr Geld für die Notaufnahme. Auch er geht von der breit geteilten Diagnose aus: »Das alte System funktioniert nicht mehr. Bisher galt: mit kleinen Beschwerden zum Hausarzt um die Ecke, mit Wunden und Akutem in die Klinik. Nun tummeln sich in den Rettungsstellen nicht nur immer mehr Patienten mit Bagatellen, es kommen auch Flüchtlinge hinzu, die aus ihrer Heimat keine Hausarztpraxen kennen.«
Heine geht davon aus, dass sich an dem Drang in die Notfallaufnahmen der Kliniken nichts ändern wird. »Folglich bleibt nur, die Kliniken auch für Bagatellfälle ausreichend zu bezahlen – und ihre Abläufe mit dem Zusatzgeld zu optimieren. Ein erster Schritt ist die Weiterbildung zum Notfall- und Akutmediziner. Bekommen die Rettungsstellen aber mehr, werden die Krankenkassen den Praxen weniger Geld geben. Deutschlands größter Branche steht ein Verteilungskampf bevor – ihn gilt es auszufechten.« Fazit: Akzeptieren, dass die Musik der Zukunft der Notfallbehandlungen (oder was die Menschen unter Notfällen verstehen) an den Krankenhäusern spielen wird und wenn das so ist, dann muss das Geld eben der Nachfrage folgen und nicht den historisch-gewachsenen Angebotsstrukturen.
Was für ein Durcheinander, wird der eine oder andere sicher denken. Sicher ist auf alle Fälle auch im kommenden Jahr mindestens ein weiterer Beitrag über die „Schnittstelle“ zwischen ambulant und stationär.