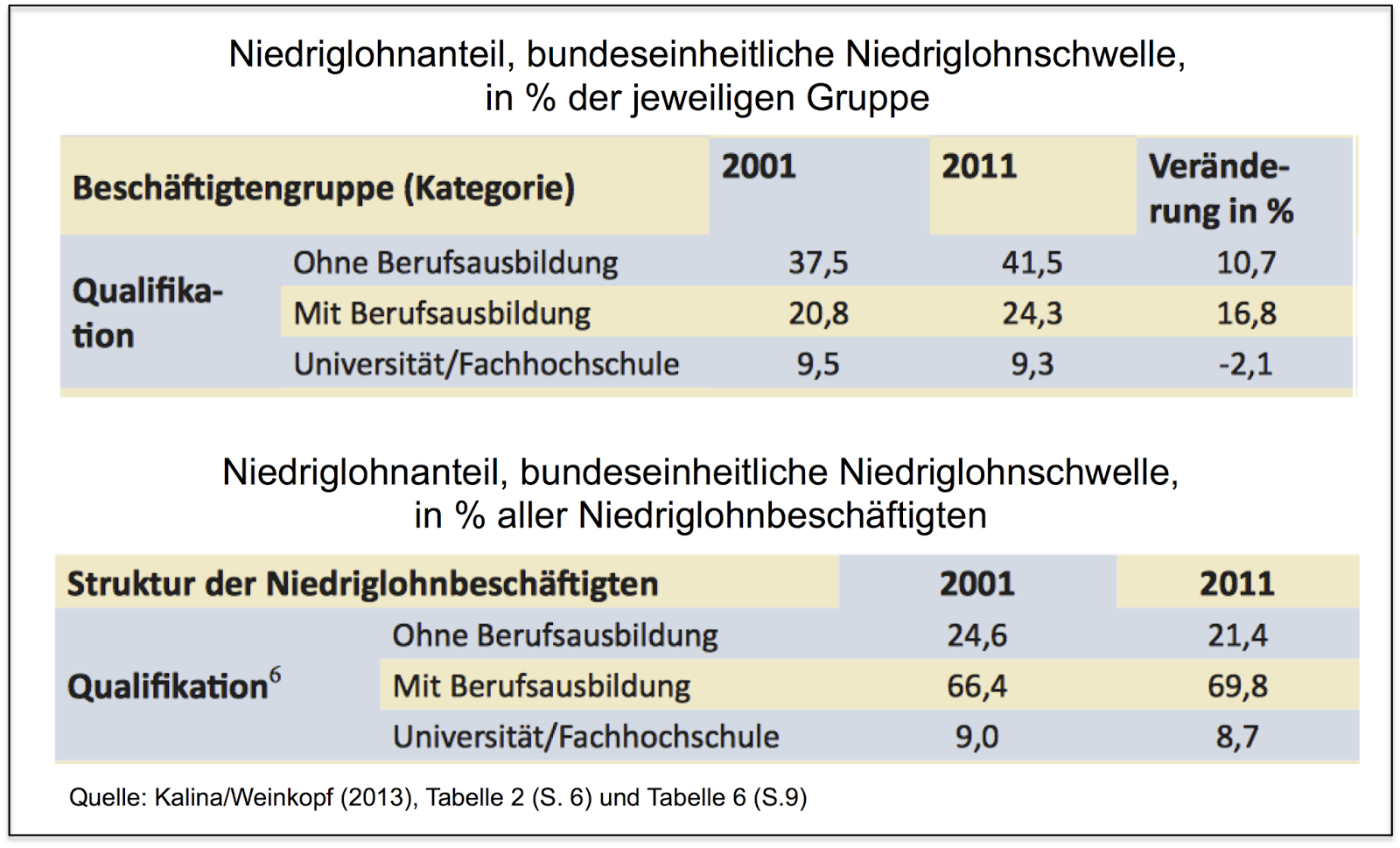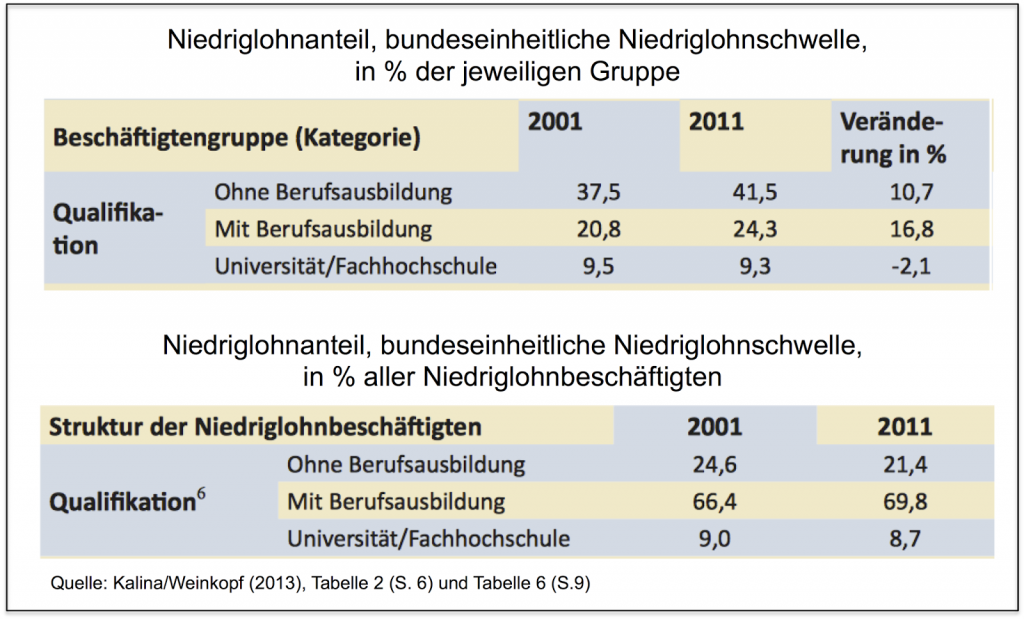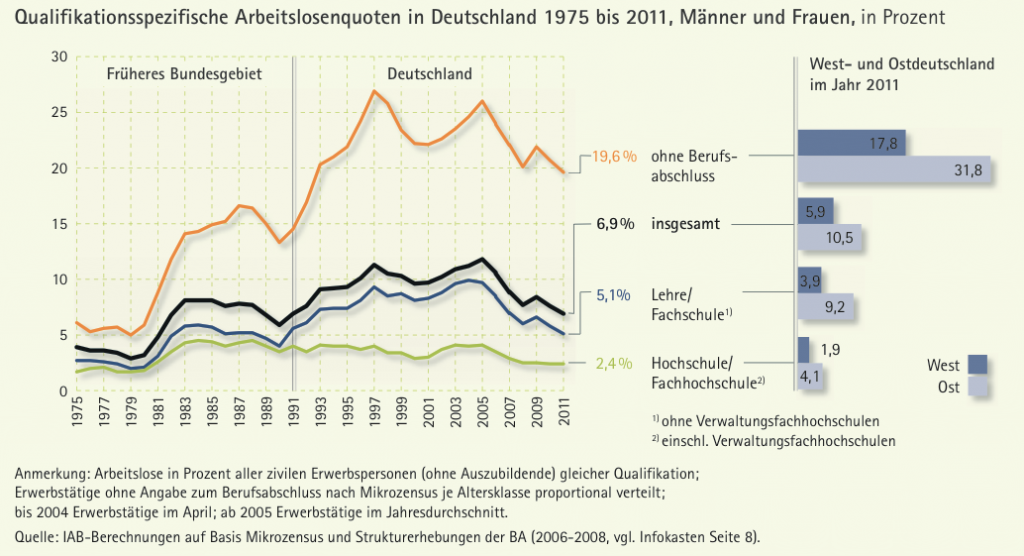|
| Quelle: A. Schmillen und H. Stüber: Bildung lohnt sich ein Leben lang. Lebensverdienste nach Qualifikation (= IAB-Kurzbericht Nr. 1/2014) |
Das ist mal ein klare Ansage: Bildung zahlt sich aus. Personen, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, verdienen über ihr Erwerbsleben hinweg im Schnitt knapp 250.000 Euro mehr als Personen ohne Berufsausbildung und Abitur. Das zeigt eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Für Abitur, Fachhochschul- oder Universitäts-Studium liegen die Bildungsprämien durchschnittlich bei rund 500.000 Euro, 900.000 Euro und 1.250.000 Euro. So stellt man sich ein hierarchisches Entsprechungsverhältnis von Bildungsabschluss und Einkommen vor. Und erneut wird das Auswirkungen haben auf die Entscheidungen der Eltern und der betroffenen Jugendlichen hinsichtlich der eigenen Bildungsbiografie. Ein Abitur sollte es schon sein – und ganz offensichtlich wird man dabei doch mehr als gestützt durch die Befunde der Wissenschaft. Die Daten entstammen einer Studie von Achim Schmillen und Heiko Stüber, die unter dem Titel „Bildung lohnt sich ein Leben lang. Lebensverdienste nach Qualifikation“ veröffentlicht worden ist.
Wenn man sich die Unterschiede zwischen den durchschnittlichen Lebensverdiensten anschaut, die man mit einer Berufsausbildung oder mit einem Hochschulabschluss bekommen kann, dann werden solche Werte mit Sicherheit eine Debatte befeuern, die seit einiger Zeit unter der etwas reißerisch angelegten Überschrift „Akademisierungswahn“ geführt wird. Denn bei den (potenziellen) Adressaten dieser Information, die vor der Frage stehen, welchen Bildungs- und Berufsweg sie selbst oder ihre Kinder einschlagen sollen, ist die Botschaft doch mehr als eindeutig: Ein Abitur und ein Studium sollten es schon sein. Koste es, was es wolle. Zu offensichtlich scheint der Beleg für den Tatbestand „Je (formal) höher, desto (materiell) besser“. Nun lohnt es sich, einmal genauer hinzuschauen und dabei nicht nur die Daten zu hinterfragen, sondern diese (vergangenheitsbezogenen) Werte einzuordnen in eine noch schwierigere Diskussion, also ob alles so bleiben wird, wie es war, oder ob es anders kommen kann, als man heute denkt.
Es soll und kann an dieser Stelle nicht vertiefend um die aktuelle Diskussion in Deutschland gehen, die unter dem Etikett „Akademisierungswahn“ geführt wird. Hierzu ist neben den Wortmeldungen von Julian Nida-Rümelin (dazu das Interview „Wir sollten den Akademisierungswahn stoppen„, erschienen in der FAZ im September 2013) ) eine ganze Reihe an zustimmenden, aber natürlich auch ablehnenden Stellungnahmen erschienen. Es sei hier stellvertretend nur auf die im November 2013 vorgelegte Publikation „Wie viel akademische Bildung brauchen wir zukünftig? Ein Beitrag zur Akademisierungsdebatte“ von Hartmut Hirsch-Kreinsen oder den Sammelband „Die Akademiker-Gesellschaft. Müssen in Zukunft alle studieren?„, herausgegeben von Tanjev Schultz und Hurrelmann hingewiesen, in denen die Debatte gut abgebildet wird.
Hier soll es vor allem um den so selbstverständlich daherkommenden Begriff der „Bildungsprämie“ gehen, denn darauf basiert ja die ganze Argumentationslinie der Studie des IAB. Und die wird so dargestellt, dass es für jeden offensichtlich ist, dass sich ein Studium einfach lohnen muss. Auch umgangssprachlich ist es so, dass man bei dem Wort „Prämie“ an etwas denkt, was „on top“ kommt, oben drauf, zusätzlich. So muss man das auch hier verstehen, denn die Hochschulabsolventen bekommen nach der Studie mehr als 1,2 Mio. Euro über ihr Erwerbsleben hinweg „mehr“ als diejenigen ohne eine Berufsausbildung, also die „ganz unten“. Die sind die Bezugsgröße für alle berechneten „Prämien“ der anderen.
Wie sieht die Datengrundlage aus? Basis ist die sogenannte Stichprobe der Integrierten Arbeitsmarktbiografien (SIAB). Für zwei Prozent aller Personen auf dem deutschen Arbeitsmarkt enthält sie alle Episoden sozialversicherungspflichtiger oder geringfügiger Beschäftigung – bedeutet zugleich auch, dass Selbstständige, Beamte oder Studierende dagegen nicht im Datensatz enthalten sind. Was hat man jetzt gemacht? Für alle in der genannten Stichprobe enthaltenen (Vollzeit-) Beschäftigungsepisoden aus den Jahren 2008, 2009 und 2010 wurden die Durchschnittslöhne nach Bildung und Alter berechnet. Die Summe aller Jahresentgelte vom 19. bis zum 65. Lebensjahr ist dann das Lebensentgelt, wobei aber darauf hinzuweisen ist, dass man die Beträge z.B. der 25jährigen Personen aus den Beträgen ermittelt hat, die in den drei Jahren 2008 bis 2010 bei dieser Altersgruppe jeweils angefallen sind – und man hat dann diese Werte auf die Lebensentgelte der einzelnen Gruppen hochgerechnet. Die Studienautoren sprechen deshalb auch von einer „synthetischen Kohorte“, es handelt sich also nicht um die tatsächlichen Einkommen, sondern um hochgerechnete aus dem kleinen Zeitfenster 2008-2010. Dass das nicht ohne ist, wissen die Verfasser der Studie selbst, schreiben sie doch auf den Seiten 5/6 des IAB-Kurzberichts:
»Einschränkend muss aber betont werden, dass die hier vorgelegten konkreten Zahlen eher als Ergebnis einer Modellrechnung denn als exakte Prognose individueller Entgelte verstanden werden sollten. Unsere Befunde beziehen sich nur auf die betrachtete synthetische Kohorte. Es ist davon auszugehen, dass sich für tatsächliche Geburts- oder Arbeitsmarkteintrittskohorten mehr oder weniger große Abweichungen ergeben.«
Ein Fazit:
- Schon der Blick zurück ist nur eine Annäherung, es handelt sich nicht um die tatsächlich gemessenen Werte bei den Betroffenen, sondern um eine Konstruktion aus den Daten einer Stichprobe und dem Zeitraum 2008-2010.
- Und durchaus bedeutsam ist die Feststellung, dass auch wenn die Annäherung an die Realität in der Vergangenheit trotz aller zwangsläufigen und nicht vermeidbaren Abweichungen gelungen sein sollte: es bleibt die offene Frage, ob man die Niveauunterschiede einfach so in die Zukunft prolongieren kann. Dieser Aspekt soll an einem Beispiel verdeutlicht werden: Möglicherweise sind die deutlich höheren Einkommen der Akademiker im Durchschnitt über alle Studiengänge in der Vergangenheit schlichtweg dadurch bedingt gewesen, dass die in der Vergangenheit vorhandenen Akademiker tatsächlich aufgrund ihrer relativ geringen Zahl ausschließlich gut bezahlte Positionen besetzt haben. Angesichts der Tatsache, dass in den 1980er Jahren, gerade aber auch in den davor liegenden Jahrzehnten lediglich 20-25 % eines Jahrgangs überhaupt die Hochschulreife erworben haben, um auf dieser Basis ein Studium absolvieren zu können, muss man zumindestens in Erwägung ziehen, dass heute, wo beispielsweise in Rheinland-Pfalz 52 % der Schulabgänger über irgendeine Form der Hochschulreife verfügen, die dann auch fast alle über kurz oder lang irgendein Hochschulstudium absolvieren, die Situation aufgrund der völlig veränderten Angebotsrelationen auf dem Arbeitsmarkt eine andere sein muss. Wenn also immer mehr studieren und dadurch bedingt das Angebot an Akademikern kontinuierlich ansteigt, dann muss es nach allen Gesetzen der Ökonomie zu einem Preisverfall kommen, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Nachfrage nicht gleich geblieben ist, sondern aufgrund der Teil-Akademisierung der Beschäftigung in vielen Berufsfeldern eine Ausweitung erfahren hat. Das könnte zu mindestens relativ plausibel bedeuten, dass Akademiker, die in der Vergangenheit aufgrund der Knappheitsrelationen eine relativ hohe Vergütung bekommen haben, nunmehr nicht in der Lage sind bzw. sein werden, in der Zukunft ihre Einkommensposition halten zu können. Das würde im Ergebnis dazu führen, dass die Betroffenen nicht mit den Vergangenheitswerten vergleichbare (dazu noch auf der beschriebenen durchaus schmalen empirischen Basis konstruierten) Lebenseinkommen werden realisieren können.