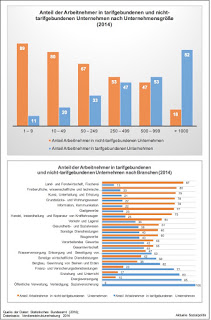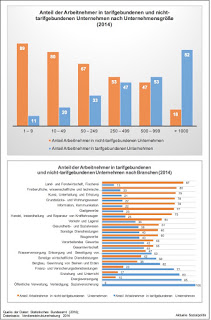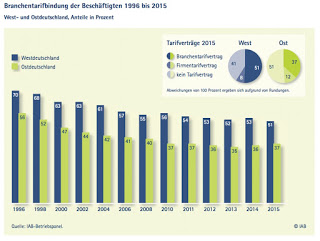Wieder einmal wächst die Sammlung zum Thema Tarifflucht. Beginnen wir mit einem Beispiel aus der Welt der privaten, auf Gewinn gerichteten Gesundheitskonzerne, denen man das irgendwie auch zutraut und werfen wir dann den kritischen Blick in das große Lager der unter der Flagge kirchlicher Trägerschaft segelnden Einrichtungen.
Die Median Kliniken GmbH ist der größte private Betreiber von Reha-Einrichtungen in Deutschland. Das Berliner Unternehmen mit rund 13.000 Beschäftigten und 78 Standorten deutschlandweit soll nun Tarifflucht in richtigem großen Stil praktizieren, so der Vorwurf der Gewerkschaft ver.di: Größter privater Reha-Konzern Median begeht Tarifflucht im großen Stil – Fast alle Tarifverträge gekündigt – Betriebsräte erteilen Verhandlungsabsage.
Der Konzern will keine Tarifverträge mehr für die Beschäftigten abschließen. Seit Dezember 2014 ist das Unternehmen in Besitz des niederländischen Investmentfonds Waterland.
Median hat inzwischen für fast alle Kliniken die Manteltarifverträge gekündigt, die unter anderem Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen regeln. Mit der Begründung, so ein „marktorientiertes Handeln“ zu ermöglichen, will das Unternehmen Entgelte und Arbeitsbedingungen künftig mit Betriebsräten und einzelnen Beschäftigten aushandeln.
Die Gewerkschaft wirft dem Reha-Unternehmen vor, Betriebsräte an den einzelnen Standorten massiv unter Druck zu setzen, um so schnell wie möglich Betriebsvereinbarungen abzuschließen. Die Betriebsräte erteilten dem Ansinnen der Konzernspitze jedoch eine Absage. Für Verhandlungen auf betrieblicher Ebene »stehen wir nicht zur Verfügung«, heißt es in einer von zahlreichen Betriebsräten unterzeichneten Resolution.
„Das ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten, die jeden Tag und rund um die Uhr einen engagierten und wichtigen Job machen“, wird ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler zitiert. Ohne Tarifverträge seien die Beschäftigten der Willkür des Arbeitgebers ausgeliefert.
Die Gewerkschaft hat versucht, auch mit Arbeitsniederlegungen auf die Herausforderung zu reagieren, darüber wurde im Juni berichtet, beispielsweise in diesem Artikel: Streiksaboteur des Tages: Median Kliniken GmbH. So waren Beschäftigte der Rehaklinik Berlin-Kladow zum Streik aufgerufen.
»Streik? Ohne mich!« konterte das Unternehmen in einem Flugblatt … Median wolle »nicht zurück in die kapitalistische Steinzeit«, beteuert der Konzern in dem Propagandafoyer … Nur Tarifverträge soll es nicht mehr geben. Statt dessen will man »faire flexible Lohnmodelle« mit den Betriebsräten und einzelnen Beschäftigten aushandeln.«
Nun hatte die Gewerkschaft ver.di ja darauf hingewiesen, dass die Betriebsräte angekündigt haben, dass sie nicht für Einzelverhandlungen zur Verfügung stehen. Das war wohl auch so, am Anfang, wie das Beispiel der Fontana-Klinik in Bad Liebenwerda zeigt. Über die Situation dort wurde noch am 16. Juni 2016 berichtet: »In einer Resolution beharren Betriebsräte unterschiedlicher Median-Standorte demnach auf Verhandlungen mit der Gewerkschaft. Das bestätigt Gewerkschaftssekretär Ralf Franke für den Standort Bad Liebenwerda. Der dortige Betriebsrat habe diese Resolution ebenfalls unterzeichnet, wolle sich aber dennoch die Vorschläge der Geschäftsführung anhören.«
Das hat mittlerweile stattgefunden und offensichtlich mehr, denn am 27. Juni 2016 meldet der Konzern in einer Mitteilung: MEDIAN Fontana-Klinik: Gemeinsam flexibles Lohnmodell für alle Beschäftigen beschlossen:
»Geschäftsleitung und Betriebsrat der MEDIAN Fontana-Klinik in Bad Liebenwerda haben am Donnerstag einen Durchbruch erzielt und sich … bei gemeinsamen Gesprächen auf höhere Bezüge für die Beschäftigten geeinigt. Damit hat man es an der Klinik trotz heftigem Gegenwind durch die Gewerkschaft ver.di geschafft, hausintern eine schnelle und von beiden Seiten getragene Lösung zu finden. Bereits zum 1. Juli werden sich danach Löhne und Gehälter an der Fontana-Klinik in erster Stufe flexibel und berufsgruppenspezifisch erhöhen. Gleichzeitig wurden die Eckpunkte einer Arbeits- und Sozialordnung definiert.«
Und in einem anderen Artikel wird Dieter Stocker, Geschäftsbereichsleiter Ost bei MEDIAN, mit diesen Worten zitiert: „Wir gehen aber nicht mit der Gießkanne vor, wie bei der klassischen gewerkschaftlichen Tariferhöhung, sondern schauen genau, gemeinsam mit dem Betriebsrat, was in den einzelnen Berufsgruppen möglich ist. Dieses Modell könnte auch für andere Standorte von MEDIAN Schule machen.“
Man erkennt, dass es dem Konzern hier darum geht, die Gewerkschaft rauszudrängen bzw. zu verhindern, dass sie noch irgendwas mitzureden hat hinsichtlich der Arbeitsbeziehungen und man das vor Ort mit den Betroffenen selbst „regeln“ will. Dabei wird man auch am Anfang den Betriebsräten einige Zugeständnisse machen, um sie rüberzuziehen. Offensichtlich ist das an dem Standort bereits gelungen.
Und dass die Gewerkschaft, also ver.di, Schwierigkeiten hat, in den Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens überhaupt Fuß fassen zu können, was ja Voraussetzung ist, um was für die Beschäftigten überhaupt tun zu können, liegt nicht nur in dem niedrigen Organisationsgrad begründet, sondern kann auch mit der Trägerschaft der Einrichtung zu tun haben, also wenn die unter dem Dach konfessioneller Trägerschaft operiert und damit die Sonderregelungen des kirchlichen Arbeitsrechts für sich beanspruchen kann.
Und auch aus diesem Lager gibt es wieder ein Beispiel für Tarifflucht, gleichsam in fortgeschrittenem Stadium, zu berichten. Konkret geht es um das katholische Dominikus Krankenhaus in Berlin, ein konfessionelles Krankenhaus in der Trägerschaft der Dominikus-Krankenhaus Berlin-Hermsdorf GmbH, die wiederum bei der Caritas Mitglied ist.
Und dieses Unternehmen macht auch gerade Schlagzeilen: „Vorne beten, hinten treten“ – ver.di kritisiert Kündigung von über 80 Beschäftigten bei der Dominikus Service GmbH. So hat die Gewerkschaft ver.di Berlin-Brandenburg eine Pressemitteilung überschrieben. Der kann man entnehmen:
»Das katholische Dominikus Krankenhaus (Caritas) in Berlin löst seine Tochterfirma die Dominikus Service GmbH (DSG) auf und entlässt über 80 Beschäftige zum Ende des Jahres. Ein entsprechendes Kündigungsschreiben haben die Beschäftigten der DSG erhalten. In der DSG sind die Bereiche Küche/Cafeteria, Logistik, Reinigung, Hauswirtschaft und Bettenaufbereitung ausgelagert. Die Tätigkeiten sollen zukünftig von der Firma Klüh erbracht werden. Die Geschäftsführung begründet ihre Maßnahme, mit Einsparpotentialen durch die Vergabe an Klüh.«
Nun muss man wissen, dass mit der DSG bereits Tarifflucht begangen wurde, denn jetzt wird in diesem Bereich des Krankenhauses nicht nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Caritas (AVR Caritas) bezahlt, sondern nur nach den branchenüblichen Löhnen. Das war das Ziel der damaligen Ausgliederung. So auch die Überschrift »Caritas hat schon Tarifflucht begangen« zu einem Interview mit Kalle Kunkel, Gewerkschaftssekretär bei ver.di. Offensichtlich gibt es eine gewisse Irritation über die Motive des nun anstehenden Abstoßens der DSG:
»Warum das Management von Dominikus diese Entscheidung getroffen hat, wissen wir nicht. Denn der größte Teil der bei der Servicegesellschaft Beschäftigten arbeitet im Reinigungsbereich. Auch in der Logistik, sowohl im Patienten- wie im Gütertransport, sind einige tätig. Ebenfalls in der Service GmbH angesiedelt sind die Stationsassistenz und die Küche. Für die meisten dieser Bereiche wird das Entgelt durch Mindestlohnregelungen oder allgemeinverbindliche Tarifverträge bestimmt. Im Reinigungsbereich liegt der Mindestlohn bei etwas unter zehn Euro. Das muss auch bei der neuen Firma gezahlt werden.«
Die erste Stufe der Tarifflucht war also die Auslagerung der Beschäftigten in die DSG und deren Abkoppelung von der katholischen AVR-Vergütung. Der zweite Schritt ist nun zum einen die weitere Verschärfung der Situation, indem die langjährigen Beschäftigten vor die Tür gesetzt werden. Denn es handelt sich nicht um einen Betriebsübergang, die betroffenen Arbeitnehmer müssen also nicht weiterbeschäftigt werden. Sie können sich dann bei dem neuen Unternehmen bewerben, aber haben keinen Anspruch auf Übernahme und vor allem nicht zu den alten Konditionen. Und zum anderen – so eine plausible These -, erhofft man sich weitere Einsparungen schlichtweg dadurch, dass der neue Dienstleister mit (noch) weniger Personal versuchen wird, die Bereiche abzudecken.
Anders formuliert: Der Träger entsorgt die bereits ausgelagerten Beschäftigten. Und er wird auf keinen Widerstand stoßen, selbst der Gewerkschaftsfunktionär merkt frustriert an:
Die Beschäftigten sehen für sich keine Perspektive, noch etwas zu erreichen. Deren Stimmung ist nicht so, dass sie sagen: »Morgen gehen wir in den Arbeitskampf.«
Sein Fazit: »Da zeigt sich mal wieder, dass die kirchlichen Unternehmer betriebswirtschaftlich kalkulierende Arbeitgeber wie alle anderen auch sind. Das christliche Aushängeschild, dass sie sich dranhängen, hat wenig Aussagekraft. Zumindest nicht in Bezug auf den Umgang mit den Beschäftigten, insbesondere, wenn es um die unteren Lohngruppen geht.«
Gibt es denn für Arbeitnehmer nicht wenigstens irgendwelche positiv daherkommenden Botschaften? Bei denen sie mal nicht das Nachsehen haben?
Wie wäre es vielleicht mit diesem Fall, der sicher zahlreichen Kommunen einige Schweißperlen auf die Stirn treiben wird: Sozialversicherungspflicht für „selbständigen“ Musikschullehrer, so ist der Bericht über ein Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Nordrhein-Westfalen in Essen überschrieben (Az.: L 8 R 761/14). „Selbstständige“, auf Honorarbasis bezahlte Lehrer an Musikschulen sind bei einer regelmäßigen umfassenden Tätigkeit gar nicht selbstständig. Sind zudem Arbeitsort, Zeit und auch die Lehrpläne vorgegeben, spricht dies für eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, so die Quintessenz.
Zum Sachverhalt, der vielen anderen Kommunen sehr bekannt vorkommen wird:
»Der Musiklehrer war zwischen 2005 bis 2007 noch in der Musikschule angestellt. Aus Kostengründen beschloss 2008 der Rat der Stadt, die Musiklehrer nur noch als Honorarkräfte einzusetzen.
Zwischen 2011 und 2014 war der Gitarrenlehrer daraufhin nur noch eine Honorarkraft. Die Musikschule vereinbarte mit ihm ausdrücklich eine „selbstständige Tätigkeit als freier Mitarbeiter“.
Doch so „selbstständig“ war der Musiklehrer gar nicht, urteilte das LSG. Er war vielmehr mit seinem Unterricht an das Lehrplanwerk des Verbandes deutscher Musikschulen vertraglich gebunden. Weder hinsichtlich Arbeitszeit noch Arbeitsort oder gar bei der Auswahl der Schüler sei er frei gewesen. Auch habe er kein Unternehmerrisiko getragen, dem gleichwertige unternehmerische Chancen gegenübergestanden hätten.«
Diese Entscheidung des LSG NRW wird so einige Kommunen ins Grübeln bringen (müssen). Denn wie schreibt das LSG NRW in seiner Pressemitteilung zu dieser Entscheidung: »Der Senat hat die hergebrachten Rechtsgrundsätze zur Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäftigung und selbständiger Tätigkeit angewendet und deshalb die Revision nicht zugelassen. Das Urteil hat dennoch grundsätzliche Bedeutung für den Status von Lehrern an Musikschulen.«