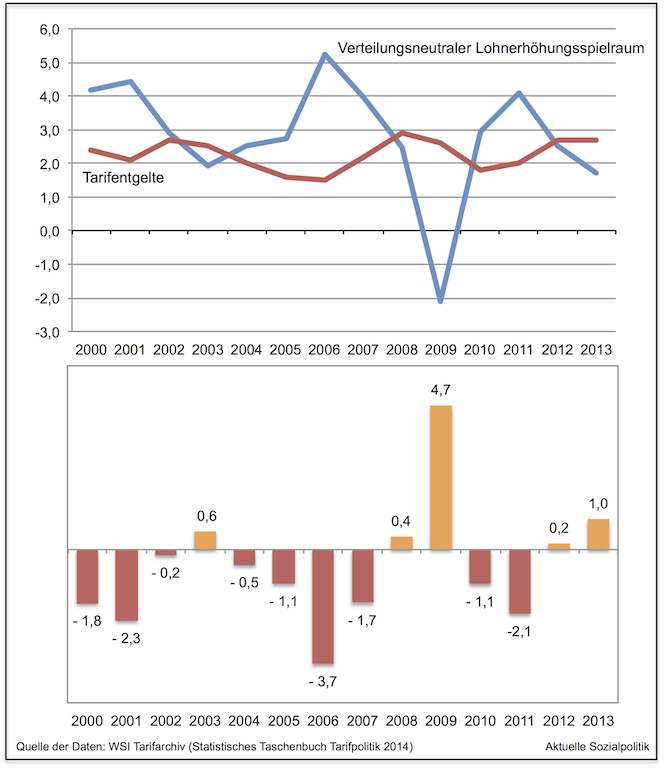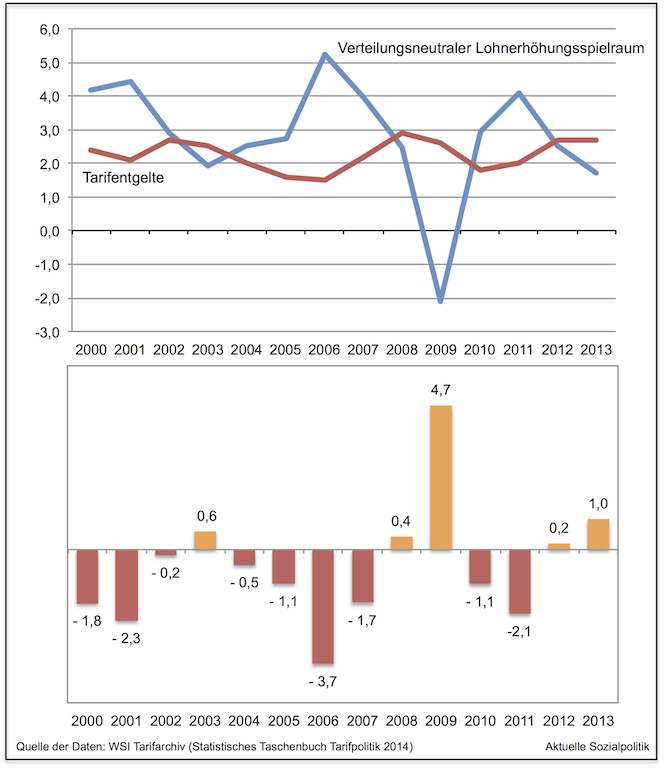Das ist mal eine tarifpolitische Nachricht: Ver.di fordert im Schnitt zehn Prozent mehr Geld für Erzieher: Die Gewerkschaft »will die Berufe von Erziehern und Sozialarbeitern deutlich aufwerten, indem sie tariflich höher eingestuft und deutlich besser bezahlt werden. Die Verhandlungen dürften schwierig werden.« Das kann man wohl plausibel annehmen. Die üppig daherkommende Steigerung von 10% soll nicht in einer allgemeinen Lohnrunde über eine Anhebung der bestehenden Vergütungen erreicht werden, sondern es geht um eine Aufwertung der Sozial- und Erziehungsdienste, in dem die Beschäftigten in eine höhere Tarifgruppe eingruppiert werden sollen. »Ver.di hat die Eingruppierungsregeln zum Ende dieses Jahres gekündigt. Die Tarifkommission soll die Forderungen am 18. Dezember beschließen.« Dann sollen Verhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) aufgenommen werden. Es geht unter anderem um Kinderpflegerinnen, Erzieherinnen, Heilpädagogen und Sozialarbeiter in kommunalen Kindertagesstätten und Sozialeinrichtungen. 2009 hatte es während der Tarifverhandlungen wochenlang Streikaktionen von ver.di und der Gewerkschaft GEW gegeben und auch jetzt wird sofort wieder ein Streikszenario in den Medien diskutiert (eine »Vorstellung, die bei berufstätigen Eltern große Unruhe auslöst«, wie Spiegel Online anzumerken meint). Ein solches Szenario würde aber – wenn überhaupt – erst im Frühjahr des kommenden Jahres relevant werden. Aus Sicht der Arbeitgeber übrigens gibt es hier gar keinen Verhandlungs- oder gar Änderungsbedarf: So wird Katja Christ, die Pressesprecherin des Arbeitgeberverbandes VKA, von Johannes Supe mit den Worten zitiert, dass der Verband »gar keine Notwendigkeit sieht, neu zu verhandeln«. Die Frauen im Sozial- und Bildungsbereich seien bereits »angemessen bezahlt«. Das ist mal eine Ansage, die schon beim ersten Hinschauen auf die Realität in diesem Feld mehr als wagemutig daherkommt.
Die Gewerkschaft ver.di hat ihre Mitteilung über das, was sie zu fordern gedenkt, unter die Überschrift „Mehr Wertschätzung für die Beschäftigten“ gestellt. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an guten Argumenten, die Fachkräfte in den Einrichtungen – an dieser Stelle sollen die Kindertageseinrichtungen in den Blick genommen werden – besser zu vergüten. Dies nicht nur grundsätzlich, sondern selbst aus einer rein betriebswirtschaftlichen Sicht spricht viel für eine andere Eingruppierung, denn die Kita-Landschaft hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert:
Die Kindertageseinrichtungen standen nicht nur in den vergangenen Jahren im Zentrum eines gewaltigen quantitativen Ausbaus, was die Betreuungsangebote angeht, sondern zugleich sind die bildungspolitischen Erwartungen an die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas erheblich nach oben geschraubt worden – sowohl von Seiten der Politik wie auch von einem immer größer werdenden Teil der Eltern. Hinzu kommt, dass die Öffnungszeiten der Einrichtungen in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich ausgeweitet worden sind, mit der Folge, dass sich die Öffnungszeiten der Kitas von den Betreuungszeiten der einzelnen Kinder immer stärker entkoppelt haben. Dies muss vor dem Hintergrund gesehen werden, das gleichzeitig der Anteil der Teilzeitbeschäftigten unter den pädagogischen Fachkräften deutlich angestiegen ist, was zu einer erhöhten Fluktuation während eines Arbeitstages beiträgt. Zugleich – man denke hier an die Einführung des Rechtsanspruchs ab dem vollendeten ersten Lebensjahr – sind die Kinder immer jünger geworden, die heute in die Kindertageseinrichtungen kommen und zugleich bleiben sie tendenziell immer länger. Und natürlich kann man auch nicht leugnen, dass es viele Kinder gibt, die aus „schwierigen“ Familienverhältnissen kommen und die einer besonderen Sorge bedürfen, zugleich aber auch die Fachkräfte teilweise vor erhebliche Herausforderungen stellen, wenn man beispielsweise an die zunehmende Zahl von Kindern aus anderen Nationen, mit anderen kulturellen und religiösen Hintergründen denkt, die mittlerweile in den Kindertageseinrichtungen angekommen sind. Parallel zu diesen Veränderungen hat es eine enorme inhaltliche Aufwertung des frühpädagogischen Handelns gegeben, was sich weniger in der Tatsache manifestiert, dass es seit einigen Jahren an Hochschulen in Deutschland auch entsprechende Studiengänge der Kindheitspädagogik gibt, sondern das Wissen und die Forschungslage sind in den vergangenen Jahren deutlich erweitert worden und das soll alles aufgenommen und reflektiert werden von den pädagogischen Fachkräften. Man könnte die Aufzählung durchaus noch erheblich erweitern, aber die bislang skizzierten Entwicklungslinien sollten reichen, um eine entsprechende Aufwertungsforderung substantiell zu unterfüttern.
Aus einer fachpolitischen Sicht besteht überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass eine bessere Vergütung in diesem so wichtigen Bereich gut begründet und wünschenswert ist.
Allerdings muss man eben auch die restriktiven Rahmenbedingungen sehen und zur Kenntnis nehmen, die das Handlungsfeld bestimmen. Ein besonderes Problem ist die spezifische Finanzierungsstruktur, in die die Kindertageseinrichtungen eingebettet sind. Kurz gesagt: Die Finanzierung ist dergestalt deformiert, dass die Kommunen die Hauptlast der Kosten zu tragen haben, während hingegen die Bundesländer und vor allem der Bund sowie die auf der Ebene des Bundes angesiedelten Sozialversicherungen am meisten von der Kindertagesbetreuung profitieren in Form höherer Steuern und Beitragseinnahmen. Die Kommunen wiederum – als letztes Glied in der Verwertungskette – stehen vor dem Problem, dass sie in den vergangenen Jahren einen vom Bundesgesetzgeber eingeführten Rechtsanspruch auf (irgendeinen) Betreuungsplatz umsetzen mussten, gleichzeitig aber haushaltsmäßig oftmals in einer desaströsen Verfassung sind. An die Kommunen aber richtet sich nunmehr die Forderung von ver.di. Angesichts der haushaltspolitischen Lage, in der sich viele Kommunen befinden, erscheint die Durchsetzung eines Steigerungsbetrags von 10 % völlig unrealistisch.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht unrealistisch, wenn man davon ausgeht, dass die Gewerkschaft im kommenden Frühjahr zum Mittel des Arbeitskampfes greifen muss. Hierbei sollte allerdings berücksichtigt werden – und die Erfahrungen, die während der Streikaktionen im Jahr 2009 gesammelt wurden, belegen das eindrücklich –, dass die Erzieherinnen (zu über 95 % haben wir es in den Kindertageseinrichtungen mit Frauen zu tun) keinesfalls hinsichtlich einer notwendigen Streikbereitschaft die Rolle übernehmen können, die früher im öffentlichen Dienst die Müllwerker oder die Busfahrer gehabt haben, bevor sie in vielen Städten privatisiert worden sind. Zumindestens 2009 haben sich sehr viele Erzieherinnen sehr schwer damit getan, ihre Einrichtung länger als einen oder zwei Tage zu bestreiken, denn viele zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl gegenüber den Kindern und deren Eltern aus, so dass ihnen ein Arbeitskampf schon grundsätzlich nicht leicht fällt. Und während am Anfang eines Arbeitskampfes und vor allem bei einer Begrenzung auf kurze Zeiten noch davon auszugehen ist, dass es eine große bzw. zumindestens spürbare Sympathie auf Seiten der betroffenen Eltern und in der allgemeinen Öffentlichkeit geben wird, muss und wird sich das ändern, je länger gestreikt wird bzw. werden muss. Anders ausgedrückt: Wir können bei den Erzieherinnen eben nicht davon ausgehen, dass wir es mit streikerprobten oder gar streikfreudigen Personen zu tun haben. Nun hat sich allerdings die Situation seit 2009 verhindert. Der Organisationsgrad der Erzieherinnen in den Gewerkschaften Verdi und GEW hat sich nach oben entwickelt und seit dem quantitativen Ausbau vor allem der Kleinkindbetreuung wird zunehmend von einer aggressiveren Stimmung unter vielen Fachkräften berichtet, was die konkreten Arbeitsbedingungen angeht. Insofern könnte man annehmen, dass die Bereitschaft, sich nunmehr wenn es nicht anders geht auch mit Arbeitskampfmaßnahmen zu wehren, in den vergangenen Jahren angestiegen ist.
Dabei muss aber eine weitere Besonderheit des Feldes berücksichtigt werden: Von den mehr als 52.000 Kindertageseinrichtung, die es derzeit in Deutschland gibt, befinden sich nur ein Drittel in kommunaler Trägerschaft, zwei Drittel der Einrichtung werden von freien Trägern betrieben. Genau so sieht es aus bei den Beschäftigten, denn von den insgesamt 472.000 pädagogisch tätigen Fachkräften arbeiten 33,5 % bei einem öffentlichen Träger, der Rest entfällt auf die freien Träger. Unter diesen stellen Einrichtungen in evangelischer oder katholischer Trägerschaft die größte Gruppe dar, allein hier arbeiten mit über 163.000 pädagogischen Fachkräften mehr Menschen als in allen kommunalen Kindertageseinrichtungen zusammen. Hier nun aber besteht die Besonderheit darin, dass in diesen Einrichtungen aufgrund der tradierten Sonderrechte der Kirchen im Arbeitsrecht schlichtweg gar nicht gestreikt werden darf, auch wenn die Betroffenen das wollten. Die einzigen, die also bei einem Arbeitskampf spürbar und überhaupt tätig werden können, sind die Erzieherinnen in den kommunalen Kindertageseinrichtungen. Wenn man sehenden Auges in diese Richtung marschieren will, dann sollte man die Leute gut vorbereiten, ganz besonders gut, sonst endet das in einem Desaster.
Auch wenn es den Betroffenen absolut zu wünschen wäre, eine deutliche Verbesserung ihrer Vergütungssituation zu erfahren – die 10% sind „eine steile Forderung“, so zitiert die Gewerkschaft ver.di selbst eine Betroffene. Die Forderung kommt in die Nähe dessen, was in den 1970er Jahren sogar am Ende eines Arbeitskampfes erreicht worden ist: Anfang 1974 streikt der öffentliche Dienst und der damalige ÖTV-Chef Heinz Kluncker erzwang eine Lohnerhöhung von elf Prozent. An dieser Stelle könnte man skeptisch fragen, warum man sich auf eine so hoch daherkommende Forderung verständigt hat – was, wenn da deutlich weniger bei raus kommt? Die Gefahr von teilweise massiven Enttäuschungen am Ende eines solchen Prozesses auf Seiten der Erzieher/innen sollte nicht unterschätzt werden.
Man darf gespannt sein, wie sich diese Runde entwickeln wird. Eine mutige Forderung, die Zeichen setzt. Verdient hätten es die betroffenen Fachkräfte auf alle Fälle, aber zwischen Wunsch und Wirklichkeit gibt es ja oft eine zuweilen sehr große Diskrepanz. Und auch auf die muss man vorbereitet sein. Gerade in diesem Bereich.
Foto: © Stefan Sell