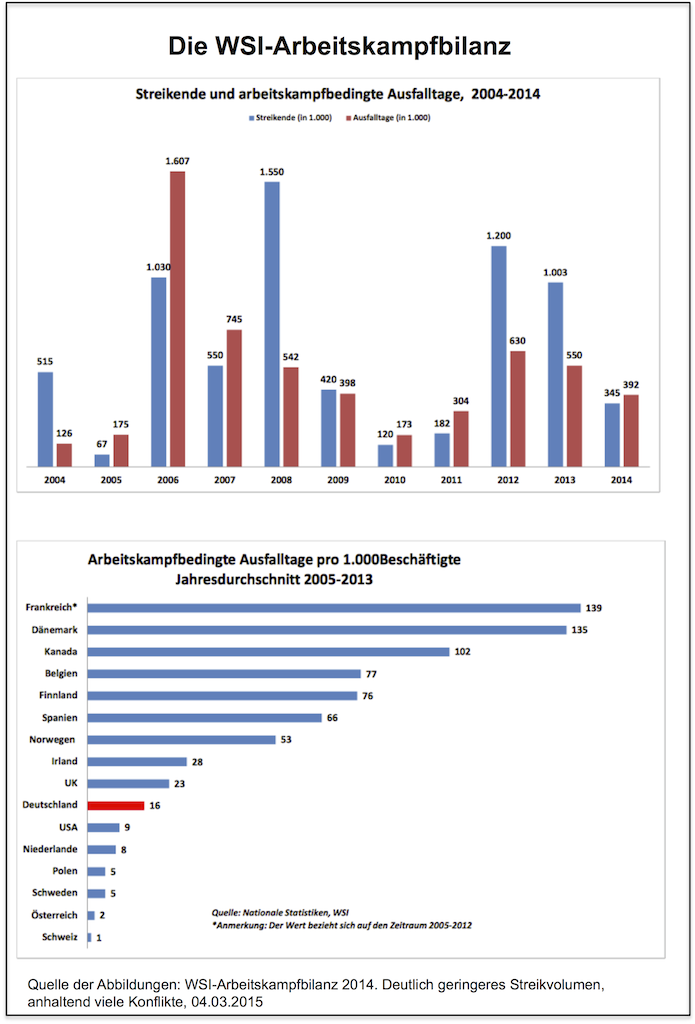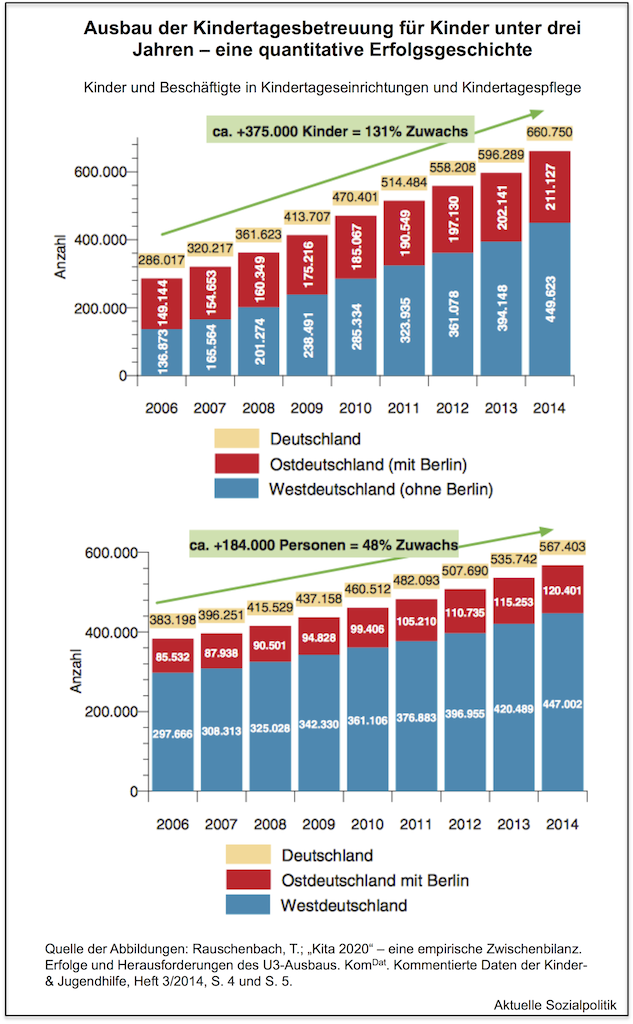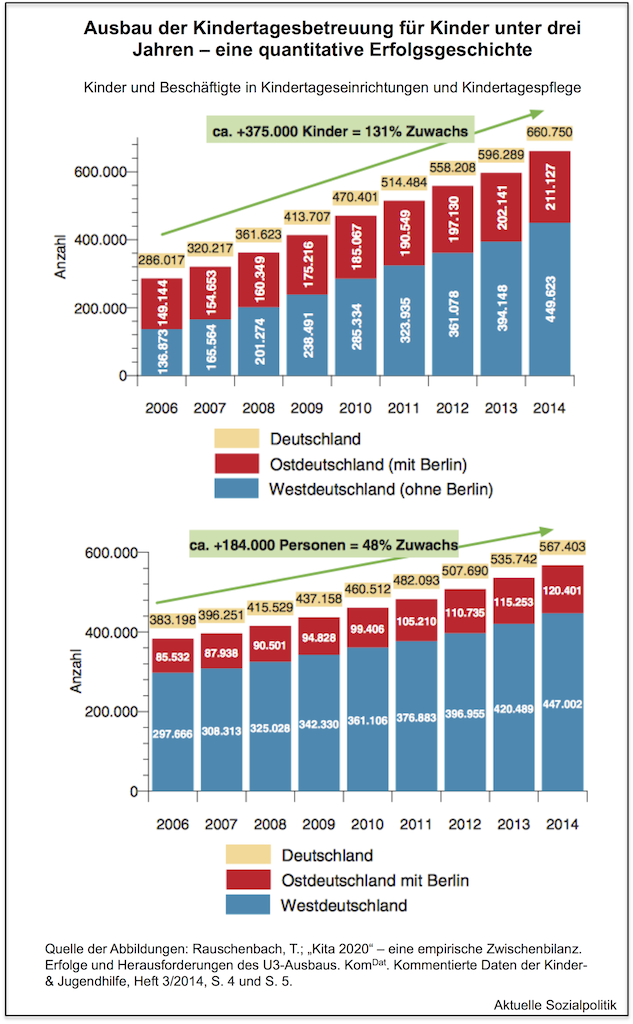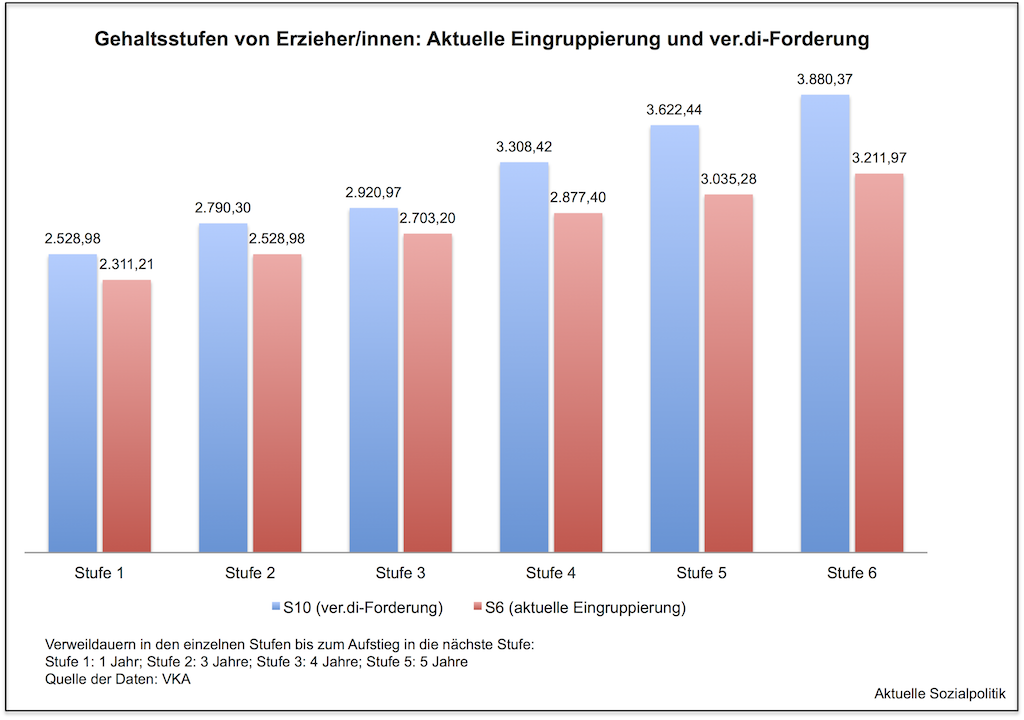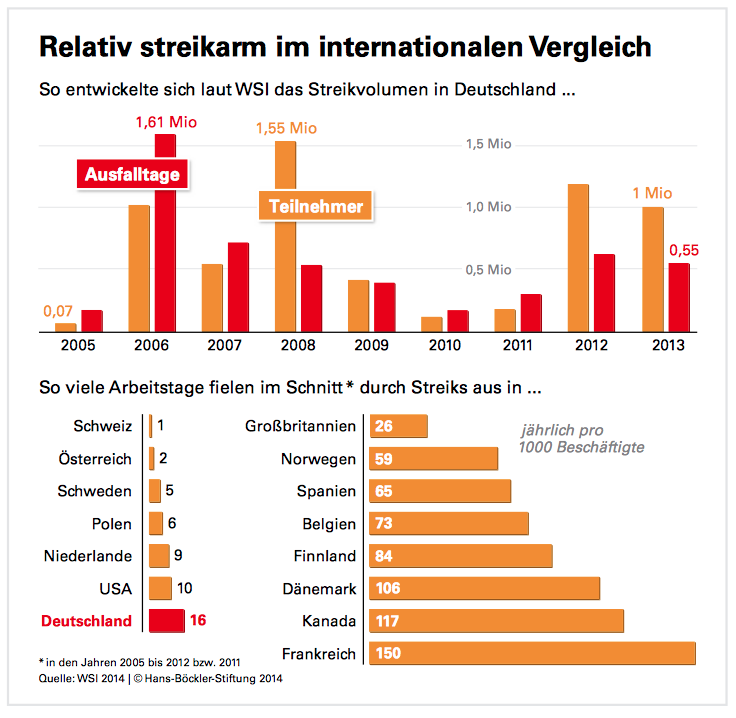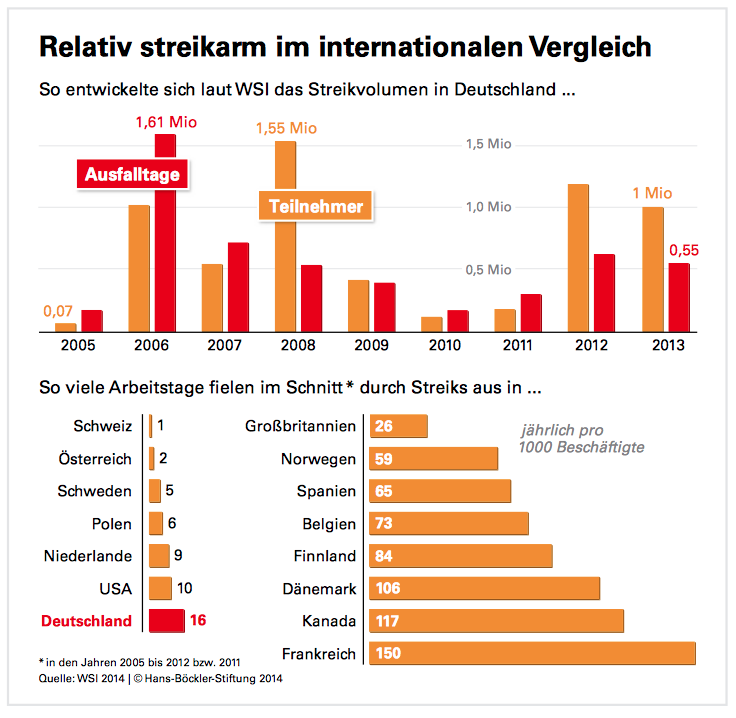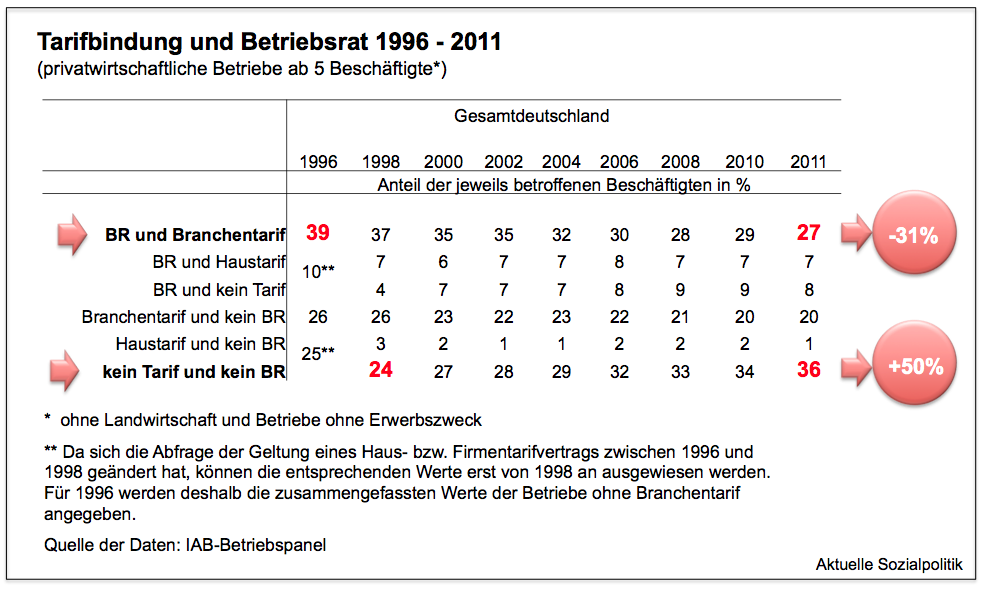Seit dem 15. Dezember hat die Gewerkschaft Verdi Versandzentren von Amazon bestreikt – bis zum Heiligabend. Damit geht die bisher längste Arbeitsniederlegung im aktuellen Tarifstreit zu Ende. »Pro Tag hätten zeitweise bis zu 2.700 Beschäftigte ihre Arbeit in den Versandzentren niedergelegt, teilte die Gewerkschaft … mit. Zuletzt seien die Standorte Graben, Bad Hersfeld, Rheinberg und Leipzig von rund 2.000 Mitarbeitern bestreikt worden«, kann man der Meldung Streik bei Amazon vorerst beendet entnehmen. »Der Arbeitskampf schwelt bereits seit Ostern 2013. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiter in den deutschen Amazon-Versandzentren tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel- und Versandhandel üblich sind. Der US-Konzern dagegen nimmt die Vereinbarungen der Logistikbranche als Maßstab, in der weniger bezahlt wird.« Die Gewerkschaft will, dass Amazon nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels agieren soll, während das Unternehmen sich selbst im Bereich der Logistik sieht. Also in Deutschland. Eben nicht grundsätzlich, darauf weisen David Jamieson und Tobias Fuelbeck in ihrem Beitrag Amazon nutzt Wortspielchen, um die Gehälter zur drücken hin. Sie verweisen auf die USA: »Dort vergleicht sich Amazon nämlich gar nicht gerne mit den Löhnen im Logistik-Sektor. Hier bezieht sich das Unternehmen nämlich auf … den Einzelhandel.« Sie zitieren das Unternehmen Amazon selbst, das 2013 veröffentlicht hat: „Die mittlere Bezahlung in Amazon-Vertriebszentren ist 30 Prozent höher als bei Angestellten in traditionellen Einzelhandelsgeschäften“. Also sind die Mitarbeiter bei Amazon im nicht-traditionellen Einzelhandel, was man aber ihren Kollegen in Deutschland partout verwehren will. Gibt es eine Aufklärung dieses – scheinbaren – Widerspruchs? Aber natürlich und die muss was mit den Löhnen – aus Sicht des Unternehmens: den Kosten – zu tun haben.
David Jamieson und Tobias Fuelbeck klären uns auf:
»Falls Sie sich jetzt fragen, warum Amazon in den USA seine Mitarbeiter als nicht-traditionelle Einzelhandelsmitarbeiter ansieht, kann Ihnen das Statistikamt des amerikanischen Arbeitsministeriums helfen. Der durchschnittliche Einzelhandelsverkäufer in den USA verdient 9,81 Dollar, während der Logistikmitarbeiter 14,25 Dollar verdient.«
Der aufmerksame Leser wird sofort gerechnet haben: Mit knapp über 12 Dollar verdienen die Amazon-Mitarbeiter also deutlich weniger als der durchschnittliche Logistik-Arbeitnehmer. In Deutschland ist es genau anders herum. Die beiden schlussfolgern also:
»Amazon ist also ein Einzelhändler, der manchmal die Löhne gerne mit dem Handel vergleicht. Amazon ist aber auch ein Logistikunternehmen, das seine Löhne gerne mit denen der Logistikbranche vergleicht.«
Oder ist es nicht vielmehr umgekehrt? Also da kann man schon mal durcheinander kommen und das erklärt vielleicht auch ein wenig, warum sich die Gewerkschaft Verdi offensichtlich die Zähne ausbeißt an diesem Unternehmen. Denn richtig handfeste Ergebnisse kann man noch nicht vorweisen. Was aber tatsächlich an mehreren Gründen liegt, nicht nur an der Tatsache, dass es zahlreiche befristet Beschäftigte bei Amazon gibt, von denen viele wieder ausgespuckt werden, von denen gleichzeitig aber eben auch viele hoffen, dass sie zu den wenigen gehören könnten, für die es weitergehen wird. Da überlegt man sich Streikaktionen mehr als einmal.
Ein ganz zentraler Grund, warum Amazon den harten Hund spielen kann in Deutschland ist natürlich die Tatsache, dass man Alternativen hat zu den aufsässigen deutschen Standorten. Jörg Winterbauer zeigt das in seinem Artikel Warum Polen ein Paradies für Amazon ist: Die Gelassenheit des Online-Händlers angesichts der Arbeitskampfaktionen erklärt sich seiner Meinung nach aus der Tatsache, dass er ja drei Logistikzentren in Polen hat. Dort arbeiten die Mitarbeiter für ein Viertel des deutschen Lohns.
Bereits am 25.11.2013 wurde in diesem Blog im Beitrag Von „Work hard. Have fun. Make history“ bei Amazon zur Proletarisierung der Büroarbeit in geistigen Legebatterien. Streifzüge durch die „moderne“ Arbeitswelt gleich am Anfang formuliert: »Eines ist ganz sicher – die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di nervt Amazon mit ihrer impertinenten Forderung nach einem Tarifvertrag für die Beschäftigten in den deutschen Warenverteilzentren des Weltkonzerns. Deshalb lässt Amazon ja auch schon mal sicherheitshalber neue Logistik-Zentren in der Tschechei und Polen errichten – „natürlich“ auf gar keinen Fall mit der Absicht, die Arbeit dann aus dem für Arbeitgeber „anstrengenden“ Deutschland in die angenehmer daherkommenden Ostländer zu verlagern und die Standorte in Deutschland auszudünnen oder gar aufzugeben. Was natürlich nicht für die Belieferung des deutschen Marktes gilt, denn der ist richtig wichtig für Amazon, hier wird Marge gemacht und dass soll auch so bleiben – bereits 2012 hat Amazon in Deutschland 6,4 Milliarden Euro umgesetzt und damit seit 2010 um 60 Prozent zugelegt. Und geliefert werden kann auch aus Polen und der Tschechei.«
Jetzt können bzw. müssen wir die ersten Früchte dieser Strategie zur Kenntnis nehmen. Zurück zu dem Artikel von Jörg Winterbauer aus dem Dezember des Jahres 2014:
»Vor dem Amazon-Lager in Posen sitzen zwei junge Männer und rauchen eine Zigarette in einem eigens dafür vorgesehenen Zelt. Sie sehen müde aus. Die Uhr an der Zeltwand zeigt halb fünf. Normalerweise hätten sie schon seit einer halben Stunde Feierabend, aber sehr viele Deutsche, Österreicher und Schweizer warten noch auf ihre Weihnachtsgeschenke. Deshalb müssen die beiden heute länger arbeiten. Zwölf statt normalerweise zehn Stunden.«
Seit September werden aus zwei Zentren in der Nähe von Breslau sowie aus einem in Posen Waren an deutsche Kunden verschickt. Ein geschickter Schachzug von Amazon, denn dadurch kann die Firma Verzögerungen durch Streiks vorbeugen und ist dadurch weniger angreifbar für die Gewerkschaften. Außerdem arbeiten die Menschen in Polen für ein Viertel des Lohns, den Amazon in Deutschland bezahlen muss, so Winterbauer.
»Bei einem Stundenlohn von umgerechnet drei Euro und einer 40-Stunden-Woche kommt ein einfacher Arbeiter auf rund 500 Euro brutto, netto bleiben weniger als 400 Euro pro Monat. Doch damit zahlt Amazon noch mehr als den polnischen Mindestlohn, der bei etwa 420 Euro liegt. Außerdem bietet der Konzern seinen Mitarbeitern eine warme Mahlzeit für 25 Cent an, holt sie kostenlos von zu Hause ab und fährt sie nach der Arbeit auch wieder zurück.«
An dieser Stelle sollten zwei Dinge klar werden. Erstens: Gegen das Lohnniveau im benachbarten Polen oder Tschechien haben die deutschen Arbeitnehmer keine echte Chance. Und zweitens: Eine Verlagerung in die Niedriglohnländer funktioniert letztendlich nur, weil es den meisten Kunden egal ist. Würden viele Kunden, mal rein hypothetisch gedacht, dem Unternehmen signalisieren, entweder Belieferung von deutschen Standorten oder gar keine Bestellung, würde sich schneller was ändern als durch jeden Druckversuch von Verdi. Das tun aber die meisten Kunden (noch) nicht. Und deshalb hat eben auch die Gewerkschaft – neben dem Organisationsgrad – ein echtes Problem und das Unternehmen (noch) eine echte Alternative.
Kommen wir zum zweiten Unternehmensbeispiel: Die Deutsche Post. Lohndrücker-Vorwürfe gegen die Post, so ist beispielsweise ein Artikel überschrieben. Betriebsräte und Gewerkschaftsvertreter werfen dem Konzern Lohndrückerei, Erpressung und eine Spaltung der Belegschaft vor. Worum geht es genau?
»Es geht um die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft. „Ziel dieser neuen Firma ist es, dort künftig alle befristeten Mitarbeiter unterzubringen“, heißt es … in einer Betriebsratsinfo: „Das könnte dann mit neuen Arbeitsverträgen, mit verschlechterten Löhnen und Arbeitsbedingungen geschehen.“
Der Betriebsrat drohte Widerstand und Streiks an. „Mit der Gründung der DHL Delivery GmbH schafft die Deutsche Post bereits im Vorfeld der Tarifrunde Fakten und erhöht damit den Druck auf die Gewerkschaften“, sagte Volker Geyer, der Vorsitzende der Kommunikationsgewerkschaft DPV. Die Post beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit 14.700 Arbeitskräfte mit zeitlich befristeten Verträgen. Das ist knapp ein Zehntel der Gesamtbelegschaft in der Brief- und Paketsparte.«
Die Deutsche Post verweist dagegen immer wieder auf den hohen Lohnabstand zu ihren Wettbewerbern: Sie zahle doppelt so viel wie andere Brief- und Paketdienste, so das Unternehmen. Das ist nicht falsch, tatsächlich zahlen die Konkurrenten der Post deutlich schlechter und haben dadurch enorme Kostenvorteile. Wenn jetzt also die Gewerkschaften zu Arbeitskampfaktionen aufrufen bei der Post, dann haben sie auf der einen Seite völliges Verständnis verdient, denn offensichtlich soll innerhalb des Unternehmens eine Lohndumping-Strategie gefahren werden (zu den Arbeitsbedingungen am Beispiel der Postboten vgl. beispielsweise den Artikel Kochenjob Postbote). Zugleich muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass die Post zugleich mit Konkurrenten konfrontiert ist, die günstiger sein können, weil deren Arbeitskostenbelastung niedriger ist.
Und schon sind wir beim dritten Unternehmensfallbeispiel: Daimler, einem Unternehmen, dass gerade in diesen Tagen wieder eine Erfolgsmeldung nach der anderen absetzt. Bereits Ende Oktober berichtete Daniel Behruzi in dem Artikel Verlagerung und Outsourcing:
»Die Folgen der Renditesteigerung bekommen die Beschäftigten in der Produktion, aber auch die Angestellten in der Entwicklung und Verwaltung zu spüren. Permanente Rationalisierung, Arbeitsverdichtung und eine weitgehende Flexibilisierung der Arbeits- und Betriebszeiten sind Alltag. Zugleich steht die Zukunft einiger Standorte zur Disposition, da Daimler die Produktion »in die Märkte«, also nach China, Indien und in die USA, bringen will.
So droht im Düsseldorfer Werk wegen der soeben beschlossenen Verlagerung von Teilen der »Sprinter«-Produktion in die USA ein drastischer Jobabbau.«
Und in diesen Dezember-Tagen berichtet die Presse: »Nach Arbeitsniederlegung gegen Fremdvergabe im Bremer Pkw-Werk werden Beteiligte zu Personalgesprächen beordert. In Düsseldorf wird jeder zehnte Job gestrichen«, so Daniel Behruzi in seinem Artikel Druck bei Daimler. Die Belegschaft im Bremer-Werk des Daimler-Konzerns »wehrt sich seit Monaten gegen die geplante Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen. Nachdem Beschäftigte der Nachtschicht Ende vergangener Woche erneut die Arbeit niederlegten, macht das Management nun mit Personalgesprächen Druck.« Was bringt die Beschäftigten in dem Bremer Daimler-Werk so auf? Das Unternehmen hält sich bedeckt, klar scheint nur zu sein, »dass die Fertigungstiefe in der Fabrik weiter reduziert werden soll. Sprich: Tätigkeiten, die zuvor von Daimler-Beschäftigten erledigt wurden, werden an Zulieferer oder externe Dienstleister vergeben.«
Zugleich wirft das Beispiel der Vorgänge im Bremer Daimler-Werk das Licht auf eine weitere Problemstelle vieler Betriebe, namentlich der Möglichkeit, leistungsgeminderte Mitarbeiter an anderen als den bisherigen Arbeitsplätzen zu beschäftigen. Dazu Behruzi seinem Artikel:
Die von Outsourcing betroffenen Logistiker lassen sich … nicht durch die Zusicherung beruhigen, ihnen werde ein anderer Arbeitsplatz angeboten. Denn zum einen waren viele von ihnen vor zwei Jahren noch in der Presswerk-Logistik beschäftigt und nach deren Fremdvergabe auf ihren heutigen Arbeitsplatz versetzt worden. Zum anderen handelt es sich vielfach um sogenannte Einsatzeingeschränkte – Arbeiter, deren Gesundheit die anstrengende Fließfertigung nicht mehr mitmacht. Sie fürchten, dass es wegen der fortgesetzten Auslagerung bald keine adäquaten Stellen bei Daimler Bremen mehr für sie gibt.
»Unter den Kollegen in der Logistik sind viele, die durch die harte Arbeit am Band verschlissen wurden«, erläuterte Betriebsrat Herbert Mogck … »Es gibt gar nicht mehr so viele sogenannte Schonarbeitsplätze, so dass die Betroffenen wohl zwangsläufig am Band landen.«
Was nun sind die Gemeinsamkeiten an allen drei Unternehmensfallbeispielen? Auf der einen Seite handelt es sich bei allen drei Unternehmen nicht um Unternehmen, die ihre Beschäftigten am unteren Ende bezahlen. Das gilt selbst für Amazon. Aber sowohl der Online-Händler wie auch Daimler können dem Widerstand ihrer Arbeitnehmer die Androhung bzw. die tatsächliche Realisierung von Abwanderung oder Verlagerung an billigere Dritte entgegensetzen. Die Stammbelegschaft bei Daimler hat hierzu bereits unterschiedliche Erfahrungen sammeln müssen: So beispielsweise durch den zunehmenden Einsatz von Werkverträgen oder die Verringerung der Fertigungstiefe durch eine Verlagerung an Zulieferer. Bei Amazon sind es die neuen Logistik-Zentren, die man in den benachbarten Ländern Polen und Tschechien errichtet hat. Die Deutsche Post befindet sich insofern in einer besonderen Situation, als dass eine einfache Verlagerung beispielsweise in andere Länder so nicht möglich ist. Gleichzeitig steht man unter erheblichem Druck durch die Konkurrenten, die mit niedrigeren Arbeitskosten auf dem Markt agieren können. Die Deutsche Post befindet sich mithin in einer vergleichbaren Situation wie ein weiteres Unternehmen, das an dieser Stelle aufgerufen werden könnte: die Lufthansa. Auch in diesem Unternehmen hat es in den vergangenen Monaten wieder mehrere Arbeitskämpfe der Piloten gegeben. Die wehren sich nicht nur gegen eine Verschlechterung ihrer Renteneintrittsbedingungen, sondern sie sehen auch die Gefahren, die damit verbunden sind, dass das Unternehmen die gesamten Arbeitsbedingungen an die der Billigfluglinien angleichen will bzw. meint zu müssen. Die Lufthansa ist gleichsam eingeklemmt zwischen den Kostenvorteilen, die die Billigflieger haben, sowie den Marktanteilsgewinnen von Premium-Anbietern, vor allem aus den Golfstaaten. Ein echtes „Sandwich-Dilemma“.
Aus dieser Gemengelage resultiert eine unangenehme Diagnose: Alle Arbeitskampfaktionen in den genannten Unternehmen sind für sich genommen absolut nachvollziehbar und verständlich. Zugleich stoßen sie in einem doppelten Sinne an eine Grenze: Zum einen sind sie aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive durchaus problematisch, da sie dazu beitragen können, die bestehenden Geschäftsmodelle der Unternehmen in eine zunehmende Schieflache zu bringen, zum anderen sind sie absolut nachvollziehbar, da die Beschäftigten sich gegen einen Downgrading wehren. Würden sie das nicht tun, würden sie sich ins eigene Knie schießen.
Eigentlich müssten die Streikaktionen bei den Billiganbietern und Lohndumpern stattfinden. Konkret wären Streiks bei Hermes oder GLS, um den Paketdienstebereich zu nennen, oder der Piloten von Ryanair wichtig bzw. in diesem Gefüge wünschenswert. Dort aber sind wir konfrontiert zum einen mit einem deutlich niedrigeren gewerkschaftlichen Organisationsgrad der Beschäftigten wie auch mit dem Problem, dass die dort arbeitenden Menschen Angst haben, durch kollektive Aktionen dem Arbeitgeber Paroli zu bieten.
Aber auch die Nachfrager dürfen nicht aus ihrer Verantwortung entlassen werden. Dies gilt nicht nur für das Beispiel Amazon, denn natürlich müsste das Unternehmen anders agieren, wenn ein signifikant großer Anteil der Kunden ihr Kaufverhalten auch davon abhängig machen würde, dass das Unternehmen seine Kunden in Deutschland aus Deutschland beliefert. Und wenn man das Beispiel Daimler zu Ende denkt, dann ist es natürlich so, dass man durch eine Produktion in anderen Ländern mit deutlich niedrigeren Arbeitskosten erheblich billiger werden könnte. Nun ist es aber nicht so, dass die Kosteneinsparung dann eins zu eins an die Verbraucher weitergegeben werden würden, sondern man würde diese Strategie mit dem Preisniveau für die Autos in Deutschland kombinieren wollen. Auch hier müssen sich die Verbraucher fragen, ob sie diese Entwicklung durch ihr konkretes Kaufverhalten unterstützen wollen oder nicht. Langfristig gesehen würde die Rechnung sowieso nicht aufgehen, man kann nicht die gut bezahlten Arbeitsplätze in Deutschland wegrationalisieren und trotzdem auf das hier entwickelte Preisniveau setzen.
So oder so bleibt die Erkenntnis: Wenn dein starker Arm es will, stehen alle Räder still – das hört sich leichter an als es heute überhaupt noch möglich ist. Die Gewerkschaften befinden sich häufig in unauflösbaren Dilemmata. Umso wichtiger ist die Unterstützung ihrer wichtigen Arbeit aus dem politischen Raum, beispielsweise durch einen verstärkten Einsatz der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen. Darüber wird im vor uns liegenden neuen Jahr verstärkt zu reden sein.