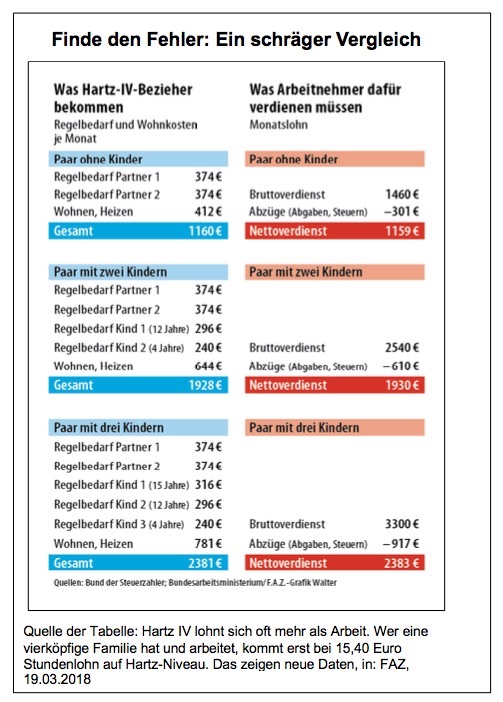Viele, sehr viele Beiträge haben sich in diesem Blog angesammelt zum Thema Sanktionen im Hartz IV-System. Es ist ein in mehrfacher Hinsicht polarisierendes Thema. Für die einen sind die Sanktionen das scharfe Schwert eines strafenden Systems, dem es um Einschüchterung und Drangsalierung geht, um die Betroffenen auf das „richtige“ Gleis zu setzen. Zugleich kann man mit dem Damoklesschwert-Charakter der Sanktionen die vielen anderen dazu bringen, sich systemkonform zu verhalten. Auf der anderen Seite wird der bedürftigkeitsabhängige Sozialhilfe-Charakter der Grundsicherung herausgestellt und auf die unbedingten Mitwirkungspflichten der Hilfeempfänger abgestellt. Wenn man das Instrumentarium der Sanktionen nicht mehr zur Verfügung hätte, dann könnten einem die Transferleistungsbezieher auf der Nase herumtanzen.
Wir können schon an dieser holzschnittartigen Zusammenfassung erkennen, dass es hier zum einen um ganz unterschiedliche Menschenbilder geht (die sich auch in der letztendlich nie auflösbaren und höchst widersprüchlichen Dichotomie von Fördern und Fordern spiegeln), zum anderen geht es hier aber eben auch um den systemischen Aspekt, dass es sich bei Hartz IV um eine Art „nicht-bedingungsloses Grundeinkommen“ (vor allem für diejenigen, die lange Zeit in diesem System verbringen müssen) handelt, in dem man die Einhaltung der Bedingungen im Griff behalten muss.