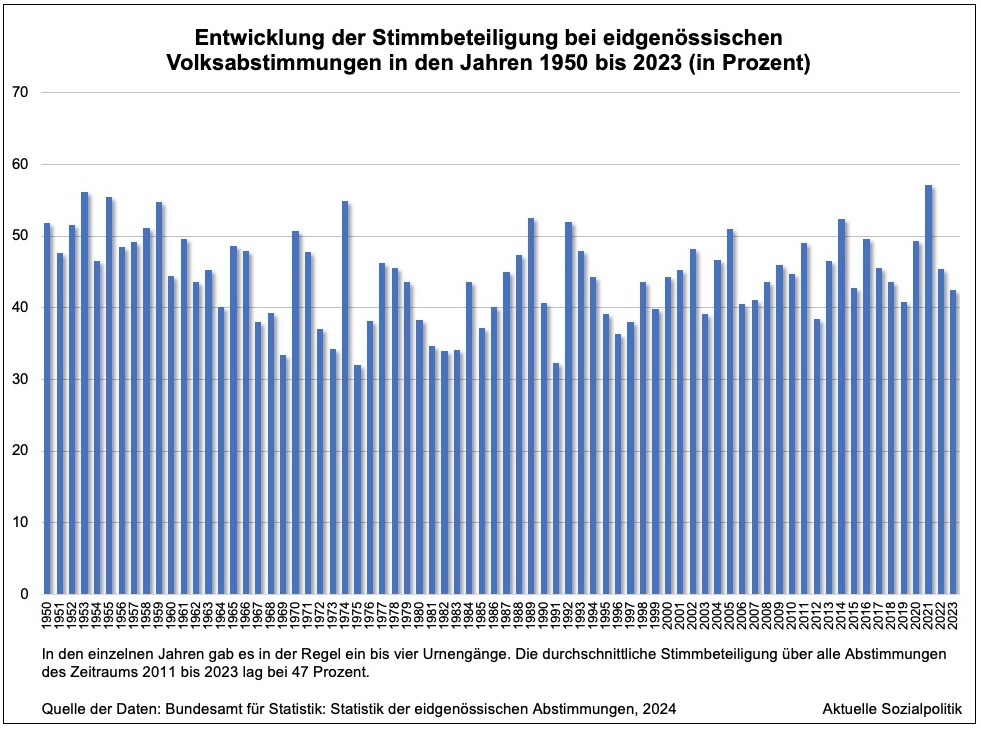Die Schweizer sind für echte Überraschungen gut. Noch nie ist es dort gelungen, über eine Volksabstimmung einen Ausbau des Sozialstaats auf den Weg zu bringen. Man denke hier als ein Beispiel an den 5. Juni 2016, da haben die Schweizer über eine Initiative abgestimmt, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen – gegen den Antrag einen neuen Art. 110a der Bundesverfassung betreffend haben dann 76,9 Prozent derjenigen Schweizer gestimmt, die den Weg an die Wahlurne gefunden haben (vgl. dazu den Beitrag Mit dem Herz dafür, aber mit dem Kopf dagegen? Oder mit dem Verstand dafür, aber ohne Herz? Das „bedingungslose Grundeinkommen“ ist (nicht) krachend gescheitert vom 7. Juni 2016).