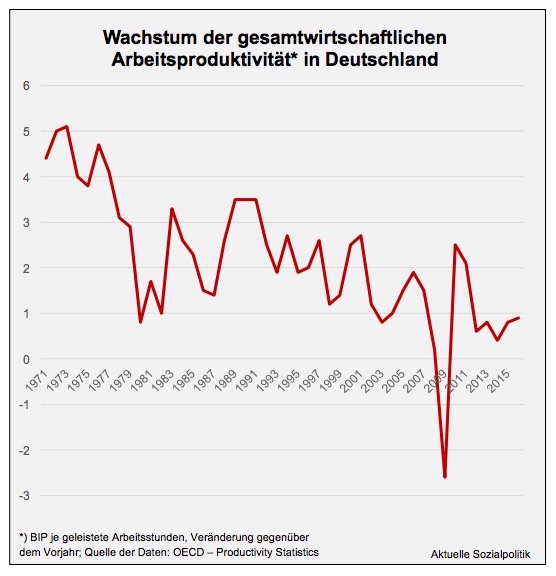Der eine oder andere wird sich noch an sie erinnern – an die „Partei der Leistungsträger“. So hatte sich die FDP schon in den 1990er Jahren unter dem Vorsitzenden Klaus Kinkel selbst abzusetzen versucht von den anderen Konkurrenten auf dem Markt um Wählerstimmen und die offenherzige Ausrichtung als Klientelpartei hat ihr eine Menge Sympathien gekostet. Der damalige FDP-Generalsekretär Werner Hoyer war sogar so ehrlich, von der „Partei der Besserverdiener“ zu schwärmen, was im Volksmund schnell und kompakt in „Zahnärzte-Partei“ umdefiniert wurde. Und schon sind wir mittendrin im hier interessierenden Schlamassel, denn auch wenn Zahnärzte eine wichtige und anerkennenswerte Leistung erbringen (können), so wurde doch von vielen das Problem erkannt, das hinter dem klientelistischen Zugriff auf bestimmte „Leistungsträger“ steht: Die Anbindung an Einkommen, an einen bestimmten (gesellschaftlich so definierten bzw. verzerrten) Status, die offen oder versteckte Abwertung vieler anderer, die es „nicht geschafft“ haben, obwohl viele von ihnen durchaus eine Menge „schaffen“, hier verstanden im Sinne des schwäbischen Verbs.
Auf der anderen Seite und unabhängig von einer normativen oder stilistischen Bewertung dieser schamlosen Abgrenzung nach unten muss man dem Ansatz zugute halten, dass er offen anspricht, was durchaus weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft: »Die Arbeitsleistung, so heißt es, ist das Fundament der Gesellschaft, die dadurch zur Leistungsgesellschaft wird, in der jeder gemäß seiner Leistung bezahlt wird oder werden sollte.«
Mindestlohn
Der nach Gerhard Schröder „beste Niedriglohnsektor“, der in Europa geschaffen wurde, betrifft mehr als jeden fünften Arbeitnehmer in Deutschland
Im Januar 2005 – Hartz IV hatte gerade das Licht der Welt erblickt – preist der damalige Noch-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) in seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sein ganz besonderes Kind: „Wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt.“
Nun war das im Jahr 2005. Mittlerweile sind wir in 2017 angekommen. Und da, nach Jahren des „Jobwunders“ in Deutschland, wird man mit so einer Meldung konfrontiert: Knapp jeder Vierte arbeitet für Niedriglohn: »Der Anteil der Arbeitnehmer, die in Deutschland einen Niedriglohn beziehen, ist im europäischen Vergleich hoch. So verdienen 22,5 Prozent der Beschäftigten unter der Niedriglohnschwelle von 10,50 Euro pro Stunde … Zum Vergleich: Im Euroraum insgesamt kommen nur 15,9 Prozent der Arbeitnehmer mit Niedriglohn nach Hause und haben aber mehr in der Tasche als deutsche Niedriglöhner: Im Euroraum beginnt der Niedriglohn erst unterhalb von 14,10 Euro.« Als Niedriglohn gilt nach einer Definition der OECD ein Verdienst, der unterhalb von zwei Dritteln des mittleren Bruttostundenlohns (gemessen am Median, nicht am arithmetischen Mittel) liegt. In Frankreich arbeiten nur 8,8 Prozent der Beschäftigten für einen Niedriglohn, der dort mit nur zehn Euro etwas niedriger liegt als in Deutschland. An der Niedriglohnschwelle von 10,50 Euro pro Stunde wird auch erkennbar, dass eine Vergütung nach dem gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 8,84 Euro pro Stunde nicht dazu führen kann, die betroffenen Arbeitnehmer aus dem Niedriglohnbereich herauszuholen – er ist ja auch „nur“ eine Lohnuntergrenze.
Wie sieht es aus mit der Umsetzung des gesetzlichen Mindestlohns? Aus der Welt der Mindestlohnvermeider
Jetzt sind es schon fast zweieinhalb Jahre, seit denen der gesetzliche Mindestlohn für (fast) alle in Kraft ist und man kann genauer hinschauen, wie es denn mit der Umsetzung bestellt ist. Neben der mittlerweile nun wirklich als haltlos erwiesenen Vorhersage einer Jobkiller-Wirkung der anfangs 8,50 Euro pro Stunde wurde immer wieder auf den Tatbestand hingewiesen, dass der Mindestlohn in der vielgestaltigen Praxis von den einen oder anderen schwarzen Schafen in der Unternehmerherde umgangen, dass Arbeitnehmern das, was ihnen eigentlich zusteht, vorenthalten wird. Da passt so ein Artikel: Mit allen Tricks gegen den Mindestlohn. Darin berichtet Kristiana Ludwig, dass die Umgehung des Mindeslohns erstmals Thema im Bericht der Bundesregierung zur Schwarzarbeit ist. Sie bezieht sich auf den 13. Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen des Gesetzes zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung, in dem es um die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung in den Jahren 2013 bis 2016 geht. »Im Transportgewerbe, bei Speditionen, Logistikunternehmen und in der Personenbeförderungsbranche ist Schwarzarbeit nach wie vor stark verbreitet«, heißt es in dem Bericht der Bundesregierung. „Nahezu alle, insbesondere lohnintensive Wirtschaftszweige“ seien von Schwarzarbeit betroffen. Insbesondere seien auch Bauarbeiter, Mitarbeiter von Gaststätten und Hotels, Schausteller, Putzkräfte und die Arbeiter in Schlachtereien häufig illegal beschäftigt. Trotz aller Bemühungen belief sich die Schadenssumme in Verbindung mit Schwarzarbeit im vergangenen Jahr auf insgesamt 875,6 Millionen Euro, heißt es in dem Bericht. Bei der letzten Untersuchung vor vier Jahren waren es noch 799,1 Millionen Euro.
Erstmals wurde in dem Bericht auch der Mindestlohn und seine (Nicht-)Einhaltung thematisiert. Dazu berichtet Kristiana Ludwig:
»Zollbeamte stellten eine ganze Reihe „besonderer Vorgehensweisen“ fest, die Firmen nutzten, um sich um die Zahlung des gesetzlichen Lohns zu drücken. So rechneten sie etwa Kost und Logis in die Bezahlung mit ein, vergüteten Arbeitsstunden mit Einkaufsgutscheinen statt mit Geld oder nutzten Praktikanten-Verträge, um Mitarbeiter billig zu beschäftigen.«
In dem Bericht der Bundesregierung (S. 22) findet man den Hinweis auf folgende besondere Vorgehensweisen zur Vermeidung der Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns, die vom Zoll beobachtet worden sind:
– ungerechtfertigte Anrechnung von Kost und Logis auf den Mindestlohn,
– Verrechnung der Arbeitsstunden mit Konsumeinkäufen, Sachbezügen und Gutscheinen,
– Pauschalvergütung ohne Berücksichtigung des Mindestlohns und der Arbeitszeit,
– ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Ausnahmetatbeständen, z. B. Praktikantenregelung,
– unrichtige Führung von Arbeitszeitkonten,
– Ausweisen von Arbeitszeit als Pausen,
– Nichtvergütung von Rüstzeiten sowie Vor- und Nacharbeiten,
– Nichtvergütung von Leerfahrten im Personentransportgewerbe und
– Verwendung von Abdeck- oder Scheinrechnungen.
Im Heft 5/2017 der Zeitschrift Soziale Sicherheit wird in mehreren Beiträgen eine Zwischenbilanz zum gesetzlichen Mindestlohn gezogen.
„Über zwei Jahre gesetzlicher Mindestlohn. Umsetzung, Wirkungen, Umgehungen und Kontrollen“, so ist der Beitrag von Claudia Falk und Robby Riedel überschrieben: »Die positiven Effekte auf die Verdienst- und Beschäftigtenentwicklung halten an. Doch nach wie vor kommt der Mindestlohn wegen Ausnahmeregelungen und Umgehungen nicht überall an. Umso wichtiger ist es, dass der Staat die Einhaltung der Mindestlohnbestimmungen ausreichend kontrolliert. Doch hier hapert es.«
Zum Thema Umgehungen des Mindestlohns schreiben sie: »Leider werden gerade Minijobber/innen immer wieder um den korrekten Mindestlohn betrogen … Der Klassiker: Zwar erhalten die Minijobber/innen Arbeitsverträge, in denen die Arbeitsstunden zum Lohn passen. In der Realität wird dennoch erwartet, dass die Arbeit im früheren höheren Umfang erledigt wird. Das geschieht dann häufig durch unbezahlte Überstunden. Viele Betroffene trauen sich nicht, sich dagegen zu wehren – aus Angst um ihren noch so kleinen Job.«
Ein interessantes Interview zum Thema Umgehung des Mindestlohns findet man auch in dem Heft: „Praktika werden von Arbeitgebern ausgereizt“: »Dörthe Sund vom Jobcenter Vorpommern-Rügen in Stralsund berichtet, wie der Mindestlohn umgangen wird. Ihre Behörde war bundesweit eine der ersten, die erfolgreich Aufstockerleistungen von einem sittenwidrig zahlenden Arbeitgeber eingeklagt hat.«
Die Jobcenter-Mitarbeiterin berichtet eine ganze Reihe an interessanten Aspekten aus ihrer Praxis:
»Praktika werden von Arbeitgebern ausgereizt; in einem Fall beschäftigte ein Arbeitgeber einen Leistungsbezieher zunächst für sechs Monate als Küchenhilfe, um ihn dann nach einer Unterbrechung von ein paar Monaten in einem Praktikum zur Arbeitserprobung an gleicher Stelle einzusetzen.
Auffällig war, dass Arbeitgeber verschiedenster Branchen die Arbeitsverträge der Arbeitnehmer änderten, indem sie die Arbeitszeit reduzierten, wohl um durch die Einführung des Mindestlohnes keine Lohnsteigerungen zu produzieren.
Neue Arbeitsverträge werden häufig nur als Teilzeitverträge abgeschlossen, dabei werden auch Klauseln zu unentgeltlicher Mehrarbeit in die Verträge aufgenommen. In anderen Fällen ist zu beobachten, dass Stundennachweise nach Abforderung durch das Jobcenter exakt zu den abgerechneten Stunden passen, obwohl die Arbeitnehmer – unsere Kunden – von Überstunden sprechen.
In einem Fall berichtete uns ein Arbeitnehmer aus der Hotel- und Gaststätten-Branche, dass er einen Arbeitsvertrag über 30 Stunden abgeschlossen hatte, diese 30 Stunden wurden auch ordnungsgemäß mit 8,50 Euro entlohnt. Der Arbeitnehmer erzählte aber weiterhin, dass in den Restaurants des Arbeitgebers ein Schwarzbuch zur Mehrarbeit geführt werde. In diesem werden Überstunden vermerkt, die am Ende des Monats durch die Arbeitnehmer zu streichen sind und vom Arbeitgeber mit fünf Euro pro Stunde bar bezahlt werden. Der Kunde konnte uns die Lage des Überstundenbuchs genau beschreiben. Allerdings ist in diesem Fall die Beweislage sehr dünn, laut Arbeitsvertrag und Entgeltbescheinigungen ist die Lohnabrechnung korrekt. Uns liegt nur die Aussage des einen Arbeitnehmers vor, betreten darf ein Mitarbeiter des Jobcenters die Geschäftsräume des Arbeitgebers nicht. Wir haben diesen Fall an die FKS Schwarzarbeit weitergeleitet.«
Es ist klar, dass es immer schwarze Schafe geben wird, die versuchen werden, Regelungen durch illegales Verhalten zu unterlaufen. Aber gerade ein flächendeckender Mindestlohn ist darauf angewiesen, dass sich die meisten Betriebe darauf verlassen können müssen, dass die Regelung auch von den Konkurrenten eingehalten werden, ansonsten verschaffen sich die – gerade in lohnintensiven Branchen – einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Das verweist auf den Aspekt der Kontrollen und der damit verbundenen Risikowahrscheinlichkeit, erwischt und sanktioniert zu werden.
Bereits frühzeitig wurde in diesem Blog darauf hingewiesen, dass die für die Mindestlohnkontrollen zuständige Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls personell unterausgestattet ist angesichts der erheblichen zusätzlichen Aufgaben, die das Mindestlohngesetz mit sich gebracht haben, so beispielsweise in den kritischen Beiträgen Flüchtlingsbetreuung sticht Mindestlohn-Kontrolle. Der Zoll muss umverteilen – und es trifft vor allem die Mindestlohn-Kontrolleure vom 12. September 2015 sowie Der gesetzliche Mindestlohn: Wie viel darf, soll oder muss es sein? Und wer schaut eigentlich genau hin, ob er überhaupt gezahlt wird? vom 26. Februar 2016.
Auch in der aktuellen Diskussion wird die Bedeutung engmaschiger Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) gerade in kleineren mindestlohnrelevanten Betrieben – etwa in der Gastronomie oder im Einzelhandel – hervorgehoben. Dazu berichten Claudia Falk und Robby Riedel in ihrem Artikel:
»Für stärkere Kontrollen plädierten auch die Vertreter der FKS, die auf einem DGB-Mindestlohnworkshop Ende Februar 2017 über nötige Verbesserungen für die Kontrollen diskutiert hatten. Sie beklagten, dass es zu wenige Stellen für die Kontrolle gibt und zum Teil hohe Fehlbestände, so dass die Kontrolldichte in 2015 und 2016 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen ist. Zudem lautete die Weisung aus dem Bundesfinanzministerium in den ersten Monaten nach der Mindestlohneinführung: »Aufklärung statt Ahndung«. So hatten die Kontrolleure anfangs selbst bei Verstößen zunächst nur Verwarnungen ausgesprochen.«
Und zu den Kontrollen:
»Inzwischen liegen Zahlen für die Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit für 2016 vor.21 Sie erstrecken sich allerdings nicht nur auf Verstöße gegen das Mindestlohngesetz und gegen Branchenmindestlöhne, sondern nehmen auch illegale Beschäftigung und Sozialversicherungsbetrug ins Visier. Es ergibt sich ein gemischtes Bild (s. Abbildung 3): Die Zahl der Kontrollen ist in 2016 nach einem schon schwachen Jahr 2015 weiter zurückgegangen. So wurden 2016 insgesamt 40.374 Arbeitgeber geprüft, während es 2015 noch 43.637 waren.« Interessant ist dieser Aspekt: »Besonders stark fiel der Rückgang der Kontrollen 2016 am Bau (– 19 % gegenüber dem Vorjahr) und im Gaststättengewerbe (– 17,2 %) aus. Während in den Baubranchen (hier gelten Branchenmindestlöhne nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz) auch die Zahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren um 10,2 % abnahm, stiegen sie im Gaststättenbereich um 79 %. Offenbar stoßen die Zollbeamten im Gaststättenbereich trotz geringer Kontrolldichte besonders häufig auf Mindestlohnverstöße.«
Bereits in der Vergangenheit wurde hier immer wieder darauf hingewiesen, dass man die Kontrollen auch machen können muss. In diese Wunde streuen Claudia Falk und Robby Riedel eine Menge Salz: »Da ist es besonders ärgerlich, dass von den 6.865 Planstellen der FKS für 2016 knapp 800 Stellen (13 %) nicht besetzt waren. Zum Teil deshalb, weil 362 Beamte in andere Behörden wie dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) oder der Bundespolizei abgeordnet waren. Zudem sind auch die Beamtinnen und Beamten, die für die zusätzlich versprochenen 1.600 Stellen vorgesehen sind, noch immer nicht fertig ausgebildet. Auch für 2017 erwartet das Bundesfinanzministerium 13 % unbesetzte Planstellen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit … Nach Berichten von FKS-Mitarbeitern ist auch die technische Ausstattung mangelhaft. So arbeiteten die FKS-Beschäftigten bei Prüfungen immer noch mit Fragebögen in Papierform, anstatt die Angaben zur rascheren Weiterbearbeitung direkt elektronisch einzugeben und so einen leichteren und schnelleren Austausch mit beteiligten Behörden wie etwa der Deutschen Rentenversicherung zu ermöglichen.«
Und die beiden Autoren machen auch umfangreiche Vorschläge, was man besser bzw. anders machen könnte. Als Gegenmaßnahmen, damit der Mindestlohn überall ankommt und nicht umgangen wird, schlagen Falk und Riedel vor:
- Die Beweislast bei Mindestlohnansprüchen sollte umgekehrt werden: Nicht der Arbeitnehmer, sondern der Arbeitgeber soll künftig nachweisen müssen, wie lange ein Beschäftigter tatsächlich gearbeitet hat.
- Der DGB fordert schon lange die Einführung des Verbandsklagerechts – auch für Klagen gegen Mindestlohnverstöße wäre dies sehr hilfreich.
- Es muss zudem ein Gesetz zum Schutz von Whistleblowern geschaffen werden.
- Das Gesetz zur Bekämpfung von Schwarzarbeit sollte auf den Einzelhandel sowie das Bäcker- und Fleischereihandwerk ausgedehnt werden. So werden Kontrollen der FKS erleichtert.
- Für Beschäftigte muss es beim Abschluss neuer Arbeitsverträge mehr Rechte geben. Sie sollen verpflichtend mehr Bedenkzeit erhalten, bevor sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben. So können sie sich vorher beraten lassen. Wie nötig das ist, zeigen z.B. die wiederkehrenden Fälle, wo Minijobbern ad hoc neue Arbeitsverträge mit nach unten angepassten Arbeitszeiten zur Unterschrift vorgelegt wurden.
- Es sollten mehr Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften zur Unterstützung des Zolls eingerichtet werden.
- Der Prüfdienst der Rentenversicherung sollte aufgestockt werden.
- Die Stellen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sollten mittelfristig auf 10.000 aufgestockt werden.
- Die Kontrollen der FKS sollten sich nicht nur auf die organisierte Kriminalität konzentrieren, sondern verstärkt auch Prüfungen kleinerer, mindestlohnrelevanter Unternehmen – etwa in der Gastronomie und im Einzelhandel – umfassen. Zudem sollten präventive Streifenfahrten erhalten bleiben, um spontan auch Prüfungen in kleineren Betrieben vornehmen zu können.
- Es darf keine – wie auch immer gearteten – Ausnahmeregelungen für Flüchtlinge vom Mindestlohn geben. Der DGB hat von Anfang an bestehende Ausnahmen und Sonderregeln etwa für Zeitungszusteller/innen, Minderjährige, bestimmte Praktikantengruppen und Langzeitarbeitslose kritisiert. Jede Ausnahme erschwert die effiziente Kontrolle des Gesetzes.
Der Fleischindustrie in einer parlamentarischen Nacht-und-Nebel-Aktion ans Leder gehen: Maßnahmen gegen den Missbrauch von Werkverträgen in den deutschen Billig-Schlachthöfen
Normalerweise ist der parlamentarische Prozess nicht von besonderer Schnelligkeit geprägt. Da werden Entwürfe diskutiert, Anhörungen gemacht, Ausschussempfehlungen verändern das, was eingebracht wurde und irgendwann einmal findet das alles seinen Eingang in das Bundesgesetzblatt. Im Vorfeld haben viele Institutionen die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, Korrekturen oder Ergänzungen auf den Weg zu bringen, aber auch Blockaden zu organisieren. Das ganz normale Geschäft eben. Vor diesem Hintergrund wird man dann mehr als hellhörig, wenn man sowas lesen kann: »Bereits in der Nacht zum Freitag wollten Union und SPD den Missbrauch von Werkverträgen per Gesetz stoppen und dabei auch die großen Schlachtkonzerne in die Pflicht nehmen. Aus Sorge, dubiose wie einflussreiche Größen der Fleischindustrie könnten das Gesetz noch verhindern, war nur eine Handvoll Abgeordnete eingeweiht.« Das berichtet Markus Balser in seinem Artikel Ausgebeutet auf dem Schlachthof.
»Am Donnerstag kündigten Abgeordnete völlig überraschend an, die seit längerem bekannten Missstände in deutschen Schlachthöfen einzudämmen. Bereits in der Nacht zum Freitag wollten Union und SPD den Missbrauch von Werkverträgen per Gesetz stoppen und dabei auch die großen Schlachtkonzerne in die Pflicht nehmen. Die Beschäftigten stünden oft an letzter Stelle einer Kette von Subunternehmen, sagte der CDU-Arbeitsmarktexperte Karl Schiewerling in Berlin. Es herrschten undurchschaubare Verhältnisse bis hin zu kriminellen Machenschaften.«
Um das Ergebnis gleich vorweg zu nehmen: Laut Bundestag ist das auch in der tiefen Nacht vom Donnerstag auf den Freitag passiert: Laut Tagesordnung für die 237. Sitzung des Deutschen Bundestages am 1. Juni 2017 wird für 1:55 Uhr der Tagesordnungspunkt 34 ausgewiesen: „Änderung des Bundesversorgungsgesetzes“. Und dort steht dann als Beschlussempfehlung die Annahme des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung, den man in der BT-Drs. 18/12611 findet. In der Nacht wurde dann das Resultat vermerkt: angenommen.
Aus der Welt der Mindestlöhne (und ihrer angeblichen Gefahren, wenn es denn welche gibt)
Der Mindestlohn ist mal wieder Thema in der kritischen Berichterstattung.
Alleinerziehende brauchen oft ergänzende Sozialleistungen, so eine der Schlagzeilen: »Ein Vollzeitjob mit Mindestlohn reicht für viele Arbeitnehmer nicht aus, um Lebenshaltungs- und Wohnkosten zu decken. Dies gilt insbesondere für Alleinerziehende, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linken hervorgeht.« Beim aktuellen Mindestlohn von 8,84 Euro und 37,7 Stunden Arbeit pro Woche ergibt sich ein Bruttoeinkommen von 1.444 Euro. Unter Berücksichtigung von Steuern, Abgaben, Freibeträgen und Lebenshaltung bleiben einer Alleinerziehenden noch 339 Euro für die Kosten von Wohnung und Heizung. Das reicht in der Regel nicht. Bei 87 Prozent der Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften Alleinerziehender mit einem Kind liegen die von den Behörden anerkannten Wohnkosten höher, wie aus der Antwort der Bundesregierung hervorgeht. Vgl. hierzu Höhe des gesetzlichen Mindestlohns und Umfang der Sonderregelungen und Übergangsvorschriften, Bundestags-Drucksache 18/11918 vom 11.04.2017. Aber das betrifft nicht nur die Alleinerziehenden.
»Selbst für Singles in Vollzeittätigkeit, die nur den Mindestlohn erhalten, ist es mitunter schwierig, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Bei einem Bruttoeinkommen von 1444 Euro bleiben ihnen 368 Euro für das Wohnen und Heizen. Bei 39 Prozent der Bedarfsgemeinschaften Alleinstehender erkennen die Behörden höhere Wohnkosten an. Flächendeckend ist dies in Hessen, Berlin und Hamburg der Fall. Auch in Düsseldorf, im Kreis Neuss, in Bonn, Köln, Münster, Darmstadt, Frankfurt/Main, Wiesbaden und Mainz liegen die Wohnkosten so hoch, dass Vollzeit arbeitende Singles mit Mindestlohn auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen sind.«
Und dann gibt es da ja noch die Minijobs. Eine der wenigen verbliebenen (scheinbaren) Kritikpunkte der vielen Mindestlohngegner gerade aus der Ökonomenzunft bezieht sich auf den (angeblichen) massenhaften Abbau geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse aufgrund der mit dem gesetzlichen Mindestlohn seit dem 1. Januar 2015 einhergehenden Kostenerhöhung.
Hier hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit einmal genauer hingeschaut:
Philipp vom Berge und Enzo Weber (2017): Beschäftigungsanpassung nach Mindestlohneinführung: Minijobs wurden teilweise umgewandelt, aber auch zulasten anderer Stellen. IAB-Kurzbericht 11/2017, Nürnberg 2017
Die Wissenschaftler schreiben zusammenfassend zu ihren Befunden: »Um den Jahreswechsel 2014/2015 ist die Zahl der Minijobs in Deutschland deutlich gefallen. Dieser Rückgang wurde durch verstärkte Umwandlung solcher Jobs in sozial versicherungspflichtige Beschäftigung teilweise ausgeglichen. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Zahl der umgewandelten Minijobs verdoppelt. Dabei fanden Umwandlungen vermehrt bei bestimmten Personengruppen statt: Frauen, Älteren, Ostdeutschen und Beschäftigten in mittelgroßen Betrieben. Die im Zuge der Mindestlohneinführung umgewandelten Beschäftigungsverhältnisse waren bislang nicht weniger stabil als solche in der Vergangenheit.«
Apropos Minijobs. Dazu der Beitrag Schon 2016 wieder „business as usual“ bei den Minijobs von Markus Krüsemann, der über den Horizont der IAB-Studie hinausschaut: »Das im ersten Jahr nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns beobachtete deutliche Minus bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten hat offensichtlich keine Trendwende eingeläutet. Schon 2016, im zweiten Jahr mit Lohnuntergrenze war es mit den Rückgängen vorbei. Nach den jetzt vorliegenden Zahlen der Bundesagentur für Arbeit gingen die Zahlen wie schon zur Jahresmitte auch zum Ende des dritten Quartals nur noch kaum merklich zurück … Der Bestand an Beschäftigten, die nur im Minijob arbeiten, hat sich im Jahresverlauf damit kaum verändert. Dies kann als deutliches Zeichen dafür interpretiert werden, dass der 2015 erkennbare Prozess der betriebsinternen Umwandlung von geringfügiger in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (dies betraf etwa die Hälfte der abgebauten Minijobs) längst abgeschlossen ist.« Und dann kommt ein ganz wichtiger Aspekt: »Von einer Rückkehr zum „business as usual“ kann bei den im Nebenjob geringfügig Beschäftigten erst gar keine Rede sein. Ihre Zahl steigt schon seit Jahren und unbeeindruckt vom Mindestlohn an. Ende September 2016 lag das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,4 Prozent. Damit gab es fast 2,76 Millionen Beschäftigte mit einen zusätzlichen Minijob als Nebenjob, womit mal wieder ein neuer Höchststand markiert wurde.«
Aber wir wollen an dieser Stelle die vielen „enttäuschten“ Ökonomen, dass es (bisher) nicht so gekommen ist mit dem vorhergesagten „Jobkiller“ Mindestlohn, nicht alleine stehen lassen. Immer wieder gibt es Versuche, eine angebliche Pathologie des Mindestlohns für Beschäftigung zu belegen. Wie schädlich sind Mindestlöhne? So hat Norbert Häring seinen Artikel im Handelsblatt überschrieben, der – wenn auch mit einem Fragezeichen versehen – den Finger auf die Wunde legt, die von der Mainstream-Ökonomie in Deutschland so gerne diagnostiziert wird (auch wenn der Patient einfach über keine Beschwerden klagt).
»Schaden Mindestlöhne der Beschäftigung im Niedriglohnsektor? Viele Studien legen nahe, dass sogar das Gegenteil der Fall sein könnte. Nun haben Forscher einen neuen Ansatz gewählt – mit Hilfe der Bewertungsplattform Yelp«, berichtet Häring. Hintergrund der neuen Studie sind die Entwicklungen in den USA: »Der kalifornische Gesetzgeber hat jüngst beschlossen, dass der Mindestlohn bis 2022 von derzeit 10 auf 15 Dollar steigen wird. Gut zwei Fünftel der Beschäftigten in dem Staat verdienen nach Medienberichten derzeit weniger als 15 Dollar die Stunde. Eine Reihe von Städten, darunter San Francisco, hat den heftig umstrittenen Mindestlohn von 15 Dollar schon vorher beschlossen.«
Vor diesem Hintergrund fällt eine Studie aus der Elite-Uni Harvard, derzufolge höhere Mindestlöhne zu deutlich mehr Restaurantschließungen führen, den Mindestlohnkritikern wie ein Geschenk des Himmels vor die Füße. Da wird dann auch sofort von einer „Schock-Studie aus Harvard“ gesprochen (so beispielsweise Tyler Durden: Harvard ‚Shock‘ Study: Each $1 Minimum Wage Hike Causes 4-10% Increase In Restaurant Failures). Die (noch) Trump-nahe Nachrichten-Website Breitbart fand ihren ganz eigenen Zugang: „Mindestlohnerhöhungen drängen Nicht-Eliten-Restaurants aus dem Geschäft“ titelte man dort (vgl. dazu auch Härings Blog-Beitrag Breitbart und Zero-Hedge begeistern sich für windige Harvard-Studie gegen den kalifornischen Mindestlohn von 15 Dollar).
Um was für eine Studie geht es hier eigentlich?
Urheber der Aufregung ist das amerikanische Ökonomenehepaar Dara Lee Luca und Michael Luca. Dara Lee arbeitet für das Institut Mathematica Policy Research, Michael lehrt an der Harvard Business School. Beide sind auf datengetriebene Politikanalyse spezialisiert. Für ihre Mindestlohnstudie kooperierten sie mit der Bewertungsplattform Yelp, berichtet Norbert Häring.
Um ihren Ansatz zu verstehen, muss man wissen, dass die US-amerikanische Debatte über Mindestlöhne stark beeinflusst wurde von David Card und Alan B. Krueger und ihren Studien sowie den Anleihen, die bei ihnen gemacht wurden:
»1994 und 2000 veröffentlichten sie Studien zur Beschäftigungsentwicklung in Fast-Food-Restaurants der benachbarten Bundesstaaten Pennsylvania und New Jersey, nachdem in New Jersey der Mindestlohn erhöht worden war. 2010 folgte eine Studie von Dube, Lester und Reich, die den gleichen Ansatz auf viele Paare von benachbarten Kreisen in verschiedenen Bundesstaaten anwandte. In allen Studien war das Ergebnis, dass ein höherer Mindestlohn nicht zu Beschäftigungsverlusten, sondern eher zu Beschäftigungsgewinnen in dieser Niedriglohnbranche führt.«
Das Ökonomenpaar Luca hat mit Blick auf die beweisführende Branche der Fast-Food-Restaurants einen anderen Ansatz gewählt. Hier ist ihr Papier im Original:
Dara Lee und Luca Michael Luca (2017): Survival of the Fittest: The Impact of the Minimum Wage on Firm Exit. Working Paper 17-088, Harvard University, 2017
Sie haben sich auf der Plattform Yelp die Bewertungen, Zugänge und Abgänge von Restaurants in der Region San Francisco angeschaut. Häring zur Methode der beiden: »Dort haben verschiedene Städte unterschiedlich hohe Mindestlöhne eingeführt. Die beiden untersuchten, ob ein höherer Mindestlohn die Wahrscheinlichkeit verändert, dass ein Restaurant schließt.«
Zu den Ergebnissen der beiden schreibt Häring:
„Die Daten deuten darauf hin, dass höhere Mindestlöhne die Marktaustrittsrate von Restaurants erhöht“, schreiben die beiden. Das treffe vor allem Restaurants mit schlechten Bewertungen, die ohnehin existenzbedroht seien. Für ein Restaurant mit mittlerer Bewertung ermitteln sie eine um 14 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit des Marktaustritts, wenn der Mindestlohn um einen Dollar pro Stunde steigt. Für Restaurants in der höchsten Bewertungskategoire (5 Sterne) ist kein Einfluss festzustellen.
Also müssen wir uns doch Sorgen machen? Sind die Arbeiten von Card und Kruger widerlegt? Häring trägt die Zweifel an der neuen Studie zusammen:
- »Zur statistischen Absicherung gibt es im Studientext die Einräumung, dass das Hauptergebnis „nur in bestimmten Spezifikationen“ statistisch signifikant sei.« Bei so einer Formulierung sollte man hellhörig werden und vorsichtig bei der Übernahme der Befunde sein. Man kann das als Hinweis lesen, dass ziemlich viel mit den Daten herumprobiert wurde, bis brauchbare Ergebnisse im Sinne der Autoren herauskamen. Ein Blick in die Studie legt nahe, dass es genau so ist: »Nur ein Ergebnis bezeichnen die Autoren selbst als „robust“, dass nämlich eine Mindestlohnerhöhung schlecht bewerteten Restaurants mehr Probleme macht als gut bewerteten. Was den Gesamteffekt auf die Marktaustrittswahrscheinlichkeit angeht, sprechen sie dagegen nur von „suggestiver Evidenz“. Das ist die unterste Kategorie der Verlässlichkeit.«
- Und dann gibt es einen weiteren, methodisch schwerwiegenden Einwand gegen die angebliche „Schock-Studie“ aus Harvard. Häring formuliert den so: »Bleibt die Frage, ob die Zahl der Restaurants und Arbeitsplätze insgesamt sinkt, oder ob die frei werdenden Lokalitäten durch neue, bessere Restaurants ersetzt werden, oder schon bestehende Restaurants mehr Leute einstellen. Diese Frage kann die Studie nicht beantworten, weil die Anzahl der Beschäftigten in den Yelp-Daten nicht enthalten ist. Der wichtigste Faktor, der in der Theorie zu steigender oder stagnierender Beschäftigung durch höhere Mindestlöhne führen kann, wird also nicht geprüft.«
Das süffisante Fazit von Norbert Häring: »Die ausgehfreudigen Kalifornier müssen nicht befürchten, ihr notorisch gesundes und fades Essen künftig selbst zubereiten zu müssen.«