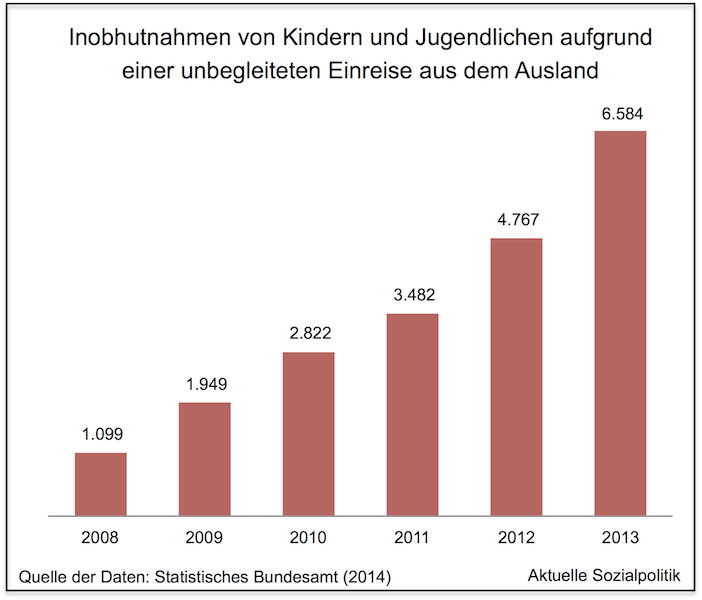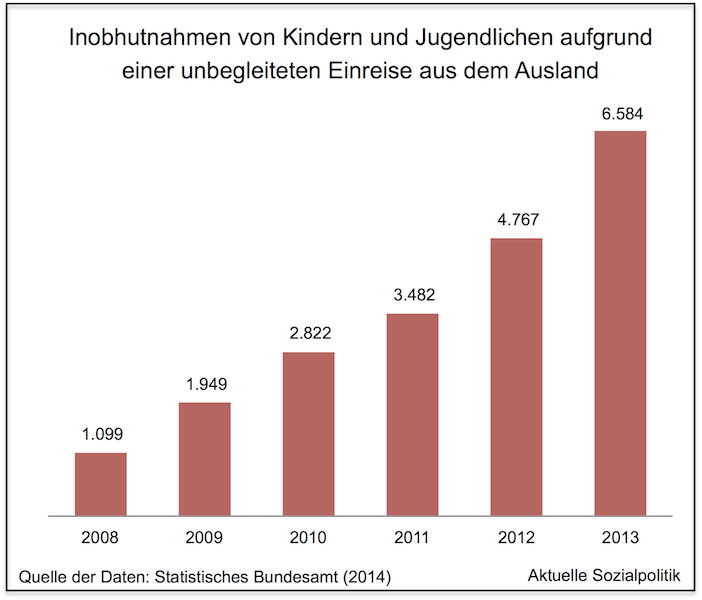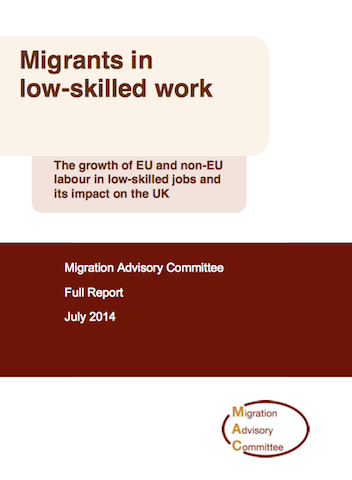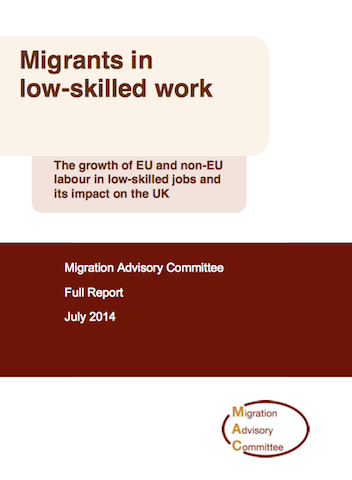Es sind mehr als irritierende Nachrichten, die aus zahlreichen Kommunen an die Oberfläche dringen hinsichtlich der vielen Flüchtlinge, die dort im wahrsten Sinne des Wortes aufschlagen. Nehmen wir das Beispiel München: „Es ist einfach alles Chaos“: »Zeltlager, Altenheime und Gewerbeobjekte dienen als Unterkünfte: Die Situation für Flüchtlinge wird in München immer dramatischer. Selbst die Verantwortlichen verlieren den Überblick.« Asylsuchende in der Münchner Erstaufnahmezentrale Bayernkaserne berichten, dass sie tagelang im Freien genächtigt hätten und nicht oder unzureichend mit Decken versorgt worden seien. »Unter sehr prekären Umständen leben auch etwa 700 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in sogenannten Schutzstellen, für die das Stadtjugendamt verantwortlich ist. Derzeit kommen viele Jugendliche aus Eritrea und Syrien, die noch keine 16 Jahre alt sind, ohne Eltern an. „Es ist alles entsetzlich“, sagte Jugendamtschefin Maria Kurz-Adam … Um die jungen Menschen annähernd gesetzeskonform zu betreuen, muss das Jugendamt laut Kurz-Adam neben Honorarkräften auch Ehrenamtliche engagieren, die mit Fachleuten in Teams arbeiten. Es sei nicht mehr möglich, ausreichend reguläre Mitarbeiter zu rekrutieren. Kurz-Adam räumt ein, dass sie keine Idee mehr habe, wie ihr Amt alleine eine tragfähige und langfristige Versorgung gewährleisten solle.« Und die ganze Widersprüchlichkeit, das Hin und Her offenbart sich auch in diesen Zeilen: »Sorgen macht man sich in der Stadt auch wegen wachsender Ressentiments in der Nachbarschaft der überbelegten Unterkünfte. Zunehmend höre man ablehnende, mitunter rassistische Äußerungen. Zugleich aber wächst auch die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Unzählige Münchner helfen Flüchtlingen mit Sachspenden oder ehrenamtlichem Engagement.«
Und es ist nicht nur eine Stadt wie München, in der es hinsichtlich der Flüchtlinge ganz offensichtlich drunter und drüber geht (vgl. dazu Stadt erwägt Wiesnzelt als Notunterkunft: »München sucht weiter fieberhaft nach neuen Unterkünften für Flüchtlinge. Auf dem Tollwood-Gelände sollen Schlafplätze für 300 bis 400 Menschen geschaffen werden. Auch der VIP-Bereich im Olympiastadion ist im Gespräch – und das Schützenfestzelt auf der Theresienwiese.«)
Mit 200.000 Flüchtlingen hatte das Bundesamt für Migration ursprünglich im laufenden Jahr gerechnet. Jetzt werden es wahrscheinlich 300.000. In einigen Bundesländern hat sich die Zahl der Aufzunehmenden innerhalb der vergangenen fünf Jahre vervielfacht.
Die Medien greifen zu drastischen Betitelungen, die zuweilen über das eigentliche Problem hinausschießen: Die deutsche Flüchtlingskatastrophe, so hat beispielsweise Nadine Oberhuber ihren Beitrag überschrieben. Wenn man eine solche Begrifflichkeit verwenden würde für die Lage in Teilen der Türkei oder noch schlimmer im Libanon, dann wäre das sicher gerechtfertigt. Davon abgesehen stellt Oberhuber eine scheinbar einfache Frage – und liefert sogleich eine enttäuschende Antwort:
»Es muss doch Kommunen geben, die Asylbewerber gut unterbringen und bei denen Sozialarbeiter und Ärzte daran arbeiten, sie professionell zu betreuen. Es kann sein, dass es solche positiven Beispiele gibt – das Problem ist nur: Sie sind verdammt selten geworden. Bei dem derzeitigen Ansturm neuer Flüchtlinge können selbst Vorzeigekommunen kaum noch gute Arbeit leisten.«
Oberhammer berichtet, dass es gute Ansätze gab, »mit denen Länder und Stadtstaaten die Unterbringung verbessern wollten: Berlin etwa beschloss 2003, Flüchtlinge nur noch dezentral unterzubringen. Also nicht mehr in Sammelunterkünften, sondern über die Stadt verteilt in Einzelwohnungen. Viele halten das für die beste Art, denn das ermögliche den Asylsuchenden ein selbstbestimmtes Leben und integriere sie vor allem in die Gesellschaft. Köln und einige andere Städte schlossen sich der Idee Berlins an. Einige Flächenländer wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz schafften es sogar, über 80 oder sogar 90 Prozent aller Asylbewerber in eigenen Wohnungen unterzubringen.« Aber das wird immer schwieriger bis unmöglich, je mehr Menschen Aufnahme suchen. Andere Bundesländer sind andere Wege gegangen: Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen sind diejenigen Länder, die den Großteil aller Asylsuchenden in Sammelunterkünften einquartieren. In Aufnahmeheimen, in denen die Zustände oft erbärmlich sind, wenn Flüchtlinge zu siebt oder acht in ein Zimmer gepfercht werden, Minderjährige allein und ohne Betreuung in diesen Heimen leben.
„Die Situation entgleitet den meisten, selbst wer bisher sagte: Wir wollen die Menschen gut unterbringen, der wird überrollt und ist jetzt bei der Containerunterbringung angelangt“ – mit diesen ernüchternden Worten wird die Politologin Jutta Aumüller zitiert, die derzeit in einem Projekt für das Institut für Entwicklung und Soziale Integration (DESI) die Lage in Flüchtlingsheimen untersucht. Sie weist darauf hin, dass es viele Kommunen gibt, die sich anstrengen – „aber ich erlebe derzeit nur noch Kommunen unter Druck“.
Natürlich geht es auch wie immer um die Finanzierung. »Bisher tragen die Bundesländer die Kosten für die Unterbringung und jedes Land setzt jeweils die Sätze selbst fest, die es den Kommunen dafür zahlt … Theoretisch bekommen die Kommunen also die Kosten für die Unterbringung ersetzt – praktisch reichen die Summen aber bei Weitem nicht aus.« Es sind allerdings eher die Gemeinden, die nicht gerade vor Geld strotzen, die sich für die Asylanten einsetzen, wie Jutta Aumüller beobachtet haben will. »Zumindest kann sie nicht erkennen, dass in finanzstarken Gegenden die Flüchtlinge besser untergebracht würden. Baden-Württemberg wird gelegentlich von Experten als Beispiel für Unterkünfte genannt, die „das nackte Grauen sind“.«
Dazu gesellen sich natürlich auch noch andere Probleme, die aus der akuten Überforderung resultieren. Auch wenn man jetzt, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, gegensteuert und eine bessere Betreuung zu organisieren versucht, dann fehlen oftmals die qualifizierten und geeigneten Fachkräfte, die man eben nicht aus dem Ärmel schütteln kann.
Bereits Anfang Oktober gab es in der Tageszeitung taz einen Themenschwerpunkt mit lesenswerten Beiträgen, die unterschiedliche Perspektiven der Flüchtlingsfrage aus- bzw. zumindest anleuchten. So beispielsweise ein Interview mit Manfred Schmidt, dem Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit der bezeichnenden Überschrift „Stimmung darf nicht kippen“. Und auch hier begegnet man wieder dem Engagement vor Ort: »Die Menschen in Balingen haben den Wunsch, Flüchtlingen zu helfen. Ganz pragmatisch. Sie gründen ein Asylcafé. Trotz aller Unterschiede entsteht dabei Nähe«, kann man dem Artikel Reich und Arm verwoben entnehmen.
Viele der Flüchtlinge haben es in die Festung Europa geschafft über das Meer am Südrand der EU, dem Urlaubsparadies für viele Europäer. Das mittlerweile zu einem großen Friedhof geworden ist – denn noch nie sind so viele Menschen bei dem Versuch, nach Europa zu kommen, elendig ertrunken. Vor diesem Hintergrund irritiert auf den ersten Blick eine Artikelüberschrift, die da lautet: Das Meer der Hoffnung. Aber das ist durchaus berechtigt. Gestiftet haben die Italiener diese Hoffnung. Seit November 2013 läuft in der Straße von Sizilien der „Mare Nostrum“-Einsatz, patrouillieren Schiffe und Flugzeuge bis weit hinunter vor die libysche Küste. Es geht um einen „proaktiven Einsatz“, der darauf zielt, Schiffe in Not aufzuspüren und für die schnellstmögliche Rettung zu sorgen, durch eigene Einheiten oder per Alarmierung von Handelsschiffen in der Unglückszone.
Italiens Regierungschef Matteo Renzi bilanzierte vor der UNO-Vollversammlung:
»Zu oft … verwandle sich das Mittelmeer „in einen Friedhof“, Mare Nostrum aber habe „80.000 Menschenleben dem Friedhof Mittelmeer entrissen.«
Dieses Jahr sind schon fast 140.000 Menschen über das Meer nach Italien gekommen und Mare-Nostrum-Schiffe haben sogar mehr Flüchtlinge gerettet, als die 80.000, die Renzi in seiner Rede erwähnt hat: über 90.000. Aber auch hier wieder das Geld: Italien hatte monatelang gefordert, die EU solle sich an den Kosten für Mare Nostrum beteiligen. Denn das Rettungsprogramm kostet Rom an die 100 Millionen Euro im Jahr. Und nun soll nach Mare Nostrum „Triton“ kommen, ein neu definierter Einsatz der Europäischen Grenzagentur Frontex. Was da auf uns bzw. auf die Flüchtlinge zukommt, offenbart dieses Zitat:
»Triton: Unter diesem Namen sollen in Zukunft die Kontrolleinsätze an den europäischen Außengrenzen vor Italien und Malta laufen, mit einem weit bescheideneren Budget von 36 Millionen Euro. Doch Frontex-Chef Gil Arias-Fernández stellt sofort klar, dass „Triton Mare Nostrum nicht ersetzen wird“ – schlicht, weil Frontex keinen humanitären Auftrag habe: „Wir sind keine Agentur, die sich mit der Lebensrettung auf hoher See befasst“, resümiert Arias trocken.«
Eigentlich müsste Mare Nostrum unbedingt erhalten bleiben, denn das Sterben im Mittelmeer geht weiter: »Allein in der Woche vom 10. zum 15. September kamen bei drei Unglücken über 700 Menschen ums Leben.«
Und der „Nachschub“ ist leider sicher. Am Beispiel Eritrea verdeutlicht das Dominic Johnson in seinem Beitrag Der Horror in der Wüste: »Wer es aus dem ostafrikanischen Land nach Deutschland schafft, hat oft Unvorstellbares hinter sich.« Und das ist auch ein Thema für uns in Deutschland: Aus keinem Land nimmt die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland so stark zu wie aus Eritrea: 7.898 Erstanträge in den ersten acht Monaten dieses Jahres, verglichen mit 703 im Vorjahreszeitraum. Nach Syrien und Serbien stehen Menschen aus Eritrea bereits auf Platz 3 der Länder, aus denen die meisten Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und ein Ende ist nicht abzusehen, denn kaum ein Land bietet seinen Bürgern so viele gute Fluchtgründe wie Eritrea. Weitere Details in dem Artikel.
Und Serbien wurde ja schon erwähnt – also eines dieser Länder in unserer Nähe, das vor kurzem zu einem „sicheren Staat“ erklärt worden ist, um die Menschen von dort schnell wieder loswerden zu können. Dazu der Beitrag An einem gottverlassenen Ort: »In einer Wellblechsiedlung nahe Belgrad wohnt ein junger Rom mit seiner Familie. Zwei Mal war er schon in Deutschland, seine Tochter ist dort zur Schule gegangen. Vor einigen Wochen wurde die Familie abgeschoben.« Was aber nicht das Ende der Geschichte bedeuten wird, wie Andrej Ivanji seinen Artikel beendet: „Besser lebendig in Deutschland als tot in Serbien“, sagt Sajin lächelnd. Er habe noch Familie in Deutschland, er sei ein freier Mann mit einem Reisepass. Er werde sie besuchen.