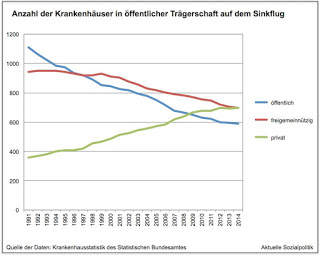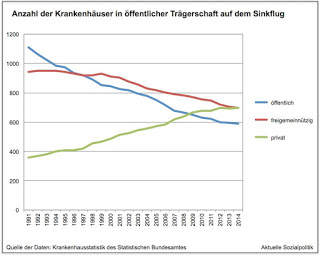Über das derzeit immer schwieriger werdende Umfeld für die kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung wurde bereits in dem Beitrag Betriebsrenten als Butter in der Sonne? Das wäre ärgerlich für die Finanzindustrie und ihre Hoffnungen auf ein Riester-Substitut. Und Betroffene erleben ihr blaues Wunder vom 21. Juni 2016 berichtet.
Und wenn über Betriebsrenten gesprochen wird, dann denken viele Menschen an die zusätzlichen Renten, die an Industriearbeiter ausgezahlt werden oder wenn man das Glück hatte, sein Erwerbsarbeitsleben bei einem der großen Unternehmen des Landes verbracht zu haben, bei denen es in aller Regel eine betrieblicher Altersvorsorge gab und gibt. Aber dieses Zubrot fürs Alter gibt es auch im öffentlichen Bereich für die Nicht-Beamten dort und bei zahlreichen Unternehmen der Sozialwirtschaft, von denen sich viele unter dem Dach der großen Kirchen bzw. ihrer Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie befinden. Und da wird man hellhörig, wenn man lesen muss: »Die Altersversorgung für 1,2 Millionen Beschäftigte der Kirche und der Caritas ist in Schieflage geraten.« So Matthias Dobrinski in seinem Artikel Katholisches Kapital. Konkret geht es um die Kirchliche Zusatzversorgungskasse KZVK mit Sitz in Köln. Sie ist die betriebliche Altersversorgung für 1,2 Millionen Beschäftigte im Dienst der katholischen Kirche oder des Sozialträgers Caritas. Derzeit beziehen 154.000 Menschen über sie eine Zusatzrente. Die KZVK ist damit eine der größten Pensionskassen in Deutschland.
»Diese Kasse hat unbestreitbar ein Problem: 2014 weist der Geschäftsbericht einen Fehlbetrag von 5,5 Milliarden Euro aus – Schuld daran ist vor allem die lange Niedrigzinsphase, unter der auch andere Versorgungskassen leiden, von denen einige tatsächlich inzwischen Leistungen kürzen mussten«, so Dobrinski in seinem Artikel, was sehr erinnert an die Ausführungen in dem Blog-Beitrag vom 21.06.2016 über die generelle Problembeschreibung die betriebliche Altersvorsorge betreffend.
Bereits im April 2016 hatte Daniel Deckers darüber in der FAZ berichtet unter der Überschrift Milliarden-Loch in Pensionskasse der katholischen Kirche über den „Sanierungsfall“ KZVK. Im Herbst 2015 hatte sich herausgestellt, dass die Bilanz der KZVK in einem Umfang von 22,5 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2014 eine Deckungslücke von 5,5 Milliarden Euro aufweist.
„Veränderte Annahmen zur langfristigen Entwicklung der Verzinsung auf den Kapitalmärkten, die sich aus der Politik der EZB ergeben“, so ein Sprecher der KZVK, hätten »eine Neubewertung der Verpflichtungen und die Bilanzierung eines Ausgleichspostens erforderlich gemacht.«
Und das kam hinzu: Im Dezember 2015 verlor die KZVK vor dem Bundesgerichtshof einen Prozess gegen mehrere Einrichtungen, die mit der Erhebung eines sogenannten Sanierungsgeldes nicht einverstanden waren (vgl. dazu den Beitrag Sanierungsgeld für die Kirchliche Zusatzversorgungskasse) . Die Kasse hatte den in der Branche durchaus üblichen Zusatzbeitrag seit dem Jahr 2002 erhoben. Das Urteil war im wahrsten Sinne teuer, denn die KZVK muss jetzt allen Dienstgebern im Raum der verfassten Kirche und der Caritas die Sanierungsgelder zuzüglich der Nettoverzinsung zurückerstatten. In Rede stehen weit mehr als eine Milliarde Euro.
»Sollte es in den kommenden Jahren nicht gelingen, die Deckungslücken zu schließen, drohen der katholischen Kirche finanzielle Verwerfungen bis hin zur Zahlungsunfähigkeit ganzer Bistümer«, so Deckers in seinem damaligen Artikel.
Nur wenige Tage später wurde dann dieser Artikel von Daniel Deckers veröffentlicht: Milliarden-Deckungslücke wächst weiter. Er bezieht sich erneut auf die Folgen des Urteils des Bundesgerichtshofs aus dem Dezember 2015:
»In der Zwischenzeit hatte die Kasse, die mittlerweile 1,1 Millionen Pflichtversicherte und annähernd 150000 Rentenempfänger aus dem Raum der verfassten Kirche und der Caritas zählt, auf diesem Weg 1,12 Milliarden Euro eingenommen. Diese Summe soll im Laufe dieses Jahres zurückgezahlt werden, und zwar allen Beteiligten einschließlich der Zinsen in Höhe von etwa 263 Millionen Euro.«
Geld fällt bekanntlich nicht vom Himmel, sondern muss auch im kirchlichen Kontext besorgt werden. »Die Erstattung des Sanierungsgeldes erfolgt aus dem Anlagevermögen der KZVK, das derzeit etwa 16 Milliarden Euro beträgt«, klärt uns Deckers auf. Die Deckungslücke der KZVK wächst damit auf etwa vier Milliarden Euro.
»Die „dauerhafte Erfüllbarkeit“ dieser Ansprüche sei nunmehr „nicht gegeben“, heißt es in einer Vorlage des Vorstands der KZVK für die Bischöfe. Die Kasse will daher noch in diesem Jahr damit beginnen, die Deckungslücke durch ein sogenanntes „Finanzierungsgeld“ zu schließen.«
Das ist natürlich eine fragile Strategie, denn nicht auszuschließen ist eine erneute Klage von betroffenen kirchlichen Unternehmen dann gegen das „Finanzierungsgeld“.
Was auf alle Fälle sicher in den Raum gestellt wird: Der »Beitrag der kirchlichen und caritativen Unternehmen von derzeit 4,8 Prozent des Bruttolohnes (wird) bis zum Jahr 2024 auf 7,1 Prozent (angehoben).«
Und dann kommt eine wichtige Einordnung der Vorgänge:
»Die 1974 eingeführte obligatorische Zusatzversorgung zeigt damit immer stärker ihr Doppelgesicht. Einerseits ist sie heute mehr denn je ein Element zur Vorsorge gegen Altersarmut sowie ein Argument zugunsten einer Beschäftigung bei einem kirchlichen Arbeitgeber, wie es beim Deutschen Caritas-Verband in Freiburg heißt. Andererseits sind die damit verbundenen Aufwendungen vor allem für diejenigen Einrichtungen eine Belastung, die im Wettbewerb mit privaten Anbietern stehen.«
Wieder zurück zu dem neuen Artikel von Matthias Drobinski. Der berichtet uns:
»Nach der Darstellung der KZVK und auch des Sekretariats der Bischofskonferenz in Bonn ist die Lage der Kasse nicht schön, aber auch nicht katastrophal: Die Kapitalanlagen beliefen sich 2015 schließlich auf 17,9 Milliarden Euro. Und wenn man schrittweise die Beiträge der Bistümer und der Caritas anhebe, komme man schon hin … Auch soll der Aufsichtsrat, in dem bislang vor allem Kirchenfunktionäre sitzen, professionalisiert werden.«
Doch seitens der Bistümer werden Zweifel vorgetragen. Es gebe Finanzdirektoren, die von einer „Bad Bank“ sprächen.
Und sie beziehen sich dabei auch auf ein Rechtsgutachten, dass die Deutsche Bischofskonferenz »schon vor drei Jahren erstellen ließ: Was passiert, wenn die KZVK die Rentenansprüche nicht mehr erwirtschaften könnte, die sie den Mitarbeitern garantiert hat? Die Antwort: Die Bistümer müssten einspringen. Dann aber wäre vor allem im Norden und Osten Deutschlands so manches Bistum faktisch pleite.«
Und Drobinski weist auf eine andere Konfliktstelle hin, wenn er schreibt:
»Hinter dem Streit verbirgt sich auch ein innerkirchlicher Nord-Süd-Konflikt: Den reichen Bistümern im Süden, Südwesten und Westen ist noch ungut in Erinnerung, wie sie einspringen mussten, als das Erzbistum Berlin faktisch zahlungsunfähig war – und wie vor allem das Erzbistum München-Freising auf den Kosten des desaströs heruntergewirtschafteten Weltbild-Verlages sitzen blieb. Und jetzt im Zweifel wieder klamme Bistümer retten?«
Fazit: Selbst für die, die einen direkten Draht nach oben haben müssten, stellen sich die gleichen (plus hausgemachte) Probleme, wie wir sie insgesamt beobachten müssen für die betriebliche Altersvorsorge.
Übrigens: Parallele Entwicklungen haben wir auch in der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes. So berichtet Thomas Öchsner in seinem Artikel Magere Zeiten für Rentner über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), mit Abstand größten Zusatzversorgungskasse in Deutschland: »Diese hat zum 1. Juni 2016 den Garantiezins für Mitglieder, die freiwillig über ihren Arbeitgeber zusätzlich einen Teil ihres Gehalts in einen Riester-Vertrag oder sozialabgabenfrei für eine spätere Betriebsrente zurücklegen, von 1,75 Prozent auf konkurrenzlos niedrige 0,25 Prozent gesenkt. „Einen solchen Vertrag zu unterschreiben, lohnt sich damit nicht mehr“, sagt der Finanzmathematiker Werner Siepe, der sich seit einem Jahrzehnt mit der VBL beschäftigt.« Es geht hier nicht um die etwa 1,9 Millionen Pflichtversicherte mit einer obligatorischen Zusatzversorgung, denn hier gibt es keinen Garantiezins, es handelt sich um eine umlagefinanzierte Zusatzversorgung. Es geht um die fast 250 000 Versicherte mit freiwillig abgeschlossenen Zusatzversorgungsverträgen. Was die Absenkung hier bedeutet, kann dieses Beispiel aufzeigen: »Ein 37 Jahre alter Angestellter, der noch Ende 2011 einen VBL-Extra-Vertrag unterschrieben hat und 30 Jahre bis zur Rente mit 67 genau 175 Euro monatlich einzahlt, hätte noch eine garantierte Zusatzrente von 617 Euro bekommen. Bei einem Neuabschluss von Juni 2016 an sind es jedoch nur noch 208 Euro. Das entspricht einem Minus von fast 70 Prozent.«
Wir dürfen gespannt sein, was aus dem Bundesarbeitsministerium in Herbst dieses Jahres an konkreten Vorschlägen kommen wird, die Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge betreffend.