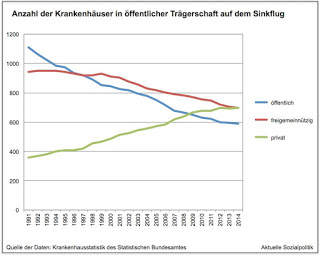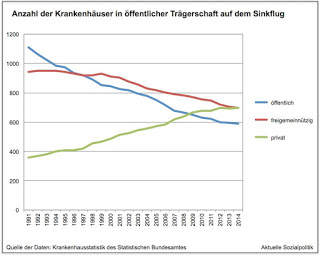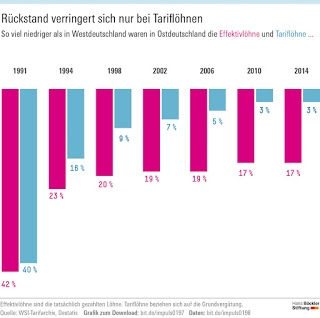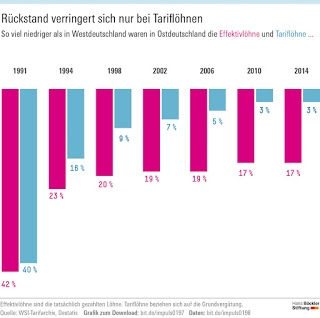Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Unternehmen gehört zu den Grundpfeilern unseres (bisherigen) Wirtschaftssystems. Da geht es nicht nur um Betriebs- oder Personalräte als Interessenvertreter der Belegschaften. Das reicht bis zur Beteiligung der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten von Unternehmen. Grundsätzlich kann und muss man davon ausgehen, dass die Mitbestimmung von der Kapitalseite als Störfaktor, als Fremdkörper wahrgenommen wird, der das Durchregieren im „eigenen“ Unternehmen erschwert oder bei manchen Dingen sogar verunmöglicht. Allerdings gibt es nicht nur von Theoretikern, sondern gerade aus der betrieblichen Praxis viele Hinweise, dass ordentliche Mitbestimmungsstrukturen selbst handfeste betriebswirtschaftliche Vorteile generieren können. Oder wie es in der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Grünen (Politischer Handlungsbedarf – 40 Jahre Unternehmensmitbestimmung in Deutschland, Bundestags-Drucksache 18/8354 vom 06.05.2016) von den Fragestellern als Vorbemerkung formuliert wurde:
»Die Vorteile der Unternehmensmitbestimmung sind vielfältig. Sie kann sich nicht nur positiv auf die Produktivität, sondern auch auf die Rentabilität und Kapitalmarktbewertung von Unternehmen auswirken … Zudem trägt sie zur guten Unternehmensführung im Sinne eines nachhaltigen sowie sozial verträglichen Wirtschaftens bei, denn sie befördert soziale Stabilität und Zusammenhalt. Durch transparente, gemeinschaftlich vereinbarte Unternehmenskonzepte entsteht Vertrauen und in der Folge eine hohe Identifikation der Beschäftigten mit dem Unternehmen. Vor allem ist die Unternehmensmitbestimmung ein wichtiger Teil unserer demokratischen Kultur.«
Das hört sich nach einer echten Erfolgsgeschichte an – aber dennoch geht die Entwicklung in eine andere Richtung. Zum einen häufen sich die Berichte über eine eigene Welt der Verhinderer von betrieblicher Mitbestimmung, eine eigene Industrie des „Union Busting“ ist entstanden (vgl. hierzu beispielsweise Werner Rügemer und Elmar Wiegand: Union-Busting in Deutschland. Die Bekämpfung von Betriebsräten und Gewerkschaften als professionelle Dienstleistung. Eine Studie der Otto Brenner Stiftung, Frankfurt/Main 2014). Und in der erwähnten Anfrage der Grünen wird ausgeführt, dass trotz der genannten Vorteile »werden die weißen Flecken der Unternehmensmitbestimmung auf der Landkarte der Bundesrepublik Deutschland immer größer, weil sich einige Unternehmen durch den geschickten Gebrauch von anerkannten Rechtsformen der Mitbestimmung entziehen. Die Unternehmen im kirchlichen Bereich verfügen über keinerlei Unternehmensmitbestimmung, weil sie im kirchlichen Arbeitsrecht nicht vorgesehen ist.«
Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat nun Daten veröffentlicht, die einen genaueren Blick auf den Vorwurf einer Flucht aus und vor der Mitbestimmung durch Rechtsformgestaltung ermöglichen (vgl. dazu auch Sebastian Sick: Mitbestimmungsfeindlicheres Klima. Unternehmen nutzen ihre Freiheiten – Arbeitnehmer werden um ihre Mitbestimmungsrechte gebracht, Düsseldorf, September 2015). Und ein detaillierterer Blick ist auch dringend notwendig, denn das für die Bundesregierung antwortende Bundesarbeitsministerium kann auf die meisten Fragen der Grünen keine Antwort geben, weil ihr (angeblich) „belastbare Daten“ fehlen. Die Auswertungen der Hans-Böckler-Stiftung zeigen hingegen konkret das Ausmaß von Mitbestimmungsvermeidung in Deutschland:
»So werden allein mehr als 800.000 Beschäftigte von Großkonzernen durch juristische Tricks um die paritätische Mitwirkung im Aufsichtsrat gebracht. Und hunderte mittelgroße Unternehmen bilden keine Aufsichtsräte mit Arbeitnehmerbeteiligung, obwohl sie nach dem sogenannten Drittelbeteiligungsgesetz dazu verpflichtet sind.«
Ende 2015 gab es insgesamt 635 paritätisch mitbestimmte Unternehmen, 2002 waren es noch 767. Paritätische Mitbestimmung sieht das Gesetz für Kapitalgesellschaften mit mindestens 2.000 Beschäftigten in Deutschland vor. Hinzu kamen etwa 1.500 Unternehmen, die mehr als 500 Beschäftigte und eine Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat hatten.
Wie muss man sich nun die angesprochenen Umgehungsstrategien praktisch vorstellen? Erläutert wird das am Beispiel von Aldi:
»Die rechtlich unabhängigen Unternehmen Aldi Süd und Aldi Nord, die zusammen weltweit 170.000 und deutschlandweit 66.000 Menschen beschäftigen, werden durch zwei Familienstiftungen gesteuert. Den Stiftungen können die Arbeitnehmer aber nicht zugerechnet werden, weil diese vom Mitbestimmungsgesetz nicht erfasst werden. Daher kommen sie auch nicht als „herrschende Unternehmen“ in Betracht, die einen mitbestimmten Aufsichtsrat bilden müssen. Unterhalb der Stiftungsebene operieren verschiedene Regionalgesellschaften, die gerade so groß sind, dass sie die Schwelle von 2.000 Mitarbeitern für die Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes nicht überschreiten. Die gewählte Form der GmbH & Co. KG stellt zugleich sicher, dass es auch keine Drittelbeteiligung gibt, weil diese Unternehmensart vom Gesetz ausgenommen ist. Auf diese Weise werde den Aldi-Beschäftigten komplett ihr Recht auf unternehmerische Mitbestimmung vorenthalten, erklärt der Unternehmensrechtler Sick.«
Eine weitere Möglichkeit, sich der Mitbestimmung zu entziehen, bietet die Europäische Aktiengesellschaft (SE). Die Praxis zeige, dass Unternehmen regelmäßig kurz vor Erreichen der Schwellenwerte von 500 Mitarbeitern für die Drittelbeteiligung oder 2.000 für die 1976er-Mitbestimmung zur SE umgewandelt werden.
Eine weitere Variante geht so:
»Auch Konstruktionen mit ausländischen Rechtsformen wie beispielsweise die Ltd. & Co. KG können zur Umgehung von Arbeitnehmerrechten instrumentalisiert werden. Grund: Die deutschen Mitbestimmungsgesetze stammen aus einer Zeit, als die weitgehende europäische Niederlassungsfreiheit noch nicht absehbar war. Deshalb beziehen sich die Vorschriften in ihrem Wortlaut auf Unternehmen in deutscher Rechtsform. Kombinieren Firmen deutsche und ausländische Rechtsformen, fallen sie nach herrschender Meinung nicht mehr unter das Mitbestimmungsgesetz. Das ist nach europäischem Recht auch Firmen möglich, die ihren Sitz und den Schwerpunkt ihrer Geschäfte in Deutschland haben.«
Und immer wieder der Einzelhandel, über den auch hier bereits viele Beiträge hinsichtlich der sich verschlechternden Arbeitsbedingungen verfasst wurden:
»Eine besondere Häufung von Unternehmen, die sich der paritätischen Mitbestimmung durch Ausnutzen von Rechtslücken entziehen, konstatieren die Fachleute der Stiftung im Einzelhandel … In den 21 Einzelhandelskonzernen, die sich der Mitbestimmung über Rechtslücken entziehen, würden rund 400.000 Arbeitnehmer im Inland von der Mitwirkung im Aufsichtsrat ausgeschlossen. Zu diesen Konzernen gehören unter anderem Aldi, Norma, Edeka, die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland, Netto, C&A, H&M, Primark, Zara, Müller-Drogeriemärkte, Bauhaus, Zalando und Deichmann.«
Wird man angesichts dieser Fakten auf Abhilfe seitens der Bundesregierung hoffen können? Wohl kaum. So berichtet Detlef Esslinger in seinem Artikel Arbeitnehmer außen vor von dem Heilgen Gral der Großen Koalition, den Koalitionsvertrag und man ahnt schon, was kommt:
»“Handlungsdruck“ gibt es bei dem Thema auch laut Nahles. Das Wort gebrauchte sie, als sie im April bei der Böckler-Stiftung zu Gast war. Weiter sagte sie, Gesetzeslücken müssten geschlossen werden. Eine Überarbeitung des Mitbestimmungsrechts sieht der Koalitionsvertrag allerdings nicht vor. Dem Vernehmen nach sieht Nahles daher wenig Chancen, bis zur Bundestagswahl 2017 auf den „Handlungsdruck“ zu reagieren.«
Könnte man denn überhaupt etwas tun, wenn man denn wollen wollte?
Dazu schreibt die Hans-Böckler-Stiftung:
»Der Gesetzgeber hat nach Ansicht der Stiftungsexperten viele Möglichkeiten, der Mitbestimmung Geltung zu verschaffen. Nach Einschätzung der Fachleute ist der gesetzgeberische Aufwand eher gering. Sie empfehlen drei zentrale Reformen:
- Im Drittelbeteiligungsgesetz müsse die Konzernregelung analog des Mitbestimmungsgesetzes eingeführt werden. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen dann dem herrschenden Unternehmen zugerechnet werden. Klarstellung sei bei der Rechtsform GmbH & Co. KG notwendig, sie sollte in das Drittelbeteiligungsgesetz aufgenommen werden.
- Ebenso wichtig sei es, auszuschließen, dass die Wahl einer ausländischen Rechtsform die Mitbestimmung aushebeln kann. Es gelte sicherzustellen, dass alle Unternehmen ab 500 Beschäftigten die Mitbestimmungsgesetze anwenden müssen.
- Im Beteiligungsgesetz der Europäischen Gesellschaft (SE) müsse klargestellt werden, dass die Anzahl der Beschäftigten in Deutschland entscheidend ist und bei entsprechendem Personalaufbau eine Beteiligungsvereinbarung neu verhandelt werden muss. Als Orientierung für die Mitbestimmung nennen die Fachleute die deutschen Schwellenwerte von 500/1000/2000 Beschäftigten.«
Aber wie gesagt, im Koalitionsvertrag steht davon nichts, also wird da auch bis 2017 nichts passieren.
Nun könnte man das fast schon für ein Luxusproblem in Deutschland halten, wenn man sich mit dem Beitrag Im Windschatten der Krise: Gewerkschaftsrechte europaweit in Bedrängnis von Sandra Breitender und Wolfgang Greif befasst.
»Seit Beginn der Finanzmarkt-und Wirtschaftskrise gehen Regierungen in immer mehr Ländern Europas daran, im Zuge vermeintlicher „Krisenlösungspolitiken“ Gewerkschaftsrechte empfindlich einzuschränken«, berichten die beiden Autoren.
Sie beziehen sich zum einen auf »Veröffentlichungen der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, in welchen ein „beschäftigungsförderndes“ Bündel an Maßnahmen empfohlen wird, das unter anderem auch mit folgenden „tarifpolitischen Giftzähnen“ bestückt war:
- Senkung gesetzlicher und kollektivvertraglich festgelegter Mindestlöhne
- Reduzierung der Kollektivvertragsbindung
- Einschränkung der Allgemeinverbindlichkeit von Kollektivverträgen
- Dezentralisierung der Verhandlungsebenen bei der Lohnfindung
- Abschaffung automatischer Lohnindexierungen
- Schwächung der Regelungen zur Günstigkeit übergeordneter Vertragsebenen
- Erweiterung der Möglichkeit zur betrieblichen Abweichung von Flächenkollektivverträgen
- Reduzierung rechtlicher Unterstützung gewerkschaftlicher Lohnsetzungsmacht
In Summe zielen diese Empfehlungen der EU-Kommission auf eine radikale Dezentralisierung der Lohn- und Gehaltsfindung, die ohne substantielle Schwächung gewerkschaftlicher Macht nicht gelingen kann.«
Sie beschreiben dann im weiteren Verlauf ihres Beitrags die erkennbaren Entwicklungen in unterschiedlichen Regionen der EU. In ihrem Fazit bilanzieren sie:
»Die neoliberale Ideologie hat sich jedenfalls soweit durchgesetzt, dass Gewerkschaften in weiten Kreisen der herrschenden Eliten als Hemmnis des Aufschwungs und als hinderlich für die Krisenbewältigung gesehen werden. Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise wird offensichtlich dazu genutzt, all das an Strukturreformen durchzusetzen, was jahrzehntelang von wirtschaftsliberalen Kreisen zwar gewünscht, unter „normalen“ Verhältnissen jedoch nicht durchsetzbar war.«
Das hört sich nicht nur bedrohlich an. Das ist es auch.