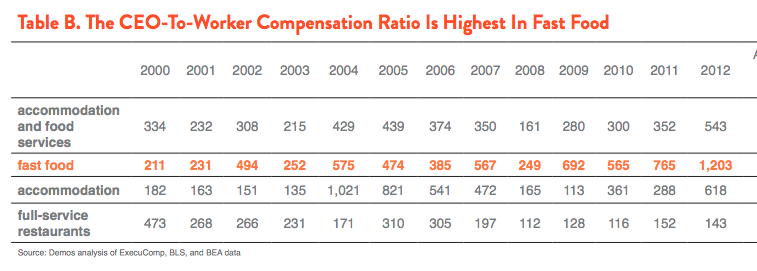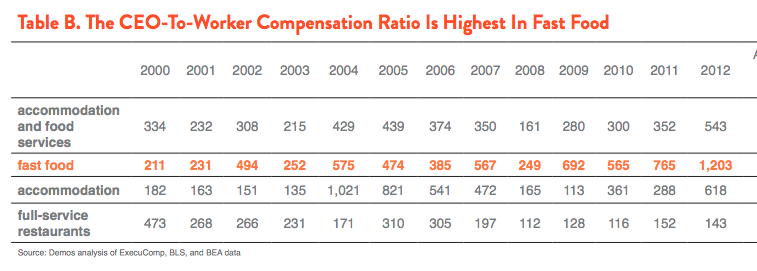Vivantes, der Krankenhauskonzern des Landes Berlin, will Hunderte Mitarbeiter ausgliedern, um keine Tariflöhne mehr zahlen zu müssen, berichtet Thomas Gerlach in seinem Artikel Umstrittener Diätplan. Und Hannes Heine sekundiert diese Berichterstattung unter der Überschrift Proteste gegen den Vivantes-Sparkurs. Viele der fast 15.000 Vivantes-Mitarbeiter fürchten sich verständlicherweise vor Lohndumping im Zuge des anstehenden Konzernumbaus, der einem bekannten Muster folgen soll: »Der landeseigene Krankenhauskonzern will sparen und plant eine weitere Ausgliederung von Arbeitsbereichen. Alle therapeutischen Dienste sollen in eine noch zu gründende Tochtergesellschaft ausgelagert werden. Dasselbe droht den Mitarbeitern in den Bereichen Facility Management, Einkauf und Logistik sowie beim Patientenbegleitservice«, so Gerlach in seinem Artikel. Die Zielsetzung dieser Maßnahme ist simpel: Bei Neueinstellungen würde der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD) keine Anwendung mehr finden.
Die Vivantes-Sprecherin Kristina Tschenett wird dementsprechend mit den Worten zitiert: „Zweck der konzerneigenen Tochtergesellschaft ist es daher, bei Neueinstellungen eine branchenübliche Vergütung zu zahlen“ – und die „marktüblichen Löhne“ liegen deutlich unter dem aktuellen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TvöD). Der geplante Konzernumbau folgt dem Muster einer Aufspaltung in Stamm- und „Randbelegschaft“: »Ärzte und Pflegekräfte bilden künftig die Stammbelegschaft. Ergo- und Physiotherapeuten, Wachleute sowie Reinigungskräfte aber sollen in Tochterfirmen arbeiten. Dort würde bald weniger gezahlt als bislang«, so Heine. Besonders aufgebracht sind die Beschäftigten – darunter Ergotherapeuten, Logopäden, Physio- und Musiktherapeuten -, weil sie schon in den vergangenen Jahren einen Lohnverzicht hingenommen haben. Die Beschäftigten bringen in einem offenen Brief das zum Ausdruck, was das landeseigene Unternehmen hier machen will: Tarifflucht. Von den aktuellen Plänen würden etwa 800 Mitarbeiter betreffen, schätzt die Gewerkschaft Ver.di Berlin-Brandenburg. »Perspektivisch könnte Vivantes jedoch alle Mitarbeiter in neue oder bestehende Tochtergesellschaften auslagern, die nicht zu den Kernbereichen Ärzte, Pflegepersonal und Funktionsdienste, wie etwa Röntgen und MRT, gehörten. Dann würden bis zu 6.000 der etwa 15.000 Beschäftigten aus dem TVÖD herausfallen.«
Der Hintergrund aus Sicht des Unternehmens: Viele Behandlungen werden nicht ausreichend von den Krankenkassen vergütet, Vivantes muss zudem marode Gebäude sanieren. Der Konzern benötige jährlich zusätzlich 40 Millionen Euro vom Land, um den Investitionsstau aufzulösen, die er offensichtlich nicht bekommt und die man sich nun teilweise bei den eigenen Beschäftigten holen will. Nach Angaben der Berliner Krankenhausgesellschaft werden für alle Berliner Kliniken Investitionsmittel von mindestens 140 Millionen Euro jährlich benötigt, 2014 gibt Berlin aber nur rund 70 Millionen in das System. Für 2015 sind 77 Millionen Euro im Doppelhaushalt eingeplant.
»Knapp 70 Prozent der Ausgaben entfielen auf Personalkosten, und mit den jüngsten Tarifsteigerungen würden die Kosten deutlich schneller steigen als die Einnahmen aus den Fallpauschalen der Krankenkassen – also die Summe, die diese für die Behandlungen von Patienten zahlen«, so Gerlach mit Bezug auf die Argumentation der Unternehmensführung.
Fazit: Eine doppelte Unterfinanzierung der Krankenhäuser in Verbindung mit einem strukturellen Problem personenbezogener Dienstleistungen schlagen hier wie im Lehrbuch zu: Die doppelte Unterfinanzierung der Kliniken resultiert zum einen aus der Systematik des Fallpauschalensystems, die besonders problematisch ist für Häuser der Maximalversorgung bzw. für die Kliniken, die eine breite Angebotspalette vorhalten müssen und die sich nicht auf lukrative Felder innerhalb des Systems spezialisieren können, wo man tatsächlich hohe Margen erwirtschaften kann. Hinzu kommt die seit Jahren wirkende zweite Unterfinanzierung, die aus der dualen Krankenhausfinanzierung resultiert, denn für die Investitionen sind – eigentlich – die Länder zuständig und die geben schlichtweg zu wenig Geld in die Krankenhauslandschaft, so dass sich ein veritabler Investitionsstau über die letzten Jahre aufgebaut hat – im zweistelligen Milliardenbereich.
Hinzu kommt ein generelles Strukturproblem personenbezogener Dienstleistungen, die – wie die Krankenhausbehandlung, aber man denke hier auch an die Altenpflege sowie die meisten sozialen Dienstleistungen – am Tropf der öffentlichen oder parafiskalischen Finanzierung hängen, also auf Steuer- und/oder Beitragsmittel angewiesen sind. Sie sind konfrontiert mit dem, was die Ökonomen „administrierte Preise“ nennen, also beispielsweise Fallpauschalen oder Pflegesätze. Und deren Anpassung folgt oftmals einer Budgetlogik (beispielsweise wird die Budgetanhebung begrenzt auf den Anstieg der eigenen Beitragseinnahmen), die dann Probleme verursacht, wenn der tatsächliche Kostenanstieg darüber liegt. Und wenn bei einem Personalkostenanteil an den Gesamtkosten von 70% und mehr die Löhne z.B. um 3 Prozent erhöht werden, die Fallpauschalen oder die Pflegesätze aber nur um 1 Prozent, dann kann der betroffenen Anbieter die Lücke nur durch Produktivitätssteigerungen aufzufangen versuchen, was allerdings in Bereichen wie der Pflege schwer oder gar nicht möglich ist oder wenn man es denn tut, in dem endet, was als „Pflegenotstand“ skandalisiert wird. Wenn er also den Weg der Produktivitätssteigerung nicht gehen kann, dann verbleibt dem Anbieter nur die Option, bei den Personalkosten eine Kostensenkung zu realisieren, beispielsweise wie bei Vivantes durch Tarifflucht.
Nun wird der eine oder die andere sagen: So ist das eben im Bereich der sozialen Dienstleistungen, die am Tropf der öffentlichen Mittel hängen. In der „freien“ Wirtschaft hingegen sei vieles anders. Also werfen wir einen Blick in die „schöne Welt“ der Industrie.
Auslaufmodell Festanstellung? Diese Frage wirft Christoph Ruhkamp in seinem Artikel auf – und meint damit nicht irgendwelche Underdogs des Arbeitsmarktes, sondern berichtet über eine Gruppe, die man üblicherweise nicht mit diesem Thema in Verbindung bringen würde, sondern die im Mittelpunkt der Debatte über einen (angeblichen) Fachkräftemangel stand und steht: Ingenieure. Angesichts der seit Jahren schon beobachtbaren Entwicklung einer immer stärkeren Nutzung von (outgesourcten) Werk- und Dienstverträgen ist das für die, die sich mit der Materie intensiver beschäftigen, keine Überraschung, sondern die logische Fortführung eines seit langem laufenden Trends.
»Schöne digitale Arbeitswelt: Wenige Ingenieure arbeiten mit Tausenden freien Entwicklern zusammen. Das hat Folgen für die Arbeitswelt«, so Ruhkamp. Beobachtet wird eine Zunahme der Zahl an außerhalb der klassischen Unternehmen arbeitenden Crowdworkern, also an Menschen, die ihre Arbeitsleistung über Internetplattformen erbringen. Wieder einmal ist die Automobilindustrie ganz vorne dabei: »Der amerikanische Kleinserienspezialist Local Motors beschäftigt nur 100 Festangestellte. Ihnen stehen 40.000 externe Entwickler gegenüber, die für das Unternehmen arbeiten.«
Partner von Local Motors ist übrigens BMW. Erwähnt werden die auch aus anderen Artikeln bekannten Beispiele:
IBM »führte für seine Abteilung Anwendungsentwicklung ein Tool namens „Liquid“ ein. Damit werden Projekte in kleine Arbeitseinheiten aufgeteilt – und anschließend weltweit an die am wenigsten verlangenden Programmierer vergeben, sowohl konzernintern als auch an Freelancer. Die Folge: Hochqualifizierte in aller Welt stehen im direkten Wettbewerb zueinander.«
»Der Internetkonzern Amazon hat einen Marktplatz für Gelegenheitsarbeiten namens Mechanical Turk eingeführt, auf dem die „Mechanical Turker“ gerade einmal 1,25 Dollar in der Stunde verdienen. Sechzig Prozent der digitalen Fließbandarbeiter geben an, dass ihre Arbeit auf der Plattform ihre einzige Einkommensquelle ist. Die Details der Arbeitsverhältnisse werden einfach durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattformen geregelt.«
Aber der Beitrag von Ruhkamp verweist auch darauf, dass es Gestaltungsversuche dieser Entwicklung gibt, was deshalb von Bedeutung ist, weil sie von den Betroffenen nicht nur negativ wahrgenommen wird, sondern oftmals darauf hingewiesen wird, dass man gerne mehr Zeit- und Ortssouveränität in Anspruch nehmen möchte: »Knapp die Hälfte der Befragten aus Forschung und Entwicklung sagten, dass sie gerne einen Teil ihrer regulären Arbeit von zu Hause aus erledigen würden. Unter den Akademikern seien es laut der Beschäftigtenbefragung der IG Metall sogar 55 Prozent.« Aber das muss gestaltet werden. Vor allem brauchen die Beschäftigten das »Recht, nach Hochphasen der Arbeit auch zurückzuschalten. Dass das geht, zeigen inzwischen viele Betriebsvereinbarungen und Regelungen, die Betriebsräte entwickelt und durchgesetzt haben: BMW und Bosch zählen und bezahlen neuerdings nicht mehr nur die Arbeit auf dem Firmengelände, sondern auch die unterwegs verrichtete. Trotzdem bleiben die Arbeitszeit begrenzt und der Sonntag frei. Auch VW und Daimler akzeptieren das Recht auf Abschalten.«
Dafür brauchen die Beschäftigten aber vor allem auch eine möglichst starke Gewerkschaft und dafür müssen sie sich auch selbst bewegen und sich organisieren. Genau an dieser Stelle muss man dann darauf hinweisen, dass es mit dem Organisationsgrad gerade bei den Ingenieuren und anderen vergleichbaren Berufsgruppen „bescheiden“ aussieht. Natürlich muss auch Gewerkschaft sich bewegen und ändern – aber am Ende wird der mögliche Ausgang der (Nicht)Gestaltung der Digitalisierung auch und gerade von der Bereitschaft der Betroffenen abhängen, sich kollektiv aufzustellen. Alleine – dafür braucht man keine Studien – werden sie keine Chance haben und als kleine Crowdworker im Ozean der Globalisierung enden.