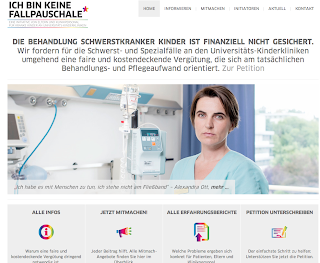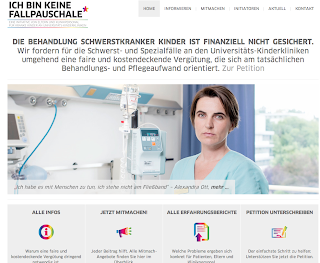Zum ersten Mal seit fast vierzig Jahren gibt es unter den 60- bis 65-Jährigen mehr ältere Arbeitnehmer als Rentner, so eine zentrale Aussage in dem Artikel „Mehr Alte auf Arbeit als Alte auf der Couch“ von Simone Schmollack, der in der taz veröffentlicht worden ist. Der Beitrag bezieht sich dabei auf das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Von den amtlichen Demografen wurden die Anteile der Erwerbstätigen und der Ruheständler in einer langen Zeitreihenbetrachtung gegenübergestellt. Herausgekommen ist eine auf den ersten Blick beeindruckende Darstellung, die sich gut einpasst in die immer wieder aufkochenden Debatte über eine (weitere) Verlängerung des Erwerbsarbeitslebens im Sinne einer Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters – man konnte das diese Tage wieder erleben, als das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung eine neue Publikation veröffentlichte: „Anleitung zum Wenigersein. Vorschlag für eine Demografiestrategie“ – darin neben vielen anderen Dingen auch: Die ungeliebte Rente mit 67 kann nur ein Einstieg sein, eine These, die auch immer wieder und gerne von anderer interessierter Seite vertreten wird: Der rasche Anstieg der Rentenbezugsdauer erfordert aus Sicht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) die Einführung der Rente mit 70 ab dem Jahr 2030, berichtet die Rheinische Post. Ein anderes Beispiel: Auch Handwerkspräsident Otto Kenztler plädiert wegen des Fachkräftemangels für eine Rente mit 70, berichtet die WirtschaftsWoche. Man könnte die Liste beliebig verlängern. Da passt die Meldung der Bevölkerungsforscher gut ins Bild, zeigt sich doch (scheinbar) eindeutig , dass wir uns bereits auf der Zielgeraden hin zu einem immer länger Arbeiten befinden.
Nun wissen alle, die sich etwas mit dem Arbeitsmarkt auskennen und nicht primär irgendwelche politischen Interessen verfolgen, dass sich die Realität wesentlich komplexer darstellt und vor allem, dass man genau darauf achten muss, was genau aus der Arbeitsmarktstatistik für die jeweilige Beweisführung herangezogen wird. Simone Schmollack spricht in dem taz-Artikel von „älteren Arbeitnehmern“ – seien wir ehrlich: Die meisten denken dann an Arbeitnehmer, die einer sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Aber schaut man sich die Abbildung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (Quelle: Erstmals seit 1974 mehr Erwerbstätige als Rentner unter den 60- bis 65-Jährigen) genau an, dann wird man sehen, dass die bereits in der Überschrift nicht von Arbeitnehmern sprechen, sondern von Erwerbstätigen. Die genannten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gehören als die größte Gruppe dazu, aber eben auch die Selbständigen, die Beamten, vor allem aber auch die geringfügig Beschäftigten, landläufig als „Minijobber“ bekannt. Und hier beginnt das Problem, wenn die Zahl der Erwerbstätigen herangezogen wird für eine Argumentation im Kontext der Renteneintrittsaltersdiskussion, denn bei der Rente sollte es um die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gehen. Also schauen wir uns einmal die Altersverteilung der in Deutschland sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an und dies im Vergleich der Jahre 2002 und 2012.
Die Altersverteilungsstruktur verdeutlicht zuerst einmal einen fundamentalen Wandlungsprozess auf dem deutschen Arbeitsmarkt: Die Verschiebung der Altersstruktur der Arbeitnehmer nach oben, allein in den hier dargestellten zehn Jahren hat sich der Altersschwerpunkt von den 30- bis 40-Jährigen verlagert in die Gruppe der 45- bis 55-Jährigen. Hierbei handelt es sich natürlich um die Gruppe der „Babyboomer“ und insofern muss man keinerlei prognostische Kompetenz haben, um sich vorstellen zu können, dass sich dieser Schwerpunkt in den nächsten zehn Jahren weiter nach rechts verschieben muss und wird – auch bedingt durch die Tatsache, dass man in den vergangenen Jahren durch so genannte „Rentenreformen“ zum einen die bislang existierenden Möglichkeiten einer Frühverrentung abgeschafft bzw. erheblich erschwert hat, zum anderen wurde aber auch durch die schrittweise Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters in Verbindung mit den erheblichen Abschlagsregelungen bei vorzeitiger Inanspruchnahme der Altersrente ein „Anreiz“ geschaffen, so lange wir nur irgendwie möglich im Job zu verbleiben. Insofern ist es allein schon aufgrund dieser veränderten Rahmenbedingungen zwingend, dass sich der Anteil der Beschäftigten in der Altersgruppe der über 60-jährigen Menschen erhöhen muss, wobei die fundamentale demografische Verschiebung hier der Haupttreiber ist. Bezogen auf die für Rentenfragen so wichtige Gruppe der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten muss man aber nicht nur die absolute Zahl der Beschäftigten sehen, sondern man sollte diese in Relation setzen zu den Menschen in diesem Alter insgesamt.
Wenn man das macht, dann erkennt man, dass Ende 2012 weniger als ein Drittel der 60 bis unter 65 Jahre alten Menschen in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung waren, wobei der Anteil hin zu den rentennahen Altersjahrgängen kontinuierlich abnimmt. Und wir reden hier über die Altersgrenze 65, noch gar nicht über die Grenze 67, geschweige denn 70.
Es ist wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass es natürlich erhebliche Veränderungen in den vergangenen Jahren gegeben hat, die zu einer auch realen Verschiebung des faktischen Renteneintrittsalters geführt haben, worauf beispielsweise der „Altersübergangs-Report“ des IAQ in seiner detaillierten Bestandsaufnahme der Rentenübergangsentwicklung ausführlich hinweist. So Martin Brussig 2012 in der Veröffentlichung „Aktuelle Entwicklungen beim Rentenzugang“ (Altersübergangs-Report 2012-02):
»Die Zahl der Menschen, die erst mit 65 Jahren in Altersrente geht, steigt seit über fünf Jahren stetig an und machte zuletzt (2010) immerhin etwa 40 Prozent der Bevölkerung in diesem Alter aus.
Ebenfalls gestiegen sind direkte Übergänge aus stabiler Beschäftigung in Altersrente. Bundesweit war ein Drittel der Neurentner/innen des Jahres 2010 in den drei Jahren unmittelbar vor Rentenbeginn versicherungspflichtig beschäftigt. Dennoch: Selbst unter westdeutschen Männern, unter denen stabile Erwerbsbiographien nach wie vor verbreitet sind, geht nicht einmal jede zweite Person aus stabiler sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in Altersrente.
Besonders stark gestiegen ist der Anteil der Altersübergänge aus stabiler Beschäftigung im Alter von 65 Jahren. Ging 2004 jede/r Sechste der stabil Beschäftigten erst mit 65 in Rente, so war es 2009 jede/r Dritte, der/die bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze beschäftigt war. Die übrigen zwei Drittel der stabil Beschäftigten nutzten die nach wie vor bestehenden vorzeitigen Rentenzugangsmöglichkeiten.«
Die eigentlichen Herausforderungen, die sich in diesem Themenfeld stellen, sind jede für sich schon enorm:
- Wie kann es gelingen, nicht nur einige, wenn auch immer mehr, bis zum regulären, also ohne Abschläge zur Folge habenden Renteneintrittsalter zu führen, sondern möglichst alle? Dies verweist auf komplexe und nur differenziert zu beantwortende Fragen vom betrieblichen Gesundheitsmanagement bis hin zu einer größeren beruflichen Flexibilität.
- Was machen wir mit denen, die aus körperlichen und/oder psychischen Gründen nicht in der Lage sein werden, bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter durchhalten zu können? Hier geht es um die Problematik rund um die Erwerbsminderungsrente. Auch hierzu hat die Arbeitsgruppe rund um den „Altersübergangs-Report“ hilfreiche Detail-Untersuchungen vorgelegt, so den Report 2012-03 „Erwerbsminderungsrenten: Strukturen, Trends und aktuelle Probleme“ von Gerhard Bäcker sowie den Report 2012-04 „Erwerbsminderung und Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit und regionale Unterschiede prägen Zugänge in Erwerbsminderungsrenten“ von Martin Brussig. Zu der aktuellen Entwicklung in diesem Bereich sowie den Handlungsoptionen vgl. auch ausführlicher die Arbeit von Johannes Steffen: Erwerbsminderungsrenten im Sinkflug. Ursachen und Handlungsoptionen, Bremen, Mai 2013.
- Wer noch tiefer und grundsätzlicher einsteigen möchte in das Minenfeld Rente, dem sei die ebenfalls aus der Feder des Rentenexperten Johannes Steffen stammende Publikation „Reformvorschläge für die Rente. Die Wirkung ausgewählter Instrumente und Maßnahmen auf die Höhe der Rente im Rentenbestand, beim Rentenzugang und für Rentenanwartschaften“ vom Januar 2013 empfohlen.
Wieder einmal lernen wir: Manchmal sagt eine Abbildung weniger, als man denken können glauben sollte.