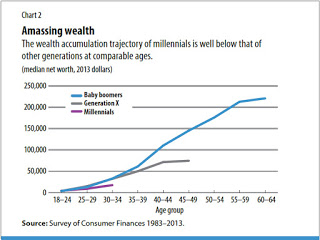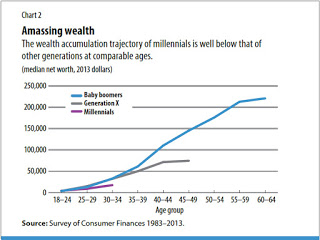Der Mindestlohn ist mal wieder Thema in der kritischen Berichterstattung.
Alleinerziehende brauchen oft ergänzende Sozialleistungen, so eine der Schlagzeilen: »Ein Vollzeitjob mit Mindestlohn reicht für viele Arbeitnehmer nicht aus, um Lebenshaltungs- und Wohnkosten zu decken. Dies gilt insbesondere für Alleinerziehende, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linken hervorgeht.« Beim aktuellen Mindestlohn von 8,84 Euro und 37,7 Stunden Arbeit pro Woche ergibt sich ein Bruttoeinkommen von 1.444 Euro. Unter Berücksichtigung von Steuern, Abgaben, Freibeträgen und Lebenshaltung bleiben einer Alleinerziehenden noch 339 Euro für die Kosten von Wohnung und Heizung. Das reicht in der Regel nicht. Bei 87 Prozent der Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften Alleinerziehender mit einem Kind liegen die von den Behörden anerkannten Wohnkosten höher, wie aus der Antwort der Bundesregierung hervorgeht. Vgl. hierzu Höhe des gesetzlichen Mindestlohns und Umfang der Sonderregelungen und Übergangsvorschriften, Bundestags-Drucksache 18/11918 vom 11.04.2017. Aber das betrifft nicht nur die Alleinerziehenden.
»Selbst für Singles in Vollzeittätigkeit, die nur den Mindestlohn erhalten, ist es mitunter schwierig, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Bei einem Bruttoeinkommen von 1444 Euro bleiben ihnen 368 Euro für das Wohnen und Heizen. Bei 39 Prozent der Bedarfsgemeinschaften Alleinstehender erkennen die Behörden höhere Wohnkosten an. Flächendeckend ist dies in Hessen, Berlin und Hamburg der Fall. Auch in Düsseldorf, im Kreis Neuss, in Bonn, Köln, Münster, Darmstadt, Frankfurt/Main, Wiesbaden und Mainz liegen die Wohnkosten so hoch, dass Vollzeit arbeitende Singles mit Mindestlohn auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen sind.«
Und dann gibt es da ja noch die Minijobs. Eine der wenigen verbliebenen (scheinbaren) Kritikpunkte der vielen Mindestlohngegner gerade aus der Ökonomenzunft bezieht sich auf den (angeblichen) massenhaften Abbau geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse aufgrund der mit dem gesetzlichen Mindestlohn seit dem 1. Januar 2015 einhergehenden Kostenerhöhung.
Hier hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit einmal genauer hingeschaut:
Philipp vom Berge und Enzo Weber (2017): Beschäftigungsanpassung nach Mindestlohneinführung: Minijobs wurden teilweise umgewandelt, aber auch zulasten anderer Stellen. IAB-Kurzbericht 11/2017, Nürnberg 2017
Die Wissenschaftler schreiben zusammenfassend zu ihren Befunden: »Um den Jahreswechsel 2014/2015 ist die Zahl der Minijobs in Deutschland deutlich gefallen. Dieser Rückgang wurde durch verstärkte Umwandlung solcher Jobs in sozial versicherungspflichtige Beschäftigung teilweise ausgeglichen. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Zahl der umgewandelten Minijobs verdoppelt. Dabei fanden Umwandlungen vermehrt bei bestimmten Personengruppen statt: Frauen, Älteren, Ostdeutschen und Beschäftigten in mittelgroßen Betrieben. Die im Zuge der Mindestlohneinführung umgewandelten Beschäftigungsverhältnisse waren bislang nicht weniger stabil als solche in der Vergangenheit.«
Apropos Minijobs. Dazu der Beitrag Schon 2016 wieder „business as usual“ bei den Minijobs von Markus Krüsemann, der über den Horizont der IAB-Studie hinausschaut: »Das im ersten Jahr nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns beobachtete deutliche Minus bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten hat offensichtlich keine Trendwende eingeläutet. Schon 2016, im zweiten Jahr mit Lohnuntergrenze war es mit den Rückgängen vorbei. Nach den jetzt vorliegenden Zahlen der Bundesagentur für Arbeit gingen die Zahlen wie schon zur Jahresmitte auch zum Ende des dritten Quartals nur noch kaum merklich zurück … Der Bestand an Beschäftigten, die nur im Minijob arbeiten, hat sich im Jahresverlauf damit kaum verändert. Dies kann als deutliches Zeichen dafür interpretiert werden, dass der 2015 erkennbare Prozess der betriebsinternen Umwandlung von geringfügiger in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (dies betraf etwa die Hälfte der abgebauten Minijobs) längst abgeschlossen ist.« Und dann kommt ein ganz wichtiger Aspekt: »Von einer Rückkehr zum „business as usual“ kann bei den im Nebenjob geringfügig Beschäftigten erst gar keine Rede sein. Ihre Zahl steigt schon seit Jahren und unbeeindruckt vom Mindestlohn an. Ende September 2016 lag das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,4 Prozent. Damit gab es fast 2,76 Millionen Beschäftigte mit einen zusätzlichen Minijob als Nebenjob, womit mal wieder ein neuer Höchststand markiert wurde.«
Aber wir wollen an dieser Stelle die vielen „enttäuschten“ Ökonomen, dass es (bisher) nicht so gekommen ist mit dem vorhergesagten „Jobkiller“ Mindestlohn, nicht alleine stehen lassen. Immer wieder gibt es Versuche, eine angebliche Pathologie des Mindestlohns für Beschäftigung zu belegen. Wie schädlich sind Mindestlöhne? So hat Norbert Häring seinen Artikel im Handelsblatt überschrieben, der – wenn auch mit einem Fragezeichen versehen – den Finger auf die Wunde legt, die von der Mainstream-Ökonomie in Deutschland so gerne diagnostiziert wird (auch wenn der Patient einfach über keine Beschwerden klagt).
»Schaden Mindestlöhne der Beschäftigung im Niedriglohnsektor? Viele Studien legen nahe, dass sogar das Gegenteil der Fall sein könnte. Nun haben Forscher einen neuen Ansatz gewählt – mit Hilfe der Bewertungsplattform Yelp«, berichtet Häring. Hintergrund der neuen Studie sind die Entwicklungen in den USA: »Der kalifornische Gesetzgeber hat jüngst beschlossen, dass der Mindestlohn bis 2022 von derzeit 10 auf 15 Dollar steigen wird. Gut zwei Fünftel der Beschäftigten in dem Staat verdienen nach Medienberichten derzeit weniger als 15 Dollar die Stunde. Eine Reihe von Städten, darunter San Francisco, hat den heftig umstrittenen Mindestlohn von 15 Dollar schon vorher beschlossen.«
Vor diesem Hintergrund fällt eine Studie aus der Elite-Uni Harvard, derzufolge höhere Mindestlöhne zu deutlich mehr Restaurantschließungen führen, den Mindestlohnkritikern wie ein Geschenk des Himmels vor die Füße. Da wird dann auch sofort von einer „Schock-Studie aus Harvard“ gesprochen (so beispielsweise Tyler Durden: Harvard ‚Shock‘ Study: Each $1 Minimum Wage Hike Causes 4-10% Increase In Restaurant Failures). Die (noch) Trump-nahe Nachrichten-Website Breitbart fand ihren ganz eigenen Zugang: „Mindestlohnerhöhungen drängen Nicht-Eliten-Restaurants aus dem Geschäft“ titelte man dort (vgl. dazu auch Härings Blog-Beitrag Breitbart und Zero-Hedge begeistern sich für windige Harvard-Studie gegen den kalifornischen Mindestlohn von 15 Dollar).
Um was für eine Studie geht es hier eigentlich?
Urheber der Aufregung ist das amerikanische Ökonomenehepaar Dara Lee Luca und Michael Luca. Dara Lee arbeitet für das Institut Mathematica Policy Research, Michael lehrt an der Harvard Business School. Beide sind auf datengetriebene Politikanalyse spezialisiert. Für ihre Mindestlohnstudie kooperierten sie mit der Bewertungsplattform Yelp, berichtet Norbert Häring.
Um ihren Ansatz zu verstehen, muss man wissen, dass die US-amerikanische Debatte über Mindestlöhne stark beeinflusst wurde von David Card und Alan B. Krueger und ihren Studien sowie den Anleihen, die bei ihnen gemacht wurden:
»1994 und 2000 veröffentlichten sie Studien zur Beschäftigungsentwicklung in Fast-Food-Restaurants der benachbarten Bundesstaaten Pennsylvania und New Jersey, nachdem in New Jersey der Mindestlohn erhöht worden war. 2010 folgte eine Studie von Dube, Lester und Reich, die den gleichen Ansatz auf viele Paare von benachbarten Kreisen in verschiedenen Bundesstaaten anwandte. In allen Studien war das Ergebnis, dass ein höherer Mindestlohn nicht zu Beschäftigungsverlusten, sondern eher zu Beschäftigungsgewinnen in dieser Niedriglohnbranche führt.«
Das Ökonomenpaar Luca hat mit Blick auf die beweisführende Branche der Fast-Food-Restaurants einen anderen Ansatz gewählt. Hier ist ihr Papier im Original:
Dara Lee und Luca Michael Luca (2017): Survival of the Fittest: The Impact of the Minimum Wage on Firm Exit. Working Paper 17-088, Harvard University, 2017
Sie haben sich auf der Plattform Yelp die Bewertungen, Zugänge und Abgänge von Restaurants in der Region San Francisco angeschaut. Häring zur Methode der beiden: »Dort haben verschiedene Städte unterschiedlich hohe Mindestlöhne eingeführt. Die beiden untersuchten, ob ein höherer Mindestlohn die Wahrscheinlichkeit verändert, dass ein Restaurant schließt.«
Zu den Ergebnissen der beiden schreibt Häring:
„Die Daten deuten darauf hin, dass höhere Mindestlöhne die Marktaustrittsrate von Restaurants erhöht“, schreiben die beiden. Das treffe vor allem Restaurants mit schlechten Bewertungen, die ohnehin existenzbedroht seien. Für ein Restaurant mit mittlerer Bewertung ermitteln sie eine um 14 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit des Marktaustritts, wenn der Mindestlohn um einen Dollar pro Stunde steigt. Für Restaurants in der höchsten Bewertungskategoire (5 Sterne) ist kein Einfluss festzustellen.
Also müssen wir uns doch Sorgen machen? Sind die Arbeiten von Card und Kruger widerlegt? Häring trägt die Zweifel an der neuen Studie zusammen:
- »Zur statistischen Absicherung gibt es im Studientext die Einräumung, dass das Hauptergebnis „nur in bestimmten Spezifikationen“ statistisch signifikant sei.« Bei so einer Formulierung sollte man hellhörig werden und vorsichtig bei der Übernahme der Befunde sein. Man kann das als Hinweis lesen, dass ziemlich viel mit den Daten herumprobiert wurde, bis brauchbare Ergebnisse im Sinne der Autoren herauskamen. Ein Blick in die Studie legt nahe, dass es genau so ist: »Nur ein Ergebnis bezeichnen die Autoren selbst als „robust“, dass nämlich eine Mindestlohnerhöhung schlecht bewerteten Restaurants mehr Probleme macht als gut bewerteten. Was den Gesamteffekt auf die Marktaustrittswahrscheinlichkeit angeht, sprechen sie dagegen nur von „suggestiver Evidenz“. Das ist die unterste Kategorie der Verlässlichkeit.«
- Und dann gibt es einen weiteren, methodisch schwerwiegenden Einwand gegen die angebliche „Schock-Studie“ aus Harvard. Häring formuliert den so: »Bleibt die Frage, ob die Zahl der Restaurants und Arbeitsplätze insgesamt sinkt, oder ob die frei werdenden Lokalitäten durch neue, bessere Restaurants ersetzt werden, oder schon bestehende Restaurants mehr Leute einstellen. Diese Frage kann die Studie nicht beantworten, weil die Anzahl der Beschäftigten in den Yelp-Daten nicht enthalten ist. Der wichtigste Faktor, der in der Theorie zu steigender oder stagnierender Beschäftigung durch höhere Mindestlöhne führen kann, wird also nicht geprüft.«
Das süffisante Fazit von Norbert Häring: »Die ausgehfreudigen Kalifornier müssen nicht befürchten, ihr notorisch gesundes und fades Essen künftig selbst zubereiten zu müssen.«