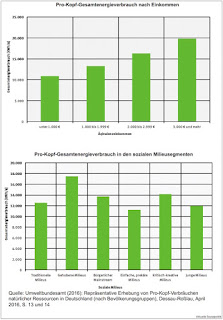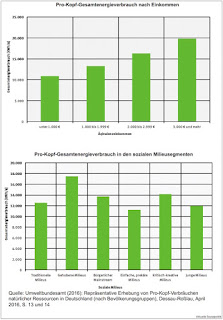Viele werden sich erinnern – nach dem beeindruckenden Durchmarsch durch die Vorwahlen und dem dann folgenden und für viele überraschenden Wahlsieg von Donald Trump im vergangenen Jahr wurde immer wieder über die Lage der abgehängten weißen Arbeiter in den USA berichtet und diskutiert, die sich mit der Wahl von Trump ein Ventil verschafft hätten. Unabhängig davon, dass auch noch eine Menge anderer Leute für ihn gestimmt haben müssen, um Trump dahin zu spülen, wo er jetzt ist – ohne Zweifel ist das alles auch eine Folge der verheerenden ökonomischen Entwicklung im mittleren Westen der USA und inmitten der weißen Arbeitnehmerschaft des Landes. Nicht, dass darüber erst seit Trump berichtet wird, vgl. aus der Vielzahl des Materials beispielsweise Die ungleichen Staaten von Amerika von Anfang 2016. Und wenn gerade in diesen Tagen eine angebliche „Vollbeschäftigung“ in den USA suggeriert wird in den Medien, sollte man nicht vergessen, wie viele arbeitslose Menschen gar nicht (mehr) erfasst werden. Vgl. dazu beispielsweise den Artikel Wo Amerika seine Arbeitslosen versteckt von Heike Buchter: »Die Invalidenrente ist einer der letzten Teile des sozialen Netzes in den USA. Vor allem gering qualifizierte Arbeitslose beantragen sie – und Ärzte haben Verständnis.« Und wie desaströs für viele Menschen aus der ehemaligen Mitte des Landes ist, konnte man auch solchen Berichten entnehmen: Nichts mehr zu verlieren: »Nirgendwo sind die Menschen in Ohio so arm wie im Athens County.
Lebensmittelausgaben versuchen, die Menschen zu versorgen. Doch beim Essen fangen die Probleme erst an.« Ohio – eine Gegend, die abgehängt worden ist und in der vor allem viele Weiße auf der Strecke geblieben sind. Von denen einige als Protestwähler für einen kurzen Moment in das Licht der öffentlichen Wahrnehmung gekommen sind. Der amerikanische Fotograf Matt Eich zeigt in seiner Reportage auf verstörende aber auch wundervolle Weise die verlorenen Menschen aus dem amerikanischen Bundesstaat Ohio. Wo einst der industrielle Motor Amerikas lief, herrschen heute Heroin, Gewalt und Zukunftslosigkeit: Last Exit to Ohio, so hat er seine Reportage überschrieben.
Es geht hier um die fatalen Folgen einer immer größer werdenden Ungleichheit und da sind uns die USA in Teilen und für viele Menschen beispielsweise in Deutschland unvorstellbar weit voraus – man denke nur an die „Selbstverständlichkeit“ einer Krankenversicherung für die allermeisten Menschen in unserem Land, auch wenn man wenig oder gar kein eigenes Einkommen hat. Die Härte des (Über-)Lebens in den USA für die Menschen mit mittleren und unteren Einkommen hat (noch) keine Entsprechung in den westeuropäischen Staaten.
Und dazu sollte es auch niemals kommen – wenn man sich allein vor Augen führt, was für einen Preis die Menschen für die Ungleichheit zu zahlen haben. Sie zahlen im wahrsten Sinne des Wortes mit ihrem Leben.
Joel Achenbach und Dan Keating berichten in der Washington Post unter der nur auf den ersten Blick reißerischen Überschrift New research identifies a ‘sea of despair’ among white, working-class Americans. Sie beziehen sich auf eine neue Arbeit von Anne Case und Angus Deaton von der Princeton University: Mortality and morbidity in the 21st century, so ist die neue Veröffentlichung überschrieben.
Case und Deaton setzen damit eine Arbeit fort, die Ende 2015 mit dieser bahnbrechenden Studie begonnen hat: Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century: »This paper documents a marked increase in the all-cause mortality of middle-aged white non-Hispanic men and women in the United States between 1999 and 2013. This change reversed decades of progress in mortality and was unique to the United States; no other rich country saw a similar turnaround. The midlife mortality reversal was confined to white non-Hispanics; black non-Hispanics and Hispanics at midlife, and those aged 65 and above in every racial and ethnic group, continued to see mortality rates fall. This increase for whites was largely accounted for by increasing death rates from drug and alcohol poisonings, suicide, and chronic liver diseases and cirrhosis. Although all education groups saw increases in mortality from suicide and poisonings, and an overall increase in external cause mortality, those with less education saw the most marked increases. Rising midlife mortality rates of white non-Hispanics were paralleled by increases in midlife morbidity. Self-reported declines in health, mental health, and ability to conduct activities of daily living, and increases in chronic pain and inability to work, as well as clinically measured deteriorations in liver function, all point to growing distress in this population.«
Wienand von Petersdorff hat die Berichterstattung und die neue Studie von Case und Deaton in der FAZ aufgegriffen: Brisante Studie: Amerikas Arbeiterklasse kollabiert. Die Lebenserwartung der Weißen in den Vereinigten Staaten, die höchstens einen Schulabschluss haben, ist dramatisch gesunken. Das Phänomen hat einen Namen: „Tod aus Hoffnungslosigkeit.“
»Die Weißen sterben demzufolge überproportional häufig an Ursachen, die Experten unter der Rubrik „Tod aus Hoffnungslosigkeit“ zusammenfassen. Zu dieser Kategorie gehören Selbstmord, Drogentod nach Überdosis oder an Krankheiten, die Alkoholmissbrauch folgen. Case und Deaton zufolge sinkt die Lebenserwartung der Gruppe seit dem Jahr 1999. Das ist eine dramatische Entwicklung angesichts der Tatsache, dass in nahezu allen Industrieländern über fast alle Bevölkerungsgruppen hinweg die Lebenserwartung stetig steigt … Für die Altersgruppe zwischen 50 und 55 Jahren haben sich die Selbstmordraten seit dem Jahr 2000 verdoppelt.«
Case und Deaton kommen zu der Schlussfolgerung, dass vor allem die mangelnde Perspektive auf ein stetiges Einkommen Menschen resignieren lasse, die höchstens einen Schulabschluss vorweisen können. »Die Wissenschaftler sehen die geringen Arbeitsmarktchancen für diese Gruppe als Ausgangspunkt für ein Bündel an Problemen, die schließlich die Menschen in die Verzweiflung stürzen.«
Und wieder werden wir Zeuge einer „Medikalisierung“ sozialer Probleme:
»In ihren Untersuchungen haben Deaton und Case auch herausgefunden, dass seit Mitte der neunziger Jahre immer mehr Leute über Schmerzen im Rücken, im Halsbereich oder in der Hüfte klagen.
Parallel dazu stieg der Absatz an Schmerzmitteln stark. Eines davon heißt Oxycontin, das den Ruf hatte, wenige Nebenwirkungen zu haben. Offenkundig aber sind sehr viele Amerikaner süchtig geworden. Deaton sagt, Oxycontin sei praktisch Heroin in Pillenform mit einem Siegel der Gesundheitsbehörde.«
Der Blick auf die nackten Daten lässt eine Menge gewichtige Fragen offen. Warum beispielsweise beschränkt sich die dramatisch negative Entwicklung auf die weißen Amerikaner – während die Afroamerikaner und der Lateinamerikaner davon nicht betroffen sind? Und die Entwicklung seit der Jahrtausendwende ist wirklich dramatisch:
»Konkret war im Jahr 1999 die Sterberate der Weißen zwischen 50 und 54 Jahren um 30 Prozent niedriger als die der Schwarzen. Im Jahr 2015 haben sich die Verhältnisse umgekehrt.«
Hinzu kommt: »Das Phänomen einer schrumpfenden Lebenserwartung beschränkt sich nach Angaben der Forscher nicht mehr auf den ländlichen Raum und Bundesstaaten, die von Deindustrialisierung besonders betroffen sind. Auch Großstädte erreicht die Entwicklung.«
Und zum Abschluss sei hier allen Kritikern am europäischen Sozialstaatsmodell das folgende Zitat ins Stammbuch geschrieben:
»Deaton weist darauf hin, dass Europa mit seinen Sozialstaaten von der Entwicklung nicht nur verschont sei: Dort wachse die Lebenserwartung der Leute ohne Hochschulabschluss sogar schneller als die der Akademiker.«