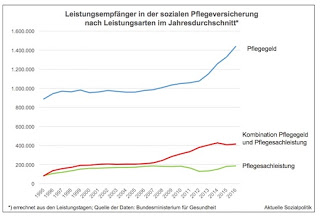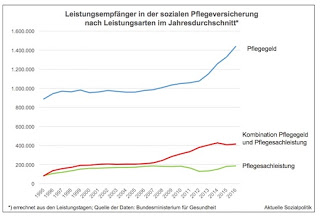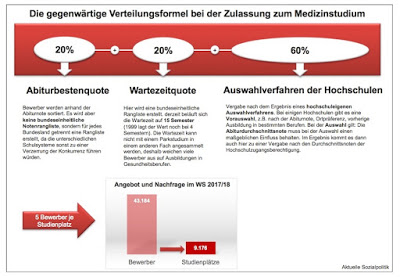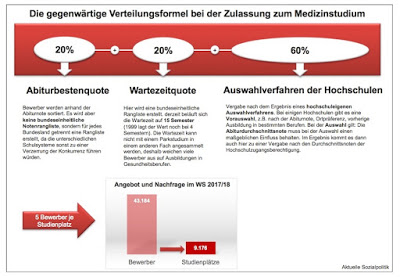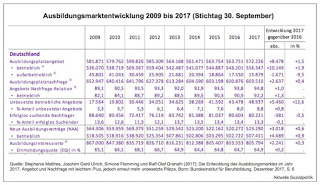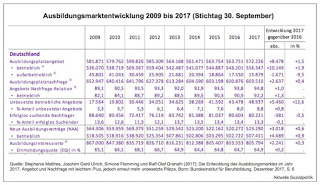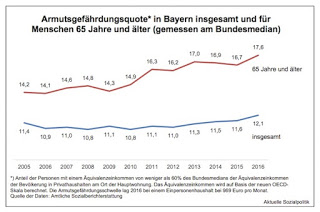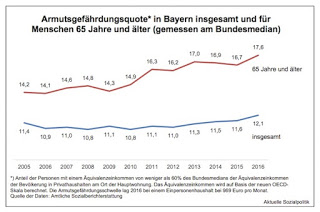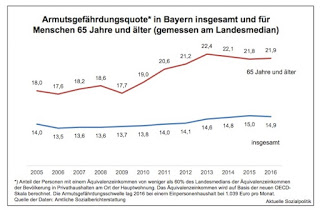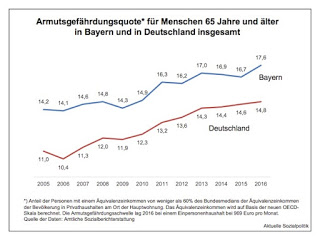Im April 2016 wurde in diesem Blog unter dieser Überschrift über Betrugsvorwürfe gegen ambulante Pflegedienste berichtet: Eine „russische“ Pflegemafia inmitten unseres Landes? Über milliardenschwere Betrugsvorwürfe gegen Pflegedienste und politische Reflexe. Darin wurden Dirk Banse und Anette Dowideit aus ihrem Artikel So funktioniert der Milliarden-Betrug der Pflege-Mafia zitiert: »Ambulante Pflege ist ein lukrativer Markt, auf dem sich viele dubiose Anbieter tummeln. Seit Jahren gibt es Berichte über osteuropäische Firmen, die Kranken- und Pflegekassen abzocken, indem sie Senioren als Pflegefälle ausgeben, die in Wahrheit noch rüstig sind.« Neben all den Fragwürdigkeiten (beispielsweise „russische“ Pflegedienste) hat die Berichterstattung den Finger auf die Wunde Abrechnungsbetrug in ganz großem Stil im Bereich der ambulanten Pflegedienste gelegt, denn es ging eben nicht „nur“ darum, dass man in Zeiten der Minutenpflege und des systembedingten Stückkostendenkens an der einen oder anderen Stelle mal mehr gebucht hat, als tatsächlich passiert ist, sondern in den damals aufgerufenen Fällen ging es um das „Erfinden“ von Pflegebedürftigen in großem Stil.
Man kann es auch so formulieren:
- Zum einen gibt es – das legen die aktuellen Ermittlungsergebnisse nahe – einen kleinen, aber hochgradig kriminellen Kern an Pflegediensten (dabei geht es um 230 von gut 14.000 Pflegediensten, was nicht heißen soll, dass die wirkliche Zahl nicht weitaus höher liegen kann, aber dennoch nur einen kleinen Teil der Dienste insgesamt berührt), die oftmals eingebettet in relativ stark geschlossene Gruppen wie den Zuwanderern aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion agieren und dort komplexe Netzwerke „auf Gegenseitigkeit“ formieren können, die es überaus schwierig machen, konkrete Verfehlungen nachzuweisen.
- Auf der anderen Seite haben wir es aber auch mit einem veritablen Systemproblem zu tun. Wenn man die Pflege in eine Minutenpflege zerlegt und diese dann zur Grundlage der Abrechnungsfähigkeit macht, dann ist es realitätsfern anzunehmen, dass die damit immer auch einhergehenden „Spielräume“ bei der Dokumentation der (angeblich) erbrachten Leistungen nicht auch mehr oder weniger stark in Anspruch nimmt, so dass wir mit einem Kontinuum fließender Übergänge zwischen partiellen Mitnahmeeffekten bis hin zu einem betrügerische Geschäftsmodell konfrontiert sind.
Und jeder erfahrene Beobachter weiß, dass schon das Aufdecken solcher Machenschaften eine mehr als komplizierte Angelegenheit ist – das wird dann noch mal potenziert durch die gerichtliche Aufarbeitung, die sich irgendwann später mal anschließt. Da erlebt man dann nicht selten Frustrationen im Angesicht des eigentlichen Vergehens (vgl. dazu aus dem Februar 2017 diesen Beitrag: Die „Pflegemafia“ … und ihre Verarbeitung durch die Rechtsprechung am Beispiel von tatbeteiligten Pflegebedürftigen).
Im Mai 2017 wurde hier ebenfalls zu diesem Thema berichtet unter der Überschrift Die „Pflegemafia“ aus dem Osten reloaded: Organisierte Kriminalität, Geschäfte an und mit alten Menschen und die nicht-triviale Frage: Was tun? Darin konnte man lesen, »die Bundesregierung wiegelt ab: »Keinen weiteren Gesetzgebungsbedarf zur Pflegebetrugsprävention sieht der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Karl Josef Laumann (CDU). Er verweist auf die Kontrollbefugnisse des MDK, die mit dem Pflegestärkungsgesetz III ausgeweitet wurden. Bei den Pflegebetrugsfällen, die jetzt ans Licht gekommen sind, handele es sich noch um Altlasten. Alles, was jetzt bekannt werde, sei auch dem geschuldet, dass die Kontrollmöglichkeiten ausgeweitet wurden.«
Das besagte Pflegestärkungsgesetz III ist ja mittlerweile in Kraft und so kann man nach einem Jahr durchaus mal hinschauen, ob es zu dem, was der Bundesgesundheitsminister angekündigt hat, gekommen ist.
Das haben die Tageszeitung WELT und der Bayerische Rundfunk getan – und das Ergebnis hört sich nicht wirklich beruhigend an. So titelt der Bayerische Rundfunk: Kampf gegen Pflegemafia: Neues Gesetz weitgehend wirkungslos:
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe wollte den Sumpf betrügerisch arbeitender Pflegedienste, die teilweise auch Verbindungen in das Milieu der Organisierten Kriminalität haben, trockenlegen. In einem Interview mit dem BR im Mai 2017 sagte Gröhe:
„Wir haben die entscheidenden Schritte, bessere Kontrolle, die Möglichkeit, auch eben Pflegediensten, die Zulassung zu entziehen, vorgenommen. Es geht jetzt darum, dies auch konsequent anzuwenden. Und da wird mit allen Beteiligten zu prüfen sein, ob weiterer Handlungsbedarf besteht.“
Die Krankenkassen haben erweiterte Kontrollbefugnisse bekommen.
»Was ist seitdem erreicht? Mitte November trafen sich rund 120 Experten von Krankenkassen, Staatsanwaltschaften und Strafverfolgungsbehörden in Berlin zum Erfahrungsaustausch. Vertraulich und hinter verschlossenen Türen. Ein Teilnehmer zog in seiner Präsentation ein vernichtendes Fazit: „Was wurde nicht erreicht? Kein wesentlicher Beitrag in der Bekämpfung von organisierter Kriminalität. Der eigentliche Anlass für die Maßnahmen des Gesetzgebers ist nicht gelöst.“ Zwar decken die Prüfer der Kassen inzwischen deutlich mehr falsche Abrechnungen auf, auch die Zahl der Hinweise steigt, wie aus einer internen Erhebung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) Niedersachsen von Anfang Dezember hervorgeht. Danach war gut ein Drittel von über 700 Prüfungen auffällig. Dabei handelt es sich aber eher um kleine Falschabrechnungen bei legal operierenden Diensten. Die großen Fische gingen so nicht ins Netz, klagt ein Vertreter einer großen Krankenkasse, der weder seinen Namen noch seine Funktion in der Presse hören oder lesen will: „Erwischt werden jetzt eigentlich nur noch die Pflegedienste, die sich blöd anstellen.“ Hinzu kommt, so Dina Michels, die bei der Krankenkasse KKH mit Sitz in Hannover für den Bereich Bekämpfung Abrechnungsbetrug zuständig ist, dass jene, die absichtlich betrügen würden, ohnehin mit doppelter Buchführung arbeiteten. Gegenüber den MDK-Prüfern würden sie ganz besonders darauf achten, dass bei Prüfungen keine Ungereimtheiten zwischen Abrechnungen, Pflege-Dokumentationen und Leistungsnachweisen vorliegen. Außerdem finden Vor-Ort-Kontrollen in der Regel nach vorheriger Anmeldung statt.«
Das LKA Nordrhein-Westfalen, dass bundesweit federführend bei diesem Thema ermittelt, wird vom BR so zitiert: „In Fällen des organisierten Pflegebetruges stoßen die Prüfer des MDK jedoch an Grenzen, wenn Abrechnung und Pflegedokumentation mit entsprechendem Aufwand so frisiert sind, dass sie nach außen hin korrekt und plausibel erscheinen.“
Die „Ärzte Zeitung“ berichtet über das Thema unter der Überschrift Pflegemafia: Organisierte Kriminalität schwer zu fassen. Dort wird darauf hingewiesen, dass der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes der Krankenkassen (MDS) und das BKA im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität konträre Strategien verfolgen.
„Durch polizeiliche Maßnahmen allein ist eine nachhaltige Bekämpfung des Kriminalitätsphänomens nicht möglich. Da auf dem Gebiet der Pflege sehr viele Akteure mitwirken, bedarf es einer breit aufgestellten Diskussion zwischen allen beteiligten Akteuren“ – mit klaren Worten wies das Bundeskriminalamt (BKA) … auf Nachfrage der „Ärzte Zeitung“ die alleinige Zuständigkeit im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität (OK) in der häuslichen Krankenpflege zurück.
Die andere Seite wird vertreten von Peter Pick, dem Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes der Krankenkassen (MDS), der aus seiner Perspektive zu begründen versucht, warum er die MDK auf Landesebene als machtlose Kontrollinstanz gegen OK-Strukturen in der Pflege sieht.
„Mit den Abrechnungsprüfungen können wir Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten feststellen und somit wichtige erste Hinweise für Ermittlungen geben. Stehen Pflegedienste jedoch im Verdacht, zur Organisierten Kriminalität zu gehören, dann kann nur polizeiliche Ermittlungsarbeit helfen. Wenn Pflegedienst, Patienten, Angehörige und vielleicht auch Ärzte und Hilfsmittellieferanten gemeinsam in betrügerischer Absicht geschlossen handeln, dann sind das Machenschaften, die nur durch Polizeiarbeit aufgedeckt werden können. Zu bedenken ist auch, dass der MDK nur dann die Abrechnung eines Versicherten prüfen kann, wenn der Betroffene damit einverstanden ist“, erläuterte Pick.
Damit weist Pick auf eine substanzielle Schwachstelle des Pflegestärkungsgesetzes III hin: »Dieses sieht zwar unangemeldete Pflegequalitätskontrollen in den Einrichtungen der Krankenpflege vor. Kontrollen in den eigenen vier Wänden sind aber zustimmungspflichtig. Im Klartext heißt das: Wer sich nicht kontrollieren lassen will. der bekommt auch keinen Besuch vom MDK. Andernfalls hat die OK Zeit, ihre Komplizen – in der Regel erhalten die Pflegebedürftigen Kick-back-Zahlungen als Belohnung für die Kooperation beim Pflegebetrug – für die Kontrolle fit zu machen. Geschützt ist die Intimsphäre nur dann nicht, wenn Polizei und Staatsanwaltschaft ein begründeter Verdacht vorliegt, der in eine Durchsuchung münden kann.«