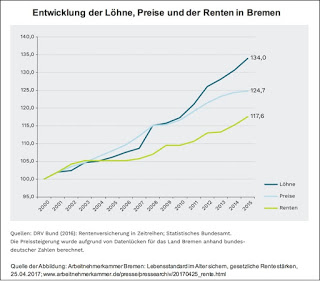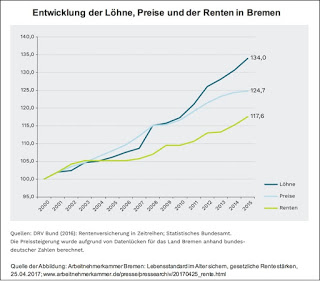Jetzt laufen sie wieder, die Gewerkschaften. Und dann werden die mehr oder weniger üblichen Reden zum Tag der Arbeit gehalten, danach gibt es mehr oder weniger leckeres Essen und das obligatorische Kulturprogramm. Die meisten Werktätigen hingegen werden wie in den Jahren zuvor den Tag nutzen wie andere gesetzliche Feiertage auch, zum Ausschlafen, Motorradfahren, Kurzurlaub machen oder was auch immer man mit seiner freien Zeit so anfängt. Same procedure as every year und dennoch immer wieder Anlass, einen Blick auf die Lage der Gewerkschaften und der vielgestaltigen Entwicklungen dahinter zu werfen. Was natürlich nur exemplarisch geleistet werden kann. Bereits vor genau einem Jahr wurde ein vergleichbarer Aufschlag an dieser Stelle versucht – vgl. dazu den Beitrag Am Tag danach. Einige kritische Gedanken zum Tag der Arbeit und der (Nicht-)Zukunft der Gewerkschaften vom 2. Mai 2016.
Das, was heute an vielen Orten in Deutschland begangen wird, ist ein über lange Zeiträume gezähmter und in der Ausformung als gesetzlicher Feiertag (und häufig mit Reden staatstragender Politiker garnierter) gleichsam staatlich legitimierter (und damit geschrumpfter) „Kampftag der Arbeiterklasse“, wobei auch die „Arbeiterklasse“ eben nicht mehr das ist, was Teile von ihr waren, als man diese Veranstaltung in die Welt gesetzt hat. Wenn wir über den heutigen „Tag der Arbeit“ sprechen, dann handelt es sich um eine Angelegenheit mit einer sehr langen Tradition. Im Juli 1889 beschloss ein internationaler Arbeiterkongress in Paris, am 1. Mai 1890 Kundgebungen für die Durchsetzung seiner Forderungen abzuhalten – ein Jahr zuvor hatte bereits der amerikanische Arbeiterbund einen entsprechenden Beschluss gefasst. Der wiederum ging auf die Ereignisse rund um den 1. Mai 1886 in den USA zurück, als es einen mehrtägigen Streik für den Achtstundentag gab, mit dem Haymarket-Massaker im Mittelpunkt. Aber man muss noch weiter zurück gehen: Seinen eigentlichen Ursprung als »Tag der Arbeit« hat der 1. Mai in der britischen Kolonie Victoria, dem heutigen Australien. Dort hatten die Arbeiter mit einem eintägigen Streik im Jahr 1856 den Achtstundenarbeitstag erkämpft.
Dass der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag geworden ist, muss mit Blick auf Deutschland durchaus mit einer verstörenden historischen Verknüpfung gesehen werden. Während Anläufe in diese Richtung in der Weimarer Republik mit Ausnahme des 1. Mai 1919 erfolglos geblieben sind, änderte sich das mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten: Der 1. Mai wurde ab 1933 durch die Nationalsozialisten zum gesetzlichen Feiertag. Das aus nur zwei Paragrafen bestehende Reichsgesetz vom 10. April 1933 benannte ihn als „Tag der nationalen Arbeit“. Am 2. Mai 1933 wurden die Gewerkschaften in Deutschland gleichgeschaltet und die Gewerkschaftshäuser gestürmt. Im Jahr 1934 wurde der 1. Mai durch eine Gesetzesnovelle zu einem „Nationalen Feiertag des deutschen Volkes“ erklärt.
Seitdem ist eine Menge Wasser den Rhein runtergeflossen, aber die Maikundgebungen gibt es immer noch, auch wenn sich ihr Charakter naturgemäß stark verändert hat. So wie auch die Themen und Herausforderungen der Gewerkschaften. Während der „kleine Volksfest-Charakter“, den die Kundgebungen bei uns mittlerweile haben, von manchen Kritikern gerissen wird, gibt es in anderen Ländern sicher viele Menschen, die dich so einen Charakter gerne wünschen würden, sind sie doch bei den Versuchen, von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch zu machen, brutalen staatlichen Übergriffen ausgesetzt, man schaue sich nur an, was in diesem Jahr den aufrechten Gewerkschaftern passiert, die in der Türkei versuchen zu demonstrieren (vgl. beispielsweise Meldungen wie diese: Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten vor).
Aber springen wir auf eine grundsätzliche Ebene und rufen die Frage auf – haben die Gewerkschaften (mit oder ohne ihren Feiertag) überhaupt noch eine relevante Zukunft? Steht nicht ein Teil der Kritik an dem ritualisierten, für manche erstarrten Umgang mit diesem Tag für eine grundsätzliche Infragestellung der Gewerkschaften an sich?
Für die Kapitalseite ist das sowieso klar und die ihnen nahestehenden Schreiber in den Zeitungen entfalten das dann entsprechend. Das geht dann bei einigen um Anerkennung dieses Lagers heischenden Vertretern sogar so tief runter, dass beispielsweise Dietrich Creutzburg seinen Kommentar in der FAZ unter diese Überschrift stellt: Das Ende der Gewerkschaften. Es gibt bekanntlich Thesen und steile Thesen. Und die Sichtweise des Redakteurs ist eindeutig eine sehr steile These, denn er behauptet doch scheinbar (?) allen Ernstes, die Arbeiterbewegung »löst sie sich gerade selbst auf. Die Verwischung zwischen grundgesetzlich geschützter Tarifautonomie und profanem Lobbyismus wird ihr Untergang.« Solche „Diagnosen“ kann man nicht wirklich weiter verfolgen.
Hingegen einen anderen Beitrag des gleichen Verfassers schon, in dem er einen Blick wirft auf eine wichtige Kennzahl einer Mitglieder-Organisation: den Organisationsgrad, also der Anteil der Arbeitnehmer, die dann auch als Mitglied in einer Gewerkschaften mitmachen (oder zumindest Beiträge zahlen): Weniger als jeder Fünfte ist Gewerkschafter, so hat er den Artikel dazu überschrieben. Das legt natürlich schon den Finger auf eine offene Wunde der Gewerkschaftsbewegung.
»Im Durchschnitt aller Branchen und Tarifbereiche waren 18,9 Prozent der Beschäftigten im Jahr 2015 Mitglied einer Gewerkschaft«, zitiert er eine Auswertung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die sich – das muss man bedenken – auf Daten aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) beziehen, also Umfrage- und nicht tatsächlichen Mitgliederdaten (vgl. dazu Adam Giza und Hagen Lesch (2017): Gewerkschaften: Verankerung ausbauen. IW-Kurzberichte 34/2017, Köln). »Insgesamt ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Vergleich zum Jahr 2011 zwar leicht gestiegen. Doch gehen die Zuwächse vor allem auf das Konto des DBB Beamtenbundes, während der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit seinen acht Branchengewerkschaften Mitglieder verloren hat.«
»Wie die Auswertung zum Organisationsgrad weiter zeigt, gehören jüngere Beschäftigte deutlich seltener einer Arbeitnehmervertretung an als ältere. In der Altersgruppe bis 40 Jahre lag der Anteil unter 14 Prozent. Allein die „Generation 50plus“ zieht den Durchschnittswert nach oben: In der Altersgruppe von 51 Jahren bis zum Ruhestand waren 25,9 Prozent der Beschäftigten Mitglied einer Gewerkschaft. Zugleich sind Frauen und Teilzeitkräfte zu deutlich geringeren Anteilen gewerkschaftlich organisiert als Männer und Vollzeitbeschäftigte. Deren Organisationsgrade liegen knapp über 20 Prozent.«
Die Gewerkschaften sind angesichts dieser Herausforderungen nicht untätig. Das IW dazu: »Die im DGB zusammengeschlossenen acht Einzelgewerkschaften versuchen schon seit Jahren, diese strukturellen Probleme zu lösen. Die Strategien reichen vom Konzept der basisdemokratischen „Mitmachgewerkschaft“, wie es die IG Metall praktiziert, bis zum „Organisieren am Konflikt“, was die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di versucht. Ergänzt wird dies durch gezielte Investitionen in Kampagnen und aktive Mitgliederwerbung. Die verschiedenen Aktivitäten zahlen sich aus. Die IG Metall verzeichnet schon seit Jahren leichte Mitgliedergewinne und ver.di hat den Mitgliederrückgang immerhin bremsen können. Besser sieht es bei den durchsetzungsstarken Berufsgewerkschaften wie der Vereinigung Cockpit, der Ärztevertretung Marburger Bund oder der Lokführergewerkschaft GDL aus. Sie verzeichnen mit ihrer berufsgruppenspezifischen Tarifpolitik schon seit Jahren eine positive Mitgliederentwicklung.«
Adam/Lesch (20917) bilanzieren in ihrer Analyse: »Trotz dieser Erfolge ist die die Verankerung der Gewerkschaften in der deutschen Arbeitnehmerschaft insgesamt schwach.« Das habe Folgen und die beiden formulieren – gleichsam aus der Perspektive der „Gegnerbeobachtung“ – einige Empfehlungen:
»In vielen Dienstleistungsbranchen und im Handwerk wirkt sich dies auch auf die Durchsetzungskraft der Gewerkschaften aus – mit enormen Auswirkungen auf das Tarifsystem. Denn wo die Gewerkschaften nicht mehr präsent und durchsetzungsfähig sind, sind auch keine Arbeitgeberverbände mit Tarifbindung als „Gegenverbände“ … mehr notwendig. Es kommt zu einem Regelungsvakuum, das vom Gesetzgeber ausgefüllt wird, zum Beispiel durch den gesetzlichen Mindestlohn oder durch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen. Einige Gewerkschaften rufen immer lautstärker den Staat zu Hilfe, um Tarifverträgen zu mehr Durchsetzungskraft zu verhelfen. Solche Rufe sind nichts anderes als ein Eingeständnis der eigenen Ohnmacht. Denn durch die staatliche Erstreckung von Tarifverträgen lässt sich allenfalls deren Geltungsbereich ausweiten. Neue Mitglieder gewinnen die Gewerkschaften dadurch aber nicht. Ohne eine bessere Verankerung in der Arbeitnehmerschaft erodiert die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie. Dies zu verhindern, ist die eigentliche Kernaufgabe der deutschen Gewerkschaften.«
Die beiden Autoren aus dem arbeitgebernahen Institut sprechen eine durchaus gewichtige strategische Grundsatzfrage an: Sollen die Gewerkschaften noch stärker auf staatliche Schützenhilfe setzen? Auch wenn derzeit die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns seitens der Gewerkschaften als „großer Erfolg“ vor sich hergetragen wird – es gab mal Zeiten, die noch gar nicht so lange zurückreichen, als die Gewerkschaften eine gesetzliche Lohnuntergrenze vehement abgelehnt haben, da es sich um einen staatlichen Eingriff in die Lohnfindung und Tarifautonomie handelt. Dass man mittlerweile eine solche Intervention des Staates begrüßt und mit Blick auf das gesamte tarifliche Regelwerk ein deutliches Mehr an staatlichen Stützrädern fordert, kann man angesichts der in bestimmten Branchen und Regionen weit verbreiteten Tariflosigkeit nachvollziehen, man kann und muss das aber immer auch diskutieren als ein Eingeständnis der fundamentalen Organisationsschwäche.
Weit aus dem Fenster gelehnt hat sich Frank Bsirske: Verdi-Chef fordert stärkere Tarifbindung, berichtet beispielsweise das Handelsblatt:
„In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass durch Neugründungen von Gesellschaften der Ausstieg aus der Tarifbindung komfortabel gelingt und Tarifflucht erleichtert wird“, sagte Bsirske. Er forderte: „Dem würde ein Riegel vorgeschoben, wenn Tarifverträge kollektiv nachwirken würden, bis sie durch einen neuen Tarifvertrag ersetzt sind.“ Zudem müsse es leichter werden, Tarifverträge bei niedriger Bindung für ganze Regionen oder Branchen für allgemeinverbindlich zu erklären.
Offensichtlich geht es hier um das Instrument der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen (vgl. dazu auch den Blog-Beitrag Von der besonderen Bedeutung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen am Beispiel der Bauwirtschaft (und darüber hinaus) vom 8. Januar 2017). Wie immer im tarif- und darüber hinausgehenden politischen Leben hat eine Medaille zwei Seiten. Es gibt gute Argumente für eine Stärkung der Tarifbindung auch über die Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) von Tarifverträgen. Gerade hier wurde in zahlreichen Beiträgen über die Zustände im Einzelhandel immer wieder darauf hingewiesen, dass die Probleme begonnen und sich beschleunigt haben, als im Jahr 2000 der bis dahin allgemeinverbindliche Tarifvertrag im Einzelhandel, an den sich alle Unternehmen halten musste, auf Druck der Arbeitgeberseite von der damaligen rot-grünen Bundesregierung aufgehoben wurde. Vgl. zu diesem möglichen Ansatz ausführlicher den Beitrag Jenseits der Einzelfälle: Die sich selbst beschleunigende Verwüstungsmechanik von abnehmender Tarifbindung im Einzelhandel, gnadenlosem Verdrängungswettbewerb und dem Hamsterrad der Personalkostenreduzierung. Plädoyer für eine Wiederherstellung der Ordnungs- und Schutzfunktion des Tarifsystems gegen die „Rutschbahn nach unten“ durch Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge vom 5. August 2015.
Aber man muss auch die Kehrseite des Ansatzes sehen: Es handelt sich um ein „Geschäft zu Lasten Dritter“, es ist ein ziemlich harter Eingriff in Vertragsfreiheit und letztendlich kann es durchaus sein, dass man mit einem gut gemeinten Ansatz das Gegenteil erreicht, also man will die Tarifbindung stärken (was man tatsächlich schafft), zugleich aber höhlt man den einen Teil der Basis, also die gewerkschaftliche Organisation, weiter aus, weil ja das Regelwerk nicht mehr wie ansonsten selbst erkämpft werden muss, sondern „von oben“ allen Beschäftigten zugeführt wird.
Man muss die Forderungen bzw. die Suche nach Möglichkeiten einer (wieder) stärkeren Tarifbindung auch sehen vor dem Hintergrund tatsächlicher Ausformungen von Tarifflucht und sich ausbreitender Tariflosigkeit gerade in Bereichen der Wirtschaft, in denen die Beschäftigung wächst. Mit Beispielen aus dieser ruhen Teilwelt des Arbeitsmarktes kann man Bibliotheken füllen. Hier nur einige wenige Impressionen aus der aktuellen Frontberichterstattung:
Beispiel Flüchtlingsbetreuung: »Sie haben sich reingehängt, um geflüchteten Menschen in Deutschland einen guten Start zu ermöglichen. Doch gedankt wird es ihnen nicht: Alle 60 Beschäftigten, die für die Johanniter Unfall-Hilfe in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Oerlinghausen tätig waren, haben zum 31. Januar ihre Stelle verloren. Der neue Betreiber – die tariflose DRK Betreuungsdienste Westfalen-Lippe gGMbH – weigerte sich, auch nur einen Beschäftigten zu übernehmen«, so der Artikel Für Flüchtlinge engagiert – und abserviert von Daniel Behruzi. Es ist ein in mehrfacher Hinsicht bezeichnendes Beispiel für die Wild-West-Methoden, mit denen es Gewerkschafter zu tun haben. Man muss sich klar machen, was hier passiert:
Die DRK Betreuungsdienste Westfalen-Lippe seien 2012 offensichtlich nur zu dem Zweck gegründet worden, bei solchen Ausschreibungen Dumpingangebote abzugeben. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) gilt dort nicht, stattdessen orientiert sich die Bezahlung am Tarifvertrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für das Hotel- und Gaststättengewerbe. »Eine Flüchtlingseinrichtung ist aber kein Hotel und auch keine Gaststätte«, betont der NGG-Geschäftsführer in der Region Detmold-Paderborn, Armin Wiese. Offensichtlich missbrauche das Rote Kreuz den NGG-Tarif, »um sich immense Wettbewerbsvorteile gegenüber tarifgebundenen Wohlfahrtsverbänden und Trägern zu verschaffen«.
Das hat handfeste Folgen hinsichtlich der daraus resultierenden Lohnunterschiede: »So verdient beispielsweise ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin mit Berufserfahrung bei der DRK-Tochter monatlich über 500 Euro weniger als im TVöD, an dem sich die Bezahlung bei den Johannitern orientiert.«
Man könnte jetzt an dieser Stelle eine Menge anmerken zu den strukturellen Problemen, die sich in diesem hinsichtlich der Beschäftigungsentwicklung so wichtigen Bereich der Gesundheits- und Sozialdienstleistungen auftun. Da wäre dann auch die gerade in der Pflege und im Kita-Bereich so problematische Tatsache zu nennen, dass die kirchlich gebundenen Arbeitgeber ihre Beschäftigte (dort als „Dienstnehmer“ bezeichnet) vom Streikrecht ausschließen können und bislang auch dürfen, was den Gewerkschaften ihr letztes, aber notwendiges Schwert aus der Hand schlägt.
Beispiel Kulturkampf amerikanischer Konzerne gegen Gewerkschaften und Tarifverträge an sich: Der seit Jahren andauernde und mittlerweile irgendwie an eine Donquichotterie erinnernde Kampf von Verdi gegen Amazon hinsichtlich einer tarifvertraglichen Rahmung der Arbeit in den Verteilzentren des Konzerns ist sicher ein prominentes Beispiel für die Probleme, in Unternehmen, die einer US-amerikanischen Firmenkultur folgen müssen, deutsche Standards durchzusetzen. Bislang beißt sich Verdi hier die Zähne aus. Aber auch in anderen Bereichen haben es selbst an sich starke Industriegewerkschaften mit Tarifverweigerungspolitik zu tun. Man nehme als aktuelles Beispiel nur die IG Metall und das amerikanische Unternehmen Tesla.
„Teslas Mission ist die Beschleunigung des weltweiten Übergangs zu nachhaltiger Energie“ steht auf der Website des Unternehmens. Der Elektroautohersteller aus Kalifornien inszeniert sich gern als sauberer Ökokonzern, der an der Mobilität der Zukunft arbeitet. Mit Elon Musk verfügt Tesla auch noch über einen charismatischen Visionär als Chef, der dieses Image nach außen vertritt – so die Einleitung des Artikels In die Zukunft lieber ohne Tarif. Es geht um einen Tarifkonflikt bei der Ende 2016 erworbenen Konzerntochter Tesla Grohmann Automation. In dem Betrieb im rheinland-pfälzischen Prüm mit 680 Mitarbeitern wird ein Tarifvertrag gefordert. Das erworbene Unternehmen in Deutschland ist für Tesla von Bedeutung: »Grohmann baut automatisierte Maschinen für die Fahrzeugproduktion. Für Tesla sind die Anlagen unter anderem bei der Fertigung eines neuen Modells wichtig, die im Sommer anlaufen soll. Bisher baute Tesla nur Fahrzeuge im oberen Preissegment. Das „Model 3“ soll mit einem kolportierten Kaufpreis von etwa 30.000 Euro für eine breite Kundschaft erschwinglich sein und könnte dem wachsendenen Markt für Elektromobilität einen Schub geben.«
Die IG Metall fordert eine Arbeitsplatzgarantie für alle Mitarbeiter und eine „gerechte Entlohnung.“ Derzeit liege das Lohnniveau um etwa 25 bis 30 Prozent unter dem Tarifgehalt. Tesla lehnt Tarifverhandlungen explizit ab. Man versucht offensichtlich, die Belegschaft mit einem Spaltpilz zu infizieren, wie man diesem Artikel entnehmen kann: Tesla fährt in Prümer Werk weiter auf hartem Kurs: Zunächst betont das Unternehmen, dass man die Bedingungen für die Beschäftigten in Prüm verbessern wolle, denn die bestehende Vergütung sei „nicht angemessen“.
»Betriebsbedingte Kündigungen bis Ende April 2022 habe man mit einer Ergänzung in den Arbeitsverträgen ausgeschlossen. Von der nächsten Abrechnung an sollen alle Mitarbeiter 150 Euro brutto mehr erhalten, hinzu komme eine Einmalzahlung von 1000 Euro netto mit der Abrechnung im April – plus Tesla-Aktien im Wert von 10 000 Euro.«
Eine Einbeziehung der Gewerkschaft wird kategorisch abgelehnt, man wolle das selbst mit den Mitarbeitern regeln. Das Ergebnis der Strategie des Unternehmens überrascht nicht: »Die Belegschaft ist gespalten: Einerseits sorgen sich viele, dass die Initiative der IG Metall dem Unternehmen schaden könne, auf der anderen Seite unterstützen etliche Mitarbeiter den Vorstoß.«
Beispiel Kontraktlogistik – unter das große Dach des Flächentarifvertrags, ansonsten weiter mit dem „Häuserkampf“: Hier werden wir mit einem ganz spannenden Fallbeispiel aus der neuen Tarifwelt konfrontiert, das zudem eine an sich starke und organisatorisch gut aufgestellte Gewerkschaft betrifft und deren Probleme verdeutlichen kann. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass die IG Metall, die in den Unternehmen der Automobilindustrie und des Maschinenbaus für die dort Beschäftigten gute Tarife hat aushandeln können. Die Reaktion der Arbeitgeberseite – zuerst die Expansion der Leiharbeit und seit einigen Jahren verstärkt die Inanspruchnahme von Werkverträgen. Mit fatalen Folgen für die vergleichsweise gut abgesicherten Stammbelegschaften, denn die Werkvertragsunternehmen haben sich immer tiefer in die Kernprozesse der Unternehmen gefressen und dort einen Verdrängungsprozess ausgelöst (vgl. dazu ausführlicher die Studie von Tim Obermeier und Stefan Sell (2016): Werkverträge entlang der Wertschöpfungskette. Zwischen unproblematischer Normalität und problematischer Instrumentalisierung, Düsseldorf 2016). Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Unternehmen der „Kontraktlogistik“ (die eigentlich „nur“ für den Transport zuständig sind bzw. waren, mittlerweile liefern sie Vorprodukte ans Fließband, stellen Bauteile für die Produktion zusammen oder mischen sogar in der Montage mit). Für die ist bzw. war eigentlich Verdi zuständig. Aber die IG Metall wollte diese Unternehmen unter ihr tarifvertragliches Dach holen – nach dem Motto, wenn die Arbeitgeber in Teilbereichen in die (günstigere) Kontraktlogistik flüchten, dann holen wir uns diese Unternehmen und die dort beschäftigten Arbeitnehmer eben wieder zurück. Das hat zu einer längeren Auseinandersetzung mit der eigentlich zuständigen Gewerkschaft verdi geführt (vgl. zu dieser Geschichte Werkverträge als echtes Problem für Betriebsräte und Gewerkschaft. Und eine „doppelte Tariffrage“ für die IG Metall vom 24. September 2015 sowie vom 14. Januar 2016 der Beitrag Wenn unterschiedlich starke Arme das Gleiche wollen, sich erst in die Haare kriegen und dann doch miteinander kooperieren. Eine Fortsetzungsgeschichte aus der Gewerkschaftswelt).
Die Antwort der IG Metall ist aus deren Sicht konsequent und hat auch für die Beschäftigten bei den Kontraktlogistikern, die man in einer ersten Phase seitens der IG Metall „erobert“ hat, ganz handfeste Verbesserungen ermöglicht, wie Frank Specht in seinem Artikel IG Metall setzt ihren „Häuserkampf“ fort berichtet:
»Tatsächlich hat die IG Metall bei großen Serviceunternehmen wie Imperial Automotive Logistics in Osnabrück, Rudolph Logistik in Wolfsburg, der Schenker AG in Hannover oder Schnellecke in Hannover Tarifverträge erkämpft. Anfang Dezember vergangenen Jahres war nach mehreren Warnstreiks eine Einigung mit dem Audi-Kontraktlogistiker Scherm in Ingolstadt gelungen. Dort steigen die Löhne nun um insgesamt vier Prozent, außerdem führt das Unternehmen ein transparentes Eingruppierungssystem analog zur Metall- und Elektroindustrie ein. Mit dem Haustarifvertrag beim Logistiker Schnellecke, der unter anderem bei Volkswagen unter Vertrag steht, hat die IG Metall nach eigenen Angaben eine Erhöhung der Stundenlöhne um 11,6 Prozent und eine Arbeitszeitverkürzung von 39 auf 37,5 Wochenstunden durchgesetzt.«
Trotz aller Erfolge auf der Ebene von einzelnen Unternehmen – das strategische Ziel der IG Metall war (und bleibt) die Einbindung der gesamten Kontraktlogistik in ein tarifliches Regelwerk. Dieser weiter gefasste Ansatz hat zwischenzeitlich einen Dämpfer erhalten: Die Gespräche mit dem Deutschen Speditions- und Logistikverband (DSLV) und dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall sind nun nach vier Verhandlungsrunden gescheitert. Nun soll der „Häuserkampf“ bei den Logistikern fortgesetzt werden.
Auf der anderen Seite muss man eben auch die primär über betriebswirtschaftlichen Druck vorangetriebenen Spaltungslinien erkennen, die es zwischen den Stammbelegschaften (bzw. genauer: deren Vertreter und den Gewerkschaften) und den Outsidern geben kann und gibt. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die schnelle Reaktion der IG Metall auf den Wunsch der Arbeitgeber, die gesetzlich mögliche massive Verlängerung der an sich auf maximal 18 Monate begrenzten Leiharbeit tarifvertraglich umzusetzen (vgl. dazu den Beitrag Wenn die Leiharbeiter in der Leiharbeit per Tarifvertrag eingemauert werden und ein schlechtes Gesetz mit gewerkschaftlicher Hilfe noch schlechter wir vom 19. April 2017).
Fazit: Schon diese wenigen Beispiele können aufzeigen, wie heterogen die Herausforderungen sind, denen sich Gewerkschaften heute ausgesetzt sehen. Wenn man ins Detail geht, dann wird erkennbar, wie groß und schwierig die Anforderungen sind, mit denen gewerkschaftliche Arbeit heute konfrontiert ist. Da helfen wohlfeile Blicke von oben nur begrenzt, auch wenn es neben der Dauerinfragestellung von Gewerkschaften aus dem Arbeitgeberlager auch positiv stimmende bzw. unterstützende Wortmeldungen gibt (vgl. beispielsweise den Beitrag Aufstieg im Niedergang von Marcel van der Linden: »Die globale Gewerkschaftsbewegung ist geschwächt. Doch es gibt Anzeichen einer Erneuerung. Arbeitskämpfe und Proteste werden seit einigen Jahren weltweit wieder häufiger.« Oder Mathias Greffrath mit Die fragile Gegenmacht: Warum die Gewerkschaften politische Ziele brauchen).
Am Ende – da beißt die Maus keinen Faden ab – wird sich die Zukunft der Gewerkschaften entscheiden an der Bereitschaft der Arbeitnehmer, sich da einzubringen, sich zu organisieren und – wenn es denn sein muss – auch zu streiken. Die (möglichen) Ergebnisse gewerkschaftlichen Tuns wird man sich von keinem anderen einkaufen können, auch nicht von einem vielleicht wohlmeinenden Staat. Das bedeutet aber auch, dass man konstatieren muss, dass es neben allen berechtigten Erwartungen an eine Modernisierung der Gewerkschaften und ihrer Strukturen und Prozesse eben auch eine gewisse Bringschuld der Arbeitnehmer gibt, die nicht – und in Zukunft immer weniger als früher – davon ausgehen können, dass andere sich um ihre Bedingungen schon irgendwie kümmern werden.