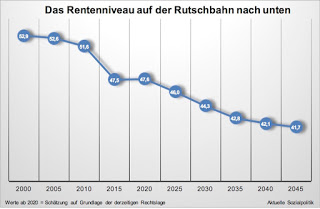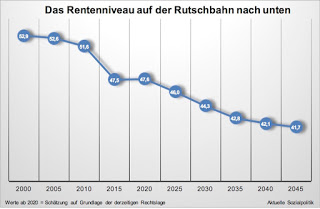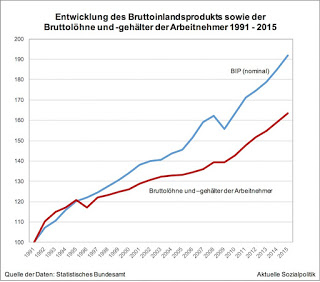Solche Nachrichten hören sich doch erfreulich an, wenn man die Situation der meisten Menschen, die eine Erwerbsminderungsrente beziehen, vor Augen hat: Plus für Arbeitsunfähige: Nahles erhöht Erwerbsminderungsrente. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will Arbeitsunfähigen mit einer milliardenschweren Reform helfen. „Wir verbessern die Erwerbsminderungsrente – und zwar bereits zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode“, so wird sie in dem Artikel zitiert. Und dann erfahren wir weiter:
„Für den Einzelnen bedeutet das im Durchschnitt eine höhere Rente um bis zu sieben Prozent – bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bedeutet dies eine weitere Verbesserung in Höhe von etwa 50 Euro. Das ist eine deutlich spürbare Verbesserung“, sagte Nahles. Das Bundeskabinett soll die Pläne am morgigen Mittwoch auf den Weg bringen.
Eine erfreulich klare Ansage der Ministerin. Aber Vorsicht ist bekanntlich die Mutter der sozialpolitischen Porzellankiste. Anders formuliert: Auf das Kleingedruckte kommt es an, so auch in diesem Fall. Und wenn man den Artikel nicht nach der erfreulich daherkommenden Botschaft zu den Akten gelegt hat, dann stößt man auf diesen Hinweis: „Unsere Reform stellt alle besser, die ab dem 1. Januar 2018 neu in eine Erwerbsminderungsrente gehen“, so die SPD-Politikerin weiter.
Und es geht hier nicht um ein paar Leute, sondern: »In Deutschland beziehen fast 1,8 Millionen Menschen eine Rente wegen einer Erwerbsminderung. Die Regierung erhöht am Mittwoch die Bezüge.« So Thomas Öchsner, der seinen Beitrag so überschrieben hat: 50 Euro plus im Monat. Er beginnt mit einer komprimierten Beschreibung, um wen und was es hier geht und wo die besonderen Probleme der Erwerbsminderungsrentner liegen:
»Sie hatten einen Unfall, sind chronisch krank oder leiden dauerhaft unter Depressionen. In Deutschland beziehen fast 1,8 Millionen Menschen eine Rente wegen einer Erwerbsminderung, weil sie zu krank zum Arbeiten sind … Müssen Menschen wegen einer Krankheit vorzeitig in den Ruhestand gehen, sind sie im Durchschnitt erst 50 Jahre alt. Ihre Rentenansprüche sind oft dürftig: Die durchschnittliche Rente wegen voller Erwerbsminderung lag Ende 2015 im Westen für Männer bei 763 Euro monatlich, für Frauen bei 729 Euro. Für sie ist das Risiko in die Armut abzurutschen besonders hoch. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung haben fast 15 Prozent der Erwerbsminderungsrentner ein so niedriges Einkommen, dass sie auf die staatliche Grundsicherung angewiesen sind. Zum Vergleich: Unter den Altersrentnern ab 65 Jahren sind dies nur drei Prozent.«
Und was soll nun wo verbessert werden? Dazu muss man die besondere Bedeutung der sogenannten Zurechnungszeit verstehen. Man kann sich das klar machen, wenn man die Information wieder aufruft, dass die Erwerbsminderungsrentner im Durchschnitt erst 50 Jahre als sind, wenn sie in den Rentenbezug gehen müssen. Die bis dahin erwirtschafteten Rentenansprüche würde in den meisten Fällen nur für kümmerliche Renten reichen. Also geht die Rentenversicherung hin und tut so, als hätten sie länger gearbeitet und Beiträge gezahlt. Bis zum Jahr 2014 hat man bei der Rentenberechnung unterstellt, die Betroffenen hätten bis 60 Jahre gearbeitet, auch wenn sie deutlich jünger sind.
Und an dieser Stelle hat es in dieser Legislaturperiode bereits schon mal Verbesserungen gegeben: Mit der Rentenreform 2014 – vor allem durch die „Rente mit 63“ und die „Mütterrente“ im kollektiven Gedächtnis geblieben – wurde die Zurechnungszeit um zwei Jahre verlängert: von 60 auf 62 Jahre. Das führte zu höheren Erwerbsminderungsrenten, allerdings nur für Rentenzugänge ab dem 1. Juli 2014 im Alter von unter 62 Jahren. Für die Bestands-Erwerbsminderungsrentner und solche Neu-Erwerbsminderungsrentner, die schon älter als 62 Jahre sind, gab es keine Leistungsverbesserungen. Außerdem bleiben beim Berechnen der Zurechnungszeit seit 1. Juli 2014 die letzten vier Jahre vor der Erwerbsminderung unberücksichtigt, wenn der Verdienst etwa aus gesundheitlichen Gründen bereits eingeschränkt war und diese Jahre den Rentenanspruch mindern würden. Für die Neurentner ab Mitte 2014 hat sich das dahingehend ausgewirkt, dass ihre monatliche Rente im Durchschnitt von 628 Euro auf 672 Euro angestiegen ist. Aber nicht für die Alt-Fälle.
Nun soll die Zurechnungszeit zwischen 2018 und 2024 schrittweise auf 65 Jahre verlängert werden. Dadurch erhöht sich die monatliche Rente in der Endphase, also 2023, um etwa 50 Euro durchschnittlich. Wohlgemerkt – am Ende der Ausweitung der Zurechnungszeit. Damit nicht zu früh die Sektkorken bei den Betroffenen knallen: Die schrittweise Anhebung der Zurechnungszeit führt beispielsweise für alle Neufälle in 2018 zu einer um 4,50 Euro höheren Rente. Pro Monat versteht sich. Aber auch hier gilt: Nur für die Rentner, die ab 2018 in das System kommen. Die anderen bekommen noch nicht einmal diesen überschaubaren Betrag zusätzlich.
Das erklärt dann auch solche Schlagzeilen: Viel Kritik an Reformvorschlägen von Andrea Nahles. Klare Worte kommen vom Sozialverband VdK: Erwerbsminderung bleibt Armutsrisiko. Schon heute sind 40 Prozent der Menschen, die in Haushalten von Erwerbsminderungsrentnern leben, von Armut bedroht – so der Sozialverband, der sich nicht auf die Zahl der Grundsicherungsempfänger/innen reduzieren lässt, sondern die offizielle Definition der Armutsgefährdung als Maßstab heranzieht. Der VdK kritisiert zum einen, dass die Anhebung der Zurechnungszeit, die bei der Rentenreform 2014 noch in einem Schritt vollzogen wurde, nunmehr über mehrere Jahre gestückelt erfolgen soll und erst 2023 abgeschlossen ist. Und zum anderen: Besonders enttäuschend ist, dass die Anhebung der Zurechnungszeit nur für Neurentner gelten soll. „Die Bundesregierung nimmt damit in Kauf, dass viele von ihnen bis ans Lebensende in der Armutsfalle sitzen und keine Chance haben, ihre Situation zu verbessern“, so wird Ulrike Mascher zitiert, die Präsidentin des VdK.
Und noch ein dritter Kritikpunkt wird vom VdK vorgetragen: Die nach Ansicht des VdK „systemwidrigen“ Rentenabschläge, denen die Erwerbsminderungsrentner weiterhin ausgesetzt sind. Mit denen werden ja auch „normale“ Altersrentner belegt, wenn sie vor dem Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters in den Ruhestand gehen. Die Begründung für diese dann lebenslangen Abschläge – bei den „normalen“ Altersrentnern können die bis zu 14,4 Prozent betragen, bei den Erwerbsminderungsrentnern sind die Abschläge auf 10,8 Prozent begrenzt – ist eine versicherungsmathematische Herleitung, denn die Betroffenen beziehen ja (theoretisch) länger die Leistung und haben (praktisch) weniger Beiträge eingezahlt in die Rentenkasse. Der VdK argumentiert an dieser Stelle: Man dürfe nicht so tun, als ob der Rentenbeginn wie bei vorgezogenen Altersrenten freiwillig erfolge. „Wer wegen Krankheit oder Behinderung seine Arbeit nicht mehr ausüben kann, hat keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Rentenbeginns und darf deshalb nicht mit denselben Abschlägen belegt werden“, so Ulrike Mascher für den VdK.
Auf den letzten Punkt geht auch Öchsner in seinem Artikel ein: Die Bundesregierung lehnt die Abschaffung der Abschläge für die Erwerbsminderungsrentner ab, mit dieser Begründung:
Sie befürchtet Ausweichreaktionen. So heißt es in der Begründung zum Gesetzesentwurf: Die Abschläge von bis zu 10,8 Prozent seien nötig. „Sie verhindern, dass die Erwerbsminderungsrente im Hinblick auf die Höhe der Abschläge als günstigere Alternative zu einer vorzeitigen Altersrente in Betracht kommt.“
Dabei kann man den Blick auf die Erwerbsminderungsrente durchaus erweitern – bzw. diese instrumentalisieren für andere Zielsetzungen. Der Vorsitzende des Sozialbeirats der Bundesregierung, Gert G. Wagner vom DIW Berlin, hat kürzlich diesen Kommentar in den Mitteilungen des Instituts veröffentlicht: Diskussionen um die Rente sind sinnvoll, denn sie erhöhen ihre Verlässlichkeit. Darin findet man diesen interessanten Passus:
»Was die Finanzierung der Renten rein rechnerisch enorm erleichtern würde, wäre – angesichts der steigenden Lebenserwartung – eine Anhebung der gesetzlichen Altersgrenze über das 67. Lebensjahr hinaus. Darüber will aber im Moment niemand reden, und zwar aus dem guten Grund, dass eine höhere Altersgrenze gesellschaftlich nur dann akzeptiert wird, wenn man die Erwerbsminderungsrente für gesundheitlich Angeschlagene deutlich verbessert. Weil dies ein ganz schwieriges Thema ist, würde sich ein Streit darüber lohnen.«
Und schon sind wir richtig tief drin im rentenpolitischen Minenfeld.
Foto: © Stefan Sell