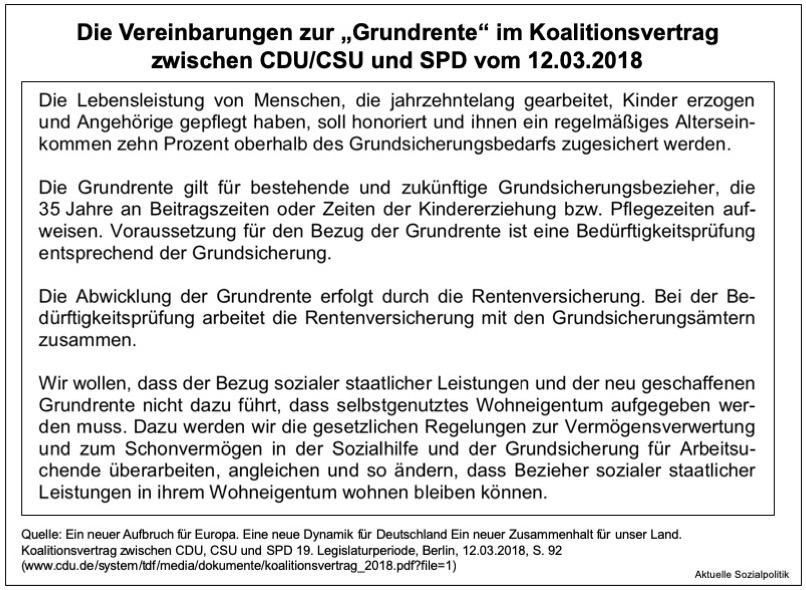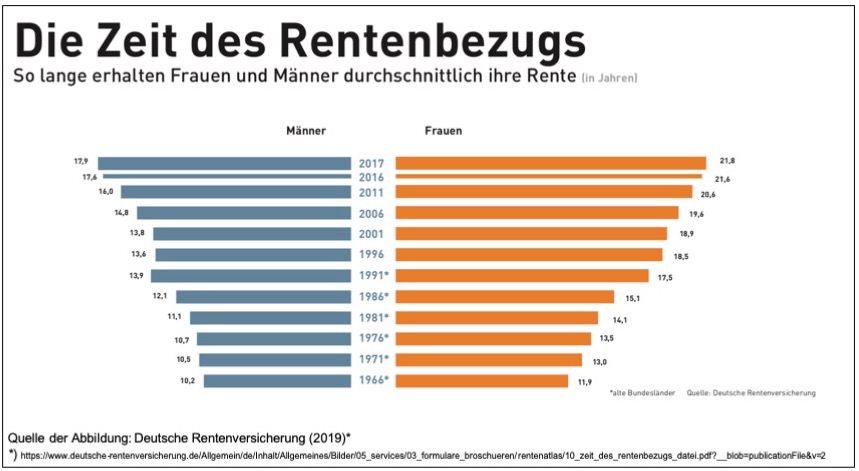Viele Frauen haben ein Problem. Also mit der Rente. Oder sie werden es bekommen, wenn sie in den Ruhestand gehen. Diese Botschaft wird seit Jahren immer wieder in den Medien verbreitet und sie ist ja auch für nicht wenige Frauen absolut zutreffend. »Die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen wird im Alter zur riesigen Kluft: Im Schnitt erhält eine Rentnerin in Deutschland 57 Prozent weniger Geld als ein Rentner. Eine Studie zeigt die Gründe«, so Florian Diekmann im März 2016 unter der Überschrift Frauen bekommen nicht mal halb so viel Rente wie Männer. Dort hat man aus der Studie Große Rentenlücke zwischen Männern und Frauen aus dem Jahr 2016 von Christina Klenner, Peter Sopp und Alexandra Wagner geschöpft. Laut der Studie »sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei der Alterssicherung so groß, dass der Begriff Rentenlücke als eine Verharmlosung erscheint.« Und weiter: »Vielmehr muss man von einer großen Rentenkluft sprechen: Laut den aktuellsten Daten von 2011 bezieht eine Frau im Schnitt nur 43 Prozent der Altersbezüge eines Mannes. Die Rentenkluft zwischen den Geschlechtern beträgt also 57 Prozent. Berücksichtigt wurden dabei alle drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland – außer der gesetzlichen Rentenversicherung also auch die betriebliche sowie die private Altersvorsorge.«
Im Jahr 2017 ging es dann weiter. Erneut meldete sich Florian Diekmann zu Wort, diesmal unter der Überschrift Frauen erhalten in Deutschland nur halb so viel Rente wie Männer. »Frauen erhalten im Schnitt 53 Prozent weniger Geld als Männer. Die Kluft wird zwar stetig kleiner – eine vollkommene Angleichung wird aber noch Jahrzehnte dauern.«
Und nun, im Jahr 2019, werden wir mit dieser Botschaft konfrontiert: Frauen bekommen ein Viertel weniger Rente. »Im Schnitt bekommt eine Frau, die mit 67 in den Ruhestand geht, im Monat 140 Euro weniger gesetzliche Rente als ein Mann, haben Forscher berechnet. Bezieht diese Frau 15 Jahre Rente, fehlten ihr im Vergleich rund 25.000 Euro«, so Hendrik Munsberg in seinem Artikel.