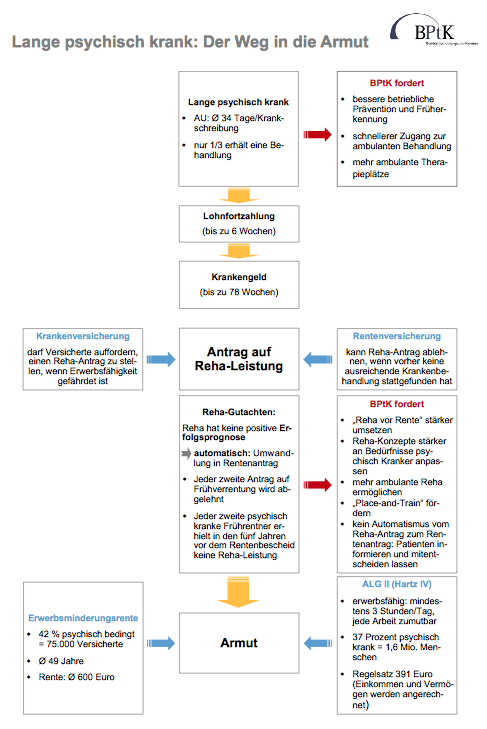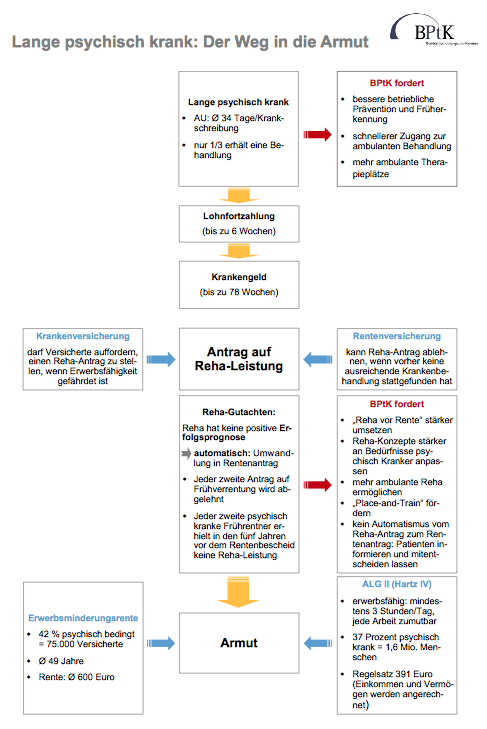Im Umfeld der Veröffentlichung des „Depressionsatlas“ der Techniker-Krankenkasse wurde wieder einmal sehr kontrovers gestritten über die Frage, ob wir in Zeiten leben, in denen die Zahl der Menschen mit einer psychischen Erkrankung kontinuierlich ansteigt, was ein erster Blick auf die Daten aus den vielen Gesundheitsberichten der Krankenkassen nahezulegen scheint – oder ob das nicht vielmehr aufgebauscht ist, eine „Modewelle“, Folge einer gesellschaftlichen Entstigmatisierung des Themas, einer veränderten Etikettierung der Ärzte, die früher anders „offiziell“ diagnostiziert haben und heute eher bereit sind, psychische Krankheiten auszuweisen bis hin zu den Effekten einer angebotsinduzierten Nachfrage. Gesellschaftspolitisch – und damit zwangsläufigerweise mehr oder weniger ideologisch – aufgeladen wird das Thema durch eine Verknüpfung mit den Veränderungen und Entwicklungen in der modernen Arbeitswelt und der implizit mitlaufenden oder auch explizit vorgetragenen These, dass die modernen Arbeitsbedingungen verantwortlich seien für den tatsächlichen bzw. behaupteten Anstieg der Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das wurde in dem Blog-Beitrag Der Kapitalismus macht depressiv! Aber ist das wirklich so? Oder liegt die Wahrheit vielleicht in der Mitte? durchaus kritisch bis ablehnend diskutiert. Allerdings gibt es ein unauflösbares Dilemma zwischen der Diskussion allgemeiner Entwicklungen im Kollektiv beispielsweise auf der Ebene epidemiologischer Studien, die dann zu dem Ergebnis kommen (können), dass es keinen erkennbaren Anstieg der Zahl der von psychischen Erkrankungen betroffenen Menschen gegeben hat und der Realität des einzelnen Falls, also der Menschen, die von einer solchen Erkrankung betroffen sind und die sehr handfest erfahren (müssen), was mit ihnen passieren kann. Sozialpolitisch relevant auf dieser Ebene sind dann reale Versorgungsdefizite, weiter bestehende Stigmatisierungen oder eben auch gute Ansätze eines veränderten Umgangs mit ihnen. Um diese Ebene soll es nun – gleichsam in Ergänzung zum Beitrag über die großen Zahlen – gehen.
Christina Hucklenbroich greift mit Blick auf den Umgang mit Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, in ihrem Beitrag Und dann haben Sie eine F-Nummer ein auch von den Kritikern immer wieder vorgetragenes Argument auf: »Den Freunden offen von der Psychotherapie erzählen, den Kollegen vom Burnout – das scheint inzwischen Normalität. Sind psychische Krankheiten völlig „entstigmatisiert“? Stigmaforscher sagen: im Gegenteil.«
Die Mitarbeiterin einer Beratungsstelle für Eltern verhaltensauffälliger Kinder wird mit den folgenden Worten zitiert: »Neulich sagte ein Mann, dem man ansah, dass er Medikamente nahm: ,Ich habe F20.0‘. Da ich keine Ärztin bin, musste ich sogar nachfragen, was der Diagnoseschlüssel bedeutet.“ Die Antwort kam prompt: „Paranoide Schizophrenie.“ Frauen sprächen heute offen über depressive Phasen in ihrem Leben … Aber auch Männer gäben immer häufiger von sich aus zu Protokoll, Depressionen erlebt zu haben. „Dass Männer Depressionen einräumten, gab es früher gar nicht. Und noch vor zwanzig Jahren hätte ich niemals gewagt, danach zu fragen.“ Für die Pädagogin ist klar, welche gesellschaftliche Entwicklung ihren Arbeitsalltag so verändert hat: „Die Entstigmatisierung psychischer Krankheiten ist in vollem Gange“, bilanziert sie.«
Da ist es also wieder, das Stichwort „Entstigmatisierung“. Hucklenbroich berichtet von ihren Recherchen bei der Deutschen Rentenversicherung – die Zahl der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit etwa, die aufgrund psychischer Störungen bewilligt werden, stieg von 41.000 im Jahr 1993 auf 74.000 im Jahr 2012, also muss man sich dort mit dem Thema befasst haben – und landet nach etlichen Schleifen bei einem Mitarbeiter, der mit diesen Worten zitiert wird:
„Die Gewerkschaften sagen ja, es liege an der Arbeitsverdichtung, dass immer mehr Menschen sich zu einer psychiatrischen Diagnose bekennen. Aber seien wir ehrlich: Das hat alles mit der Entstigmatisierung zu tun.“
Die Autorin wendet sich an eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Frage, ob es eine Entstigmatisierung gegeben hat, professionell beschäftigt: die psychiatrische Stigmaforschung. Und aus diesen Reihen wird ein auf den ersten Blick verblüffender Befund zitiert: Zwar glauben die Deutschen, dass die Gesellschaft psychische Störungen weniger stigmatisiere als früher. »Der Einzelne aber, nach seinen eigenen Gefühlen befragt, will mehr Distanz zu psychisch Kranken als noch 1990, er will sie nicht als Nachbarn und nicht als Kollegen, er will sie niemandem als Mitarbeiter empfehlen und sie nicht zum Freundeskreis zählen.« Und hinzu kommt: »Diese ablehnenden Gefühle sind zwischen 1990 und 2011 deutlich stärker geworden, zeigt ein ganzes Bündel von Studien, das eine Gruppe deutscher Stigmaforscher um den emeritierten Leipziger Sozialpsychiater Matthias Angermeyer und Georg Schomerus von der Universität Greifswald in den Jahren 2013 und 2014 vorgelegt hat«, so Hucklenbroich. Auch interessant: Die Psychiatrie scheint von diesen Entwicklungen profitiert zu haben, denn das Stigma, das auf ihr lag, habe abgenommen – allerdings: Die Menschen erhoffen sich von ihr Schutz, also eher eine selbstbezüglich-funktionale Sichtweise, die sich ausgebreitet hat.
Dass – vor allem die strukturelle – Stigmatisierung des Einzelnen keinesfalls verschwunden ist, kann man an zwei sozialpolitisch relevanten Beispielen illustrieren, man muss gar nicht zu den ganz harten Fällen wie dem dauerhaften Wegschließen bestimmter Menschen in den Psychiatrien des Landes greifen, die hin und wieder thematisiert werden: »Eine psychiatrische Diagnose kann es unmöglich machen, bestimmte private Versicherungen abzuschließen. Und sie kann die Verbeamtung gefährden.«
Psychische Krankheiten gelten wegen der Datenlücken hinsichtlich der Verläufe bei den Versicherungsunternehmen als schwer kalkulierbares Risiko. Verschweigt der Kunde entsprechende Diagnosen, muss der Versicherer später nicht zahlen. Das führt auf der Seite der Betroffenen zu verständlichen, aber nicht unproblematischen Ausweichreaktionen:
»Manche Patienten zahlen ihre Therapie privat und schieben einen stationären Aufenthalt auf. Wer nicht privat zahlen kann oder will, weicht bisweilen auf kirchliche Beratungsstellen aus, statt eine Therapie zu machen, die von der Krankenkasse registriert wird. Das bedeutet wiederum, dass manche Erkrankten auch keine durchgeplante Therapie auf dem Stand der Wissenschaft bekommen können.«
In dem Artikel kommt auch Michael Linden, Leiter der Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation der Charité, zu Wort, der seine Kollegen zu Vorsicht beim Umgang mit Diagnosen mahnt: »Eine Diagnose geht nicht mehr weg. Das heißt: Diagnosen sind nichts Gutes. Deswegen müssen wir die Patienten auch mal bremsen. Manche Patienten wollen einfach nur eine Kur machen. Und wenn sie da wieder rauskommen, haben sie eine F-Nummer.« 2013 hatte Linden in dem Beitrag Psychische Gesundheit: Gesundes Leiden – die „Z-Diagnosen“ im Deutschen Ärzteblatt dafür plädiert, statt der mit dem Buchstaben F kodierten psychiatrischen Diagnosen aus dem Klassifikationssystem ICD-10 häufiger die weicheren Z-Kodes zu nutzen, die für soziale Schwierigkeiten verwendet werden können.
Neben der offensichtlich weiter fortbestehenden strukturellen Stigmatisierung, mit der dann der einzelne Betroffene an möglicherweise für ihn völlig überraschenden Stellen konfrontiert werden kann, soll abschließend auch der eingangs bereits auf einer grundsätzlichen gesellschaftspolitischen Ebene angesprochene Aspekt der Bedeutung der Arbeit aufgegriffen werden – allerdings weniger bzw. gar nicht mit Blick auf die möglichen krankmachenden Bedingungen der modernen Arbeitswelt, sondern hinsichtlich der positiven Bedeutung, die Arbeit hat bzw. haben kann im Prozess der Bewältigung einer psychischen Erkrankung.
Stefan Mühleisen bringt es schon in der Überschrift seines Artikels auf den Punkt, worum es hier geht: Arbeit als Therapie. Sein Beitrag beginnt mit der Geschichte des David Walm, der eine Koch-Ausbildung begonnen hatte mit der Traumvorstellung, einmal Sternekoch zu werden. Aber er steckte während dieser Zeit in der Zwangsjacke einer schweren Depression mit Suizidgedanken und wurde von den eigenen Eltern in die Psychiatrie zwangseingewiesen. Nach wenigen Wochen bekam er die Kündigung von seinem Ausbildungsbetrieb. So oder ähnlich laufen viele Einzelschicksale ab. Dahinter – da ist es wieder, das S-Wort – stehe ein Stigma: »In der öffentlichen Wahrnehmung und insbesondere in vielen Chefetagen gelten psychisch kranke Menschen als willensschwach und unberechenbar. Wer eine psychiatrische Diagnose hat, ist häufig als gefährlicher Gestörter abgestempelt – obwohl seelische Leiden weit verbreitet sind.« Allerdings, so zumindest die Beobachtung von Mühleisen, beginnt das Stigma nun zaghaft zu bröckeln. Betriebe haben Programme aufgelegt, um psychische Belastungen überhaupt zu erkennen und entsprechende Hilfen anzubieten, wenn auch noch zu wenige. Aber es sind erkennbare Veränderungen. Und eines der zentralen Erkenntnisse ist dabei auch die Einsicht, dass Arbeit eine ganz wichtige Rolle spielt.
Beispiel David Walm: Fünf Jahre nach der Zwangseinweisung steht er wieder am Herd, wenn auch nicht einem Laden der Spitzengastronomie, er hat einen Job als Koch in der Kantine der Postbank-Niederlassung an der Münchner Bayerstraße bekommen. Und an dieser Stelle wird sehr deutlich sichtbar, wie wichtig arbeitsmarktpolitische Angebote für die Betroffenen – konkret: Integrationsunternehmen – sind, denn:
»Walm ist einer von 170 Mitarbeitern der Regenbogen Arbeit GmbH, 60 Prozent von ihnen sind psychisch krank. Der gemeinnütziger Betrieb verschafft Menschen mit seelischen Leiden eine Festanstellung, sie bekommen faire Jobs mit therapeutischer Begleitung. Die Firma schließt eine Lücke in der psychiatrischen Versorgungslandschaft. Denn längst wissen Fachleute um das Problem der „Drehtürpsychiatrie“: Wenn Menschen wie Walm nach einer schweren psychiatrischen Krise die Klinik verlassen, stehen sie oft vor den Trümmern ihres Lebens: ohne Freunde, ohne Wohnung – und ohne Arbeit. So fallen sie in die nächste Krise – und landen wieder in der Klinik.«
Der Integrationsbetrieb hat sich auf Catering-Service spezialisiert. »Menschen mit Psychose, Depression oder Schizophrenie verarbeiten Frischkost, fahren sie kistenweise in fünf Großkantinen in München – etwa bei Postbank, Allianz, Infineon – und arbeiten dort im Service, als Küchenhilfe oder Koch. Arbeitstherapie und Broterwerb zugleich.«
Und David Walm, um ihm das Schlusswort zu überlassen, betont einen ganz eigenen Aspekt:
Depressive Menschen sind enorm leistungsfähig. „Denn sie müssen große Stärke aufbringen, sich nicht umzubringen.“