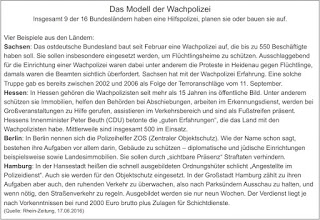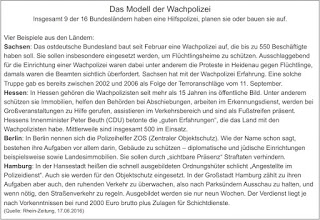Seit mehreren Jahren wird in diesem Blog über unterschiedliche Themen mit sozialpolitischer Bedeutung berichtet – und hin und wieder sollte man ältere Beiträge wieder aufrufen und überprüfen, ob das, was dort berichtet wurde, weiter Bestand hat. Das gilt beispielsweise für ein Thema von an sich hoher gesellschaftlicher Relevanz und Brisanz, das aber wenn überhaupt nur punktuell und dann in aller Regel skandalisierend (und die Unsicherheitsgefühle verstärkend) aufgerufen wird in den Medien: Jugendgewalt.
Viele werden sich erinnern, dass die immer dann bis in die Talk-Shows hochgezogen wird, wenn irgendwo ein schrecklicher Einzelfall passiert ist, den man dann zu bearbeiten versucht. Bei vielen Menschen bleibt dann hängen, dass wir in gefährlichen Zeiten leben und irgendwie alles schlimmer wird.
Dazu passend wurde am 4. Dezember 2014 in diesem Blog der Beitrag Jugendgewalt und Jugendkriminalität zwischen medialem Aufgussthema, ernüchternden Befunden aus der Forschung und einem „skeptischen Restgefühl“ veröffentlicht. Den Anfang von damals könnte man auch heute noch verwenden: »In regelmäßigen Abständen wird man vor dem Bildschirm konfrontiert mit einer natürlich bedrohlich daherkommenden punktuellen Skandalisierung des Themas Jugendgewalt und generell Jugendkriminalität, nicht selten hinterlegt mit dem Hinweis auf eine überproportionale Beteiligung junger Menschen mit Migrationshintergrund und gerne mit einem besonderen Fokus auf die jugendlichen „Intensivtäter“, die ja auch tatsächlich schon früh eine „beeindruckende“ Liste an Straftaten aufweisen können. Vor kurzem war es wieder soweit. Eine ganze Packung wurde dem normalen Fernsehzuschauer serviert.«
Und im Fazit des Beitrags aus dem Dezember 2014 findet man diesen Hinweis: »Die immer wiederkehrende punktuelle Skandalisierung des höchst komplexen Themas Jugendgewalt führt zu einer sehr verzerrenden Wahrnehmung und Diskussion in der Öffentlichkeit. Die ernüchternden, relativierenden Befunde aus der aktuellen Forschung werden zu wenig wahrgenommen. Unauflösbar ist natürlich das Dilemma, dass es einen Bias gibt zwischen dem, was man statistisch, bezogen auf das Kollektiv aussagen kann und der tragischen individuellen Dimension des Themas, den jede Gewalttat muss immer auch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass wir hier von den Opfern sprechen müssen, denen es nichts nützt, dass im statistischen Mittel die Gewalttaten zurückgehen.«
Fast genau ein Jahr später, am 20. November 2015, wurde dann dieser Beitrag veröffentlicht: Die Jugendgewalt geht zurück und verschiebt sich zugleich in die Großsiedlungen am Stadtrand. Über verblassende Mythen, die Umrisse deutscher Banlieues und die Bedeutung von Arbeit.
In diesem Beitrag wurde über die Erkenntnisse der Arbeitsstelle Jugendgewaltprävention berichtet, die es in Berlin seit 2013 gibt. Und die legt regelmäßig Berichte über die Entwicklung der Jugendgewalt und Evaluierungen präventiver Maßnahmen vor.
Im November 2015 konnte man diese beiden zentralen Befunde der interessierten Öffentlichkeit zur Kenntnis geben:
- In Berlin erreicht die Gewalt von Kindern und Jugendlichen den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Die messbare Jugendgewalt ist rückläufig. Das ist die eindeutig positive Botschaft.
- Allerdings gibt es eine klare Tendenz zu einer Gewaltverschiebung in die Großsiedlungen.
Also einerseits und andererseits. Insbesondere der Bezirk Marzahn-Hellersdorf steht stellvertretend für eine besondere Verdichtung neuer Exklusions- und Gewaltrisiken, hieß es in dem damaligen Bericht. Und diese Warnung sollte man nicht beiseite schieben: »Noch sei man zwar weit entfernt von der Gemengelage in den abgehängten französischen Vorstädten, den Banlieues; aber die Gefahr solle man sich vergegenwärtigen«, wurde Forschungsleiter Albrecht Lüter von der Arbeitsstelle Jugendprävention zitiert. Charakteristisch für diese Brennpunkte von Jugendgewalt sei „die Überlagerung eines schwierigen Sozialstatus mit einer von Großsiedlungen und Hochhausquartieren geprägten städtebaulichen Struktur“.
Und nun gibt es neue Befunde, die aufhorchen lassen. Angriffe, Drohungen: Hemmschwellen sinken – Jugendgewalt in Berlin steigt wieder, berichtet beispielsweise die „Berliner Zeitung“:
»Nach Jahren des Rückgangs ist die Jugendgewalt in Berlin im vergangenen Jahr erstmals wieder leicht gestiegen. Sowohl die Zahlen der Gewalttaten wie Körperverletzungen sowie der Verdächtigen nahmen im Vergleich zum Jahr 2015 etwas zu.
Einen deutlichen Anteil daran haben junge Flüchtlinge und Einwanderer. Das zeigt der vierte Jahresbericht der Arbeitsstelle Jugendgewaltprävention, der am Dienstag bei einer Tagung vorgestellt wurde. Die meisten der Gewalttaten waren allerdings leichte Körperverletzungen, schwere Taten kamen nur in der Minderzahl vor.«
Besorgniserregend sei auch, dass offenbar Hemmschwellen sänken. Zudem seien rund 500 Intensiv- oder Mehrfachtäter mit mehr als zehn Straftaten in Berlin registriert.
Meist sind es bestimmte Viertel, die auffällig sind: Hochhaussiedlungen am Stadtrand, Partymeilen und große Umsteigebahnhöfe. Genannt werden bei den 35 Problemgebieten etwa Hellersdorf Nord, Tiergarten Süd, Kurfürstendamm, Marzahn Nord, Hellersdorf Ost, Charlottenburg Nord und der Alexanderplatz.
Der in Berlin erscheinende „Tagesspiegel“ berichtet unter der Überschrift: Präventionsstelle veröffentlicht Studie: An Berlins Rändern nimmt die Jugendgewalt zu: »Die Jugendgewalt in der Hauptstadt ist gestiegen. Besonders belastet sind Großsiedlungen. In den Blick geraten Geflüchtete mit unsicherem Aufenthaltsstatus«, so die Zusammenfassung von Susanne Vieth-Entus und Christoph Stollowsky. Seit 2013 nahm die Jugendgewalt in Berlin kontinuierlich ab – doch im Jahr 2016 gab es erstmal wieder einen leichten Anstieg um 2,4 Prozentpunkte.
Auch Vieth-Entus und Stollowsky beziehen sich dabei auf diese Veröffentlichung
Landeskommission Berlin gegen Gewalt (Hrsg.) (2017): Berliner Monitoring Jugendgewaltdelinquenz. Vierter Bericht 2017. Berliner Forum Gewaltprävention Nr. 62, Berlin, November 2017
Die geringfügige Zunahme bei der Jugendgewalt verursachen offenbar vor allem junge, meist geflüchtete Tatverdächtige mit unsicherem Aufenthaltsstatus.
Die Autoren der Studie weisen jedoch darauf hin, dass die Zunahme bei den Tatverdächtigen mit unsicherem Aufenthaltsstatus vor dem Hintergrund der im selben Zeitraum ebenfalls gestiegenen Zahl Geflüchteter insgesamt gesehen werden muss. Einen „Anlass zur Dramatisierung“ sieht die Studie nicht, es sei auch noch unklar, ob sich überhaupt eine Trendwende abzeichne.
Eines aber ist ziemlich deutlich:
Eindeutig erkennbar und offenbar schwer aufzuhalten ist hingegen die Tendenz zur Gewaltverschiebung in die Großsiedlungen am Stadtrand sowie in citynahe Wohngebiete mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Menschen und Migrantenfamilien. Fazit der Studie: „Die Polarisierung nimmt in Berlin zu.“
In dem Bericht werden auch die Jugendgewaltdelikte in Berlins Schulen untersucht und dargestellt. »Dort gab es gleichfalls einen Anstieg. Den negativen Spitzenplatz hält hier seit einigen Jahren ebenfalls Marzahn-Hellersdorf. Blickt man in die „Schulgewaltstatistik“ der Berliner Polizei des Jahres 2016, so wurden von insgesamt 1489 Rohheitsdelikten auf Schulgeländen allein im Marzahn-Hellersdorf 285 Delikte verübt. Es folgten der Bezirk Mitte mit 240 und Neukölln mit 159 solcher Fälle.«
Die Zahlen beziehen sich 2016 – sind denn keine neueren verfügbar? Dazu bekommt man dann diesen Hinweis:
»Ob sich der Trend zu mehr Gewalt auch 2017 fortgesetzt hat, lässt sich zurzeit nicht sagen, denn die Bildungsverwaltung gibt die aktuellen Zahlen vom zweiten Schulhalbjahr 2016/17 noch nicht heraus. Die Sprecherin von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), Beate Stoffers, begründet das Zurückhalten der Daten damit, dass „die Meldungen der Schulen erst evaluiert und wissenschaftlich untersucht werden“. Denn es habe sich herausgestellt hat, dass manche Schulen wichtige Vorkommnisse gar nicht melden, während andere Schulen selbst über Lappalien Bericht erstatten.
Dieses Vorgehen ist neu: Bislang war die Gewaltstatistik halbjährig erhoben und vom SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck erfragt und publiziert worden. Noch im September dieses Jahres hatte Bildungs-Staatssekretär Mark Rackles (SPD) dem Abgeordneten mitgeteilt, dass die Daten „voraussichtlich Ende Oktober zur Verfügung stehen werden“.«
Das klingt jetzt nicht nach einer Transparenzoffensive des Senats. Und wenn es – was hier nicht abschließend beurteilt werden kann – wirklich eine „Zwischenlagerung“ von Zahlen gibt, dann ist das eines dieser bekannten, aber sinnlosen Unterfangen, denn man kann die Probleme nicht wegretuschieren und die Zahlen werden ja sowieso bekannt.
Auch wenn es eine mehr als mühsame Angelegenheit ist – an präventiven Maßnahmen sollte man es gerade in diesem Bereich nicht fehlen lassen. Das kann nicht nur mit Konzepten und Ideen gemacht werden, sondern dafür braucht es auch Professionelle aus der Kinder- und Jugendarbeit bis hin zu den Sicherheitsbehörden, die das machen. Und das kostet natürlich Geld.
Über welche Größenordnungen der Förderung wir in der Millionenstadt Berlin sprechen, kann man diesen Zahlen entnehmen: »Um Jugendgewalt präventiv einzudämmen, erhielt jeder Bezirk bisher 135.000 Euro pro Jahr für entsprechende soziale Initiativen. Ab 2018 soll dieser Zuschuss auf 150.000 Euro erhöht werden.«
Foto: © Stefan Sell