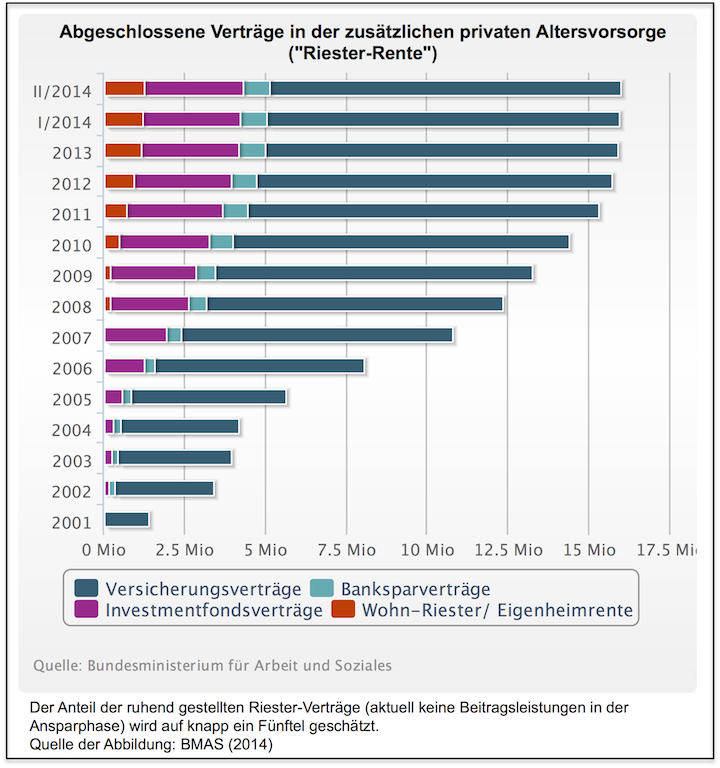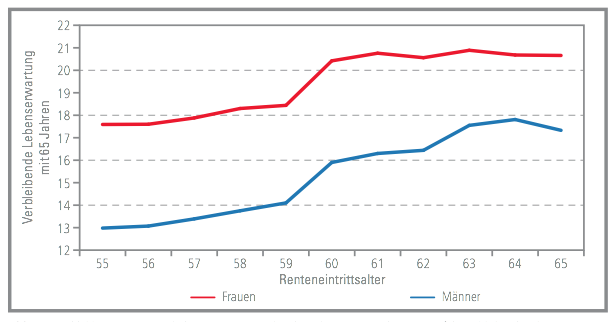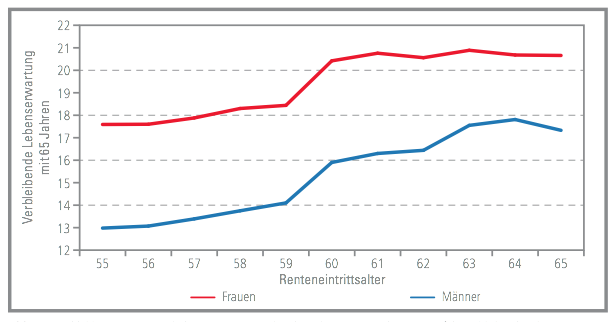»Demografische Forschung ist eine Welt aus Zahlen, in der die Orientierung schnell verloren gehen kann. Die Materie ist komplex, viel komplexer, als es schnelle öffentliche Debatten über Fachkräftemangel, kommende Rentenlücken, Vergreisung und Kinderarmut glauben machen. Unumstrittene Fakten sind rar: Fünf Millionen Deutsche mehr als heute werden im Jahr 2030 über 65 Jahre alt sein, sie werden gut ein Drittel der Bevölkerung ausmachen, das scheint gewiss. Vielleicht wird es dann auch 600.000 Kinder und Jugendliche weniger im Land geben, das ist schon weniger sicher, aber wahrscheinlich.« So kann man es am Anfang einer vierteiligen SPIEGEL-Serie zum „Megathema Demografie“ in Deutschland lesen (DER SPIEGEL, Heft 12/2015, S. 23). Und dann kommt – gerade für die Debattenlandschaft in Deutschland, die sich so gerne in einer Schwarz-Weiß-Malerei verlieren kann – ein wichtiger Hinweis: »Aus solchem Material lassen sich Horrorszenarien basteln, und in Deutschland geschieht das mit Lust. Statt zur Kenntnis zu nehmen, dass Bevölkerungswandel keine schlagartig einsetzende Katastrophe, sondern der sich schleichend entwickelnde Dauerzustand aller Gesellschaften ist, versteigen sich selbst als seriös geltende Experten zu alarmistischen Thesen, die die Wirklichkeit weit verfehlen.«
An dieser Stelle darf und muss man dann darauf verweisen, dass aus sozialpolitischer Sicht besonders relevant gerade in der jüngeren Vergangenheit die apokalyptische Seite der demografischen Entwicklung gerne herausgestellt wurde, um Veränderungen in den Systemen der sozialen Sicherung zu legitimieren, man denke hier nur an die „Rentenreform“ der damaligen rot-grünen Bundesregierung Anfang des neuen Jahrtausends. Gegenwärtig ist es vor allem die Beschwörung eines (angeblichen) Fachkräftemangels und die deshalb dringend notwendige Zuwanderung (natürlich nur geeigneter Arbeitskräfte), die darüber abgesichert werden sollen. Auf der anderen Seite gibt es auch keinen Grund, die enormen gesellschaftlichen und eben auch sozialpolitischen Herausforderungen zu verleugnen, nur weil „die andere Seite“ den Demografie-Diskurs instrumentalisiert. Natürlich wird sich die Gesellschaft in den vor uns liegenden und halbwegs absehbaren Jahren massiv verändern. »Es wird in Deutschland demnächst 100-Jährige in ungekannter Zahl geben, viel mehr 90-jährige, 80-jährige Männer und Frauen als heute«, so der SPIEGEL im ersten Teil seiner Serie. Und das wird nach neuen Lösungen verlangen – und die sind bereits in der Pipeline, wenn man denn den zunehmenden Berichten über neue Produkte und Dienstleistungen in einer alternden Gesellschaft Glauben schenken darf. Und die zugleich auch ein positives Bild von dem zeichnen, was vor uns liegt, denn das sind auch neue Wachstums- und Beschäftigungsfelder, die hier im Entstehen begriffen sind. Deshalb fangen wir an mit den positiven Antwortversuchen auf die Fragen, die sich durch den demografischen Wandel stellen – und vergessen aber nicht, auf neue Konfliktstellen zu verweisen, die sich gerade für die Sozialpolitik zu einer ganz neuen brisanten Verteilungsfrage ausfächern können (und soweit absehbar auch werden).
»Die Deutschen werden immer älter, ohne alt zu sein. Das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von über 70-Jährigen steigen rasant. Langsam wandeln sich auch die Bilder vom Altern. Und neue Zwänge entstehen«, schreibt Anna Sauerbrey in ihrem Essay Jenseits der Ofenbank. Sie illustriert ihre zentrale These – Wir werden zwar immer älter, aber wir sind immer länger nicht richtig alt – anhand einiger prominenter Persönlichkeiten:
»Verdammt gut sah Udo Jürgens aus, als er im vergangenen Jahr mit 80 gegangen ist. „Mitten im Leben“ hieß sein letztes Album. Damit ging er noch im Sommer vor seinem Tod auf Tournee. In dieser Woche starb der portugiesische Regisseur Manuel de Oliveira. Er wurde 106 Jahre alt. Seinen letzten Film drehte er mit 105. Unser Finanzminister ist 72, der Bundespräsident 75. Würde Hillary Clinton amerikanische Präsidentin, wäre sie bei Amtsantritt 69 Jahre. 80 ist das neue 60, heißt es, 60 das neue 40.«
Zahlreiche Studien belegen, dass es sich dabei keineswegs um prominente Einzelfälle handelt und Sauerbrey verweist beispielsweise auf eine neue Studie des DIW, in der „statistische Zwillinge“ aus den beiden Berliner Altersstudien von 1990–1993 und 2013–2014 verglichen wurden mit dem Ergebnis, dass über 70-Jährige sich heute signifikant wohler fühlen als die über 70-Jährigen vor 20 Jahren und dass sie zu deutlich höheren geistigen Leistungen fähig seien (vgl. ausführlicher Gersdorff, D. et al.: Secular Changes in Late-life Cognition and Well-being: Towards a Long Bright Future with a Short Brisk Ending?, Berlin, 2015).
Selbst der Bundespräsident Joachim Gauck („Ich bin ein lebendes Exponat“) plädiert für neue Altersbilder in der Politik: Notwendig seien „neue Muster für lange Lebensläufe, neue Verflechtungen von Lernen, Arbeit und Privatem“, eine neue „Lebenslaufpolitik“ (vgl. dazu Neue Altersbilder. Rede des Bundespräsidenten am 31.03.2015 in Berlin).
Bereits seit längerem wird gerade seitens der Alter(n)sforschung darauf hingewiesen, dass wir den Blick auf die demografische Entwicklung hinsichtlich der unbestreitbar zunehmenden Zahl an älteren Menschen nicht auf die Schattenseiten, die damit auch verbunden sind, verengen dürfen bzw. sollten. Timo Stukenberg hatte im vergangenen Jahr seinen Artikel dazu unter die plakative Überschrift Wir werden gesünder und produktiver gestellt. Er stützt seine Hinweise auf die eben auch positiven Seiten der Alterung unserer Gesellschaft auf eine Veröffentlichung von Fanny Kluge et al., die 2014 publiziert wurde: The Advantages of Demographic Change after the Wave: Fewer and Older, but Healthier, Greener, and More Productive?
Und in diesen Reigen kann man eine Diskussion und reale Entwicklungslinie einordnen, für die man derzeit viele Forschungsgelder und viel Aufmerksamkeit bekommen kann – Smart Homes, E-Health, oder AAL (Ambient Assisant Living), so lauten die Schlüssel- und Schlagwörter nicht nur in der Antragsliteratur. Auf Deutsch könnte man das so übersetzen: „Altersgerechte Assistenzsysteme für ein selbstbestimmtes Leben“. Hört sich nicht nur gut an, sondern hat auch eine Menge Potenziale für die Herstellung eines besseren Lebens, denn hier geht es um neue Technologien, die Lebensqualität, soziale Teilhabe und Mobilität im Alter versprechen. Da lohnt es sich, genauer und auch kritischer hinzuschauen.
Das versucht Josephine Schulz in ihrem Artikel Czajas fabelhafte Welt des altersgerechten Lebens. Und sind bringt gleich am Anfang die Berechtigung für eine eben auch kritische Sichtweise auf den Punkt: »Neue Technologien sollen Menschen möglichst lange eigenständiges Wohnen sichern, doch dieser Traum ist für viele unerschwinglich.«
Sie arbeitet sich ab an Berlins Gesundheitssenator Mario Czaja (CDU), der darauf hinweist: »Heute gibt es in Berlin rund 105.000 pflegebedürftige Menschen. In dreißig Jahren werden es schätzungsweise 70.000 mehr sein«. Dabei steige nicht der Bedarf an stationärer, sondern ambulanter Pflege. Dann wird für die Digitalisierung im Pflegebereich geworben. Auch dafür gibt es natürlich schon eine (potenziell) marktgängige Begrifflichkeit: Smartes Altern.
»Smartes Altern, das kann so ziemlich alles heißen. Vom intelligenten Rollstuhl, der sich in der Stadt geeignete Wege sucht, über sturzmeldende Fußböden, bis zur extern steuerbaren Alarmanlage.«
Da gibt es in Berlin beispielsweise die »Casenio AG. Hier werden sensorbasierte Assistenzsysteme konzipiert. In der Praxis heißt das: Die Wohnung des Pflegebedürftigen wird mit Sensoren ausgestattet, die miteinander kommunizieren und Informationen an einen zentralen Computer senden. Sind in der Wohnung beispielsweise über längere Zeit Herd und Dusche gleichzeitig an, werden Angehörige oder Pflegepersonal über verständigt. Ähnlich sieht das intelligente Wohnen in einer Musterwohnung des Altenheim Sunpark vom evangelischen Johannesstift aus. Fast alle Einrichtungsgegenstände können über Fernbedienung gesteuert werden. Wird ein Fenster geöffnet, geht automatisch die Heizung aus, per Knopfdruck läuft Wasser in die Badewanne. Ein zentraler Rechner dokumentiert die Aktivitäten.«
Kurzum: »Das smarte Wohnen im Alter verspricht viel: Komfort, Sicherheit, Mobilität und mehr Teilhabe.« Hört sich gut an, hat aber wie alles im Leben auch seine Schattenseiten. Wobei hier gar nicht Datenschutz-Fragen aufgerufen werden sollen, die ein eigenes Thema darstellen würden.
Josephine Schulz legt in ihrem Beitrag den Finger auf eine offene Wunde der schönen neuen Welt der Digitalisierung und des smarten Alterns:
»Intelligentes Wohnen ist nicht billig. Jeder einzelne Sensor von Casenios kostet rund 50 bis 100 Euro, plus eine Monatsgebühr für den Anbieter. Die Versicherung übernimmt bisher nichts. 4.000 Euro können Pflegebedürftige derzeit für den altersgerechten Umbau ihrer Wohnung beantragen, für ein komplettes intelligentes Haus reicht das jedoch nicht. Wie technologiebasierte Pflege angesichts steigender Altersarmut nicht zum Luxusgut wird, darauf hat Czaja keine klare Antwort. Man müsse sich schon früh Gedanken machen, sagt der Senator. Bei privaten Anschaffungen, die ohnehin getätigt werden, sollte darauf geachtet werden, dass diese altersgerecht sind. Heißt wohl im Klartext: Bis auf weiteres zahlen die Betroffenen.«
Damit sind wir an einem sozialpolitisch hoch relevanten Punkt angekommen. Aber auch darüber hinaus stellen sich kritische Anfragen an die schöne neue Welt, die von vielen nun gezeichnet bzw. überzeichnet wird.
Auch Anna Sauerbrey hat in ihrem an sich sehr positiv daherkommenden Essay Jenseits der Ofenbank kritische Aspekte nicht ausgelassen: »Die Phase der Gebrechlichkeit vor dem Tod bleibt von den Verbesserungen im Leben der Älteren abgeschnitten, sagen viele Altersforscher. Wir verschieben sie lediglich immer weiter nach hinten.« Und von diesen Phasen wird es immer mehr geben.
»Das Kranksein ist gerade im Alter relativ. Tatsächlich sind nämlich die heutigen Alten, obwohl sie sich deutlich wohler fühlen, nicht weniger „krank“. Im Gegenteil. Chronische Krankheiten nehmen zu, ebenso die „Multimorbidität“, das Zusammenfallen mehrerer Krankheiten. Medizin und Technik aber steigern dennoch das Befinden. Wer sein eigenes Knie nicht mehr beugen kann, bekommt eben ein neues.« Das ist das eine. Aber es gibt auch noch eine andere, ganz grundsätzliche Seite der Entwicklung – und darüber nachzudenken lohnt sich:
»Man ist so alt, wie man sich fühlt, das trifft immer stärker zu, und es ist einerseits ein Fortschritt. Die Subjektivierung des Alterns nimmt ihm das Stigma. Andererseits droht die Gefahr, die medizinisch-technische Machbarkeit als grenzenlos anzusehen und die Verantwortung für Gebrechen auf den Einzelnen zu übertragen. Die Grenze zwischen Nicht-Können und Nicht-Wollen verschwimmt scheinbar. Nicht mehr der Alte an sich wird stigmatisiert, aber der, der sich weigert durch lebenslanges Lernen, durch Gehirnjogging, mit Pillen, Ersatzteilen alterslos zu bleiben. Das Wort vom „Ruhestand“ habe ausgedient, sagte Joachim Gauck. Das ist emanzipatorisch gemeint. Und es ist die zentrale Handlungsanleitung der Alterswissenschaftler. Doch wenn der Unruhestand zum Imperativ wird, verlieren wir die Freiheit, einfach auf der Ofenbank zu sitzen und die Zeit vorbeiziehen zu lassen. Wir verlieren das Recht auf eine Existenz ohne Ziel und Zweck.«
Und sie weist zu Recht darauf hin, dass wir uns verabschieden müssen, von den immer noch homogenen Altersbildern, die wir alle im Kopf haben, denn zunehmend wird erkannt, dass die Heterogenität innerhalb einer bestimmten chronologischen Altersgruppe, beispielsweise der 70jährigen Menschen, weitaus größer ist, als es die gängigen Bilder nahelegen. Die Konsequenz:
»Die gesellschaftliche und politische Antwort auf das Phänomen des alterslosen Alterns kann nur eine möglichst große Freiheit sein, die Förderung möglichst vieler unterschiedlicher Lebensmodelle: vom Heim über die Alters-WG bis zur Pflege in der Familie. Von der Frühverrentung bis zum Arbeiten bis zur letzten Minute.«
Das aber auch sozialpolitisch zu konkretisieren wird eine der Herkulesaufgabe der vor uns liegenden Jahre.
Übrigens: Der instruktive Begriff der „Demokalypse“ in der Überschrift dieses Beitrags ist dem vierten und letzten Teil der eingangs zitierten SPIEGEL-Serie zum Mega-Thema Demografie entnommen – einem Versuch, positiv auf das zu schauen, was sich hinter dem Schlagwort „demografische Entwicklung“ verbirgt und was an vielen Stellen ausschließlich kritisch bis apokalyptisch entfaltet wird:
Guido Mingels: Die Demokalypse bleibt aus. Seit mehr als hundert Jahren fürchtet sich Deutschland vor dem demografischen Wandel und beschwört seinen eigenen Untergang. Eine Widerrede. In: DER SPIEGEL, Heft 15/2015, S. 42-47.