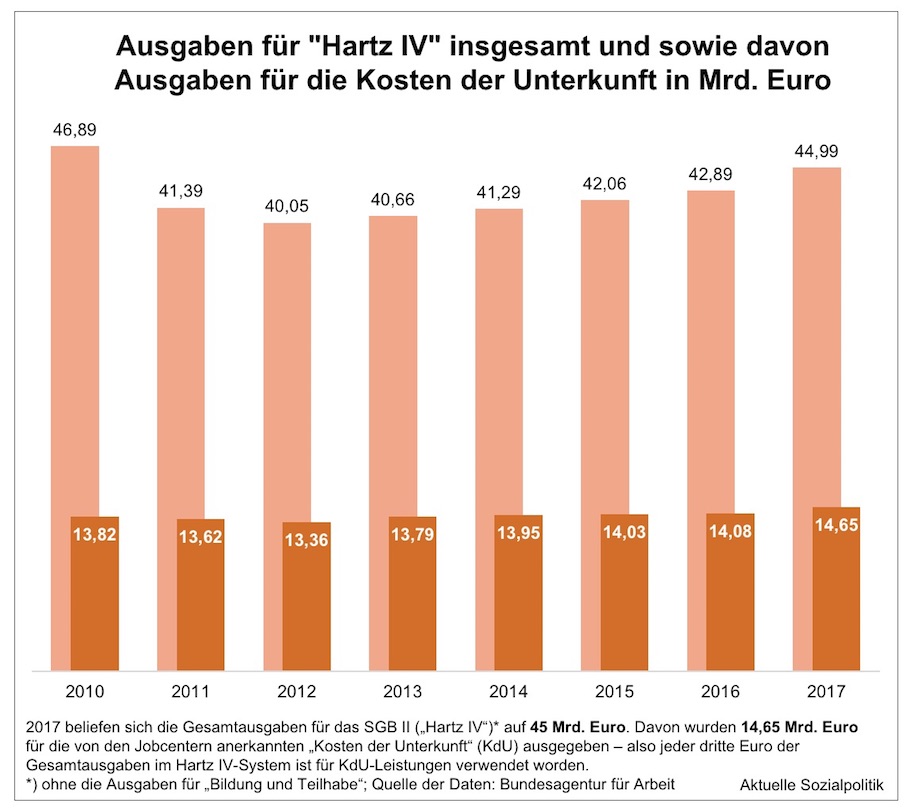Nun endlich also ist es da, das seit Jahren erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu der im wahrsten Sinne des Wortes existenziellen Frage, ob die Sanktionen im Hartz IV-System mit der Verfassung vereinbar sind – oder eben nicht.
Die Richter des Sozialgerichts Gotha haben hier ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben. 2015 wurde ein Vorlagebeschluss an das höchste deutsche Gericht adressiert: Mit Beschluss des Sozialgerichts Gotha vom 26.05.2015 (Az.: S 15 AS 5157/14) stellte die 15. Kammer die Unvereinbarkeit von SGB-II-Sanktionen mit dem Grundgesetz fest. Dabei sahen die Gothaer Richter in der Regelung des § 31a i.V.m § 31 und § 31b SGB II insbesondere eine Verletzung der Menschenwürde und des Grundrechts auf Berufsfreiheit. Das Verfahren wurde dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.
Das hat sich anfangs zu sträuben versucht und wollte den Fall gar nicht erst auf den Tisch bekommen – aber in einem zweiten Anlauf wurde dann das Verfahren doch angenommen. Am 5. November 2019 wurde nun die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts verkündet. Viele Menschen haben teilweise sehnsuchtsvoll darauf gewartet – in der Hoffnung auf eine Klatsche der Verfassungsrichter für die Politik, die über eine vom BVerfG festgestellte Verfassungswidrigkeit der Sanktionen endlich in die Schranken gewiesen werden würde.