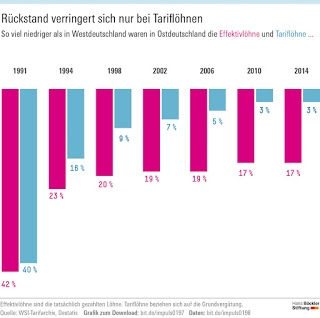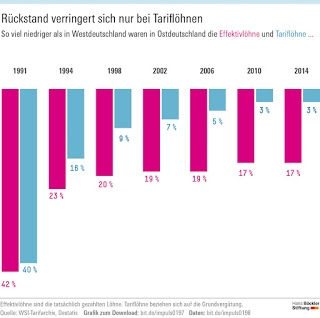Derzeit geht es in Berlin um eine der letzten noch offenen arbeitsmarktpolitischen Baustellen, die man mit dem Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD vom Dezember 2013 aufgemacht hat – also um die Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen. Ausgangspunkt für die Aufnahme eines Regelungsbedarfs in den Koalitionsvertrag war u.a. das Ziel, rechtswidrige Vertragskonstruktionen bei Werkverträgen zu bekämpfen. Hierzu hat das Bundesarbeitsministerium einen Entwurf vorgelegt, der aber auf erhebliche Widerstände stößt, nicht nur seitens der Wirtschaftsverbände, sondern auch in der Union. Schützenhilfe bekommt diese Seite von den eigenen Wissenschaftstruppen, beispielsweise aus dem von den Arbeitgebern finanzierten Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Von dort kommt die entlastende Botschaft: Empirie signalisiert: Kein gesetzlicher Handlungsbedarf: Auf die Frage, ob es überhaupt einen Handlungsbedarf aufgrund möglicher Missbrauchsfälle im Bereich der Werkverträge gibt, kommt das Arbeitgeber-Institut zu einem Nein, »weil auch die Befunde von Unternehmensbefragungen im Grunde keinen Handlungsbedarf signalisieren.« Nun mag der eine oder andere möglicherweise zu dem Ergebnis kommen, dass das ein putziges Argument ist, denn es ist nicht wirklich überraschend, wenn in Unternehmensbefragungen herauskommt, dass Unternehmen nicht zugeben, dass sie Missbrauch betreiben.
Vielleicht ist es an dieser Stelle wieder einmal hilfreich, ein Blick in die betriebliche Realität zu werfen und den nicht nur möglichen, sondern offensichtlich naheliegenden Missbrauch konkret zu beschreiben – wobei hier gleich angemerkt sei, dass das, was für die einen „Missbrauch“ ist, für die andere Seite ein betriebswirtschaftlich rationales, weil gewinnbringendes Vorgehen darstellt, das man natürlich nicht gerne reguliert, also eingeschränkt sehen möchte. Das konkrete Unternehmens-Beispiel stammt zudem aus einer Branche, die von größter sozialpolitischer Bedeutung ist und in der das Thema Arbeitsbedingungen des Personals seit langem ganz oben auf der Tagesordnung steht. Schauen wir uns also die Entwicklungen im Bereich der Krankenhäuser an.
In einem Artikel über die Kritik an einem Teil der Werkverträge, den Thomas Öchsner unter der Überschrift Entfremdete Belegschaft im Januar 2016 veröffentlicht hat, steht der Bereich der Krankenhäuser nicht ohne Grund am Anfang:
»Patienten, die heute in ein Krankenhaus müssen, merken oft nicht, dass sie sich in die Obhut verschiedenster Firmen und Honorarkräfte begeben. Für den Empfang kann eine eigene GmbH zuständig sein, genauso wie fürs Reinigen des Operationsbestecks, die Versorgung mit Essen oder Hin- und Herbringen von Patienten zum Röntgen oder zur OP. „Private Klinikkonzerne zerstückeln die Krankenhausbelegschaften zur Gewinnmaximierung“, beklagte kürzlich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf ihrer Krankenhaustagung in Leipzig.
Bereits heute seien im Durchschnitt 20 Prozent der Belegschaft ausgelagert, oft zu deutlich schlechteren Konditionen als das Stammpersonal. Häufig handele es sich dabei um Beschäftigte mit Werkverträgen, die in den Krankenhausablauf nicht eingebunden sein dürfen. Die Folgen spürten auch die Patienten.«
Es geht bei dem konkreten Unternehmen um einen der größten privatwirtschaftlichen Klinikbetreiber in Deutschland, die Helios Kliniken GmbH als Teil der Helios-Kliniken Gruppe, die wiederum eine Tochter des „Gesundheitskonzerns“ Fresenius sind. Wir sprechen hier von einem Unternehmen, das jährlich 1,2 Millionen Patienten stationäre versorgt und etwa 68.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahr 2014 erwirtschaftete dieses Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 5,244 Mrd. Euro und konnte daraus eine Menge Gewinn ziehen – der EBITDA wird mit 732 Mio. Euro und der EBIT mit 553 Mio. Euro ausgewiesen. Die EBIT-Marge liegt also bei beeindruckenden 10,5 Prozent. Davon können viele andere Unternehmen nur träumen.
Der eine oder andere wird mit Helios und Krankenhäuser sofort aktuelle Assoziationen herstellen, die nicht positiv besetzt sind. Dieser Krankenhauskonzern tauchte vor kurzem in einem „Team Wallraff“-Beitrag auf. Es handelt sich um die am 11. Januar 2016 bei RTL ausgestrahlte Reportage „Profit statt Gesundheit – wenn Krankenhäuser für Patienten gefährlich werden“, in der u.a. auch über Rechercheergebnisse aus einer von Helios betriebene Klinik in Wiesbaden berichtet wurde. Vgl. dazu ausführlicher den Beitrag Krankenhäuser: Bei vielen liegen die Nerven blank und die Systemfragen bleiben weiter unter der Decke vom 31.01.2016.
Nun hat vor einigen Tagen der Konzernbetriebsrat der Helios Kliniken GmbH einen Brief an den Bundesgesundheitsminister und an alle Fraktionen der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien geschrieben, dem man überaus aufschlussreiche Hinweise zur Realität der missbräuchlichen Werkvertragswelt entnehmen kann.
Der Konzernbetriebsrat der Helios Kliniken GmbH berichtet in dem Schreiben, dass es für den größten Teil der Beschäftigten Tarifverträge gibt, die in ihrem Inhalt, wenn auch nicht flächendeckend, in weiten Teilen den Regelungen der öffentlichen Kliniken entsprechen. Aber wir nähern uns dem Kern des Problems, denn etwa »ein Fünftel der Beschäftigten werden jedoch nicht von den geltenden Tarifverträgen in den Kliniken erfasst. Sie wurden in konzerneigene, sogenannte Servicegesellschaften ausgegliedert.«
Für die Beschäftigten hat sich in der Ausübung ihrer Tätigkeit grundsätzlich nichts verändert, ansonsten aber eine Menge. Dazu der Konzernbetriebsrat:
»Sie arbeiten nicht in einem Unternehmen, welches am Markt tätig ist, sondern es werden Tochterfirmen gegründet, gespalten und wieder zusammengelegt, wie es gerade der gegenwärtigen Geschäftsführung genehm ist. Es ist ein nahezu unüberschaubares Geflecht an Tochter- und Enkelfirmen entstanden. Vermutlich ist es das einzige Ziel, dem Tarifvertrag zu entkommen. Die Kolleginnen und Kollegen werden bis zu 40 % schlechter bezahlt. Versuche der Gewerkschaft ver.di für diese Kolleginnen und Kollegen Tarifverträge zu erstreiten sind in der Vergangenheit mit Auflösung der Unternehmen beantwortet worden. Für die Verhandlungen ist dann kein Gegenüber mehr vorhanden.«
Als eine (Neben- oder geplante?-)Wirkung wird beklagt, dass die Klinikbetriebsräte diese ausgegliederten Arbeitnehmer nicht mehr vertreten können. Und da vor allem in den kleinen und mittelgroßen Kliniken keine betriebsratsfähigen Einheiten entstehen, gibt es für die Betroffenen auch keine Betriebsräte mehr, die deren Interessen vertreten können.
Angefangen hat diese Auslagerungsstrategie in den ehemaligen Arbeiterbereichen. Aber das wuchert jetzt weiter, denn »zunehmend werden … Fachkräfte wie z. B. Therapeuten ausgegliedert. Vielfach werden auch Arbeitsplätze z. B. von examinierten Pflegekräften in „Servicebereiche“ verlagert, damit die Arbeiten billiger erbracht werden.«
Und das hat Folgen nicht nur für die betroffenen Beschäftigten, sondern auch für die Patienten.
Um das folgende Beispiel zu verstehen, muss man wissen, dass der Einsatz von Werkverträgen immer ein Risiko birgt, wenn sich nämlich herausstellt, dass es sich gar nicht um einen „echten“ Werkvertrag handelt, sondern um den Tatbestand der „unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung“. Genau um die hier relevanten Abgrenzungsfragen geht es ja auch in dem aktuell strittigen Entwurf des Bundesarbeitsministeriums. Eine Folge hinsichtlich der betrieblichen Praxis ist, dass man bei einem Werkvertrag darauf achten muss, dass man eben nicht das machen darf, was bei der Leiharbeit kein Problem ist, nämlich das Direktionsrecht als Arbeitgeber auszuüben, denn bei einem „echten“ Werkvertrag handelt es sich nicht nur bildlich gesprochen um einen „Betrieb im Betrieb“. Die daraus resultierenden Abgrenzungskapriolen werden auch vom Konzernbetriebsrat erfahren und geschildert:
»Die Mitarbeiter z. B. des Pflegedienstes und des ärztlichen Dienstes erhalten Informationen, dass sie den Kolleginnen und Kollegen keine Weisungen erteilen dürfen. Das wird in vielen Fällen nicht beachtet, da es für die Patienten auch gar keinen Sinn macht oder gar nachteilig ist. Wenn es beachtet wird, führt das zu Situationen, in denen Patienten von einem Transporteur nicht mitgenommen werden und warten müssen, weil die Anweisung des Vorgesetzten des Transportdienstes fehlt. Die Beseitigung einer Verschmutzung durch den Reinigungsdienst kann nicht erfolgen, weil die Anweisung durch deren Leiter erfolgen soll.«
Der Konzernbetriebsrat schlussfolgert völlig zu Recht, dass wir hier mit einer missbräuchlichen Inanspruchnahme des Instruments der Werkverträge konfrontiert werden, denn es handelt sich bei den zahlreichen Servicegesellschaften »nicht um Firmen, die am Markt tätig sind, sondern um eigene Tochtergesellschaften, die wegen der damit verbundenen Tarifflucht und der Ver- bzw. Behinderung von Betriebsräten gegründet werden. Fremdfirmen werden gemieden, weil dann Umsatzsteuer fällig wird.«
„Natürlich“ sieht das betroffene Unternehmen das alles ganz anders – angesichts der Kostensenkungspotenziale in einem von Personalkosten dominierten Bereich wie den Krankenhäusern, die sich durch diese Strategie erschließen lassen, ist das auch kein Wunder. Für die ist das kein „Missbrauch“, sondern unabdingbare Voraussetzung, in den Finanzberichten eine EBIT-Marge von 10,5% ausweisen zu können.
Man kann es auch so ausdrücken: Wenn der eine Gewinn macht, dann muss es andere geben, die Opfer bringen.