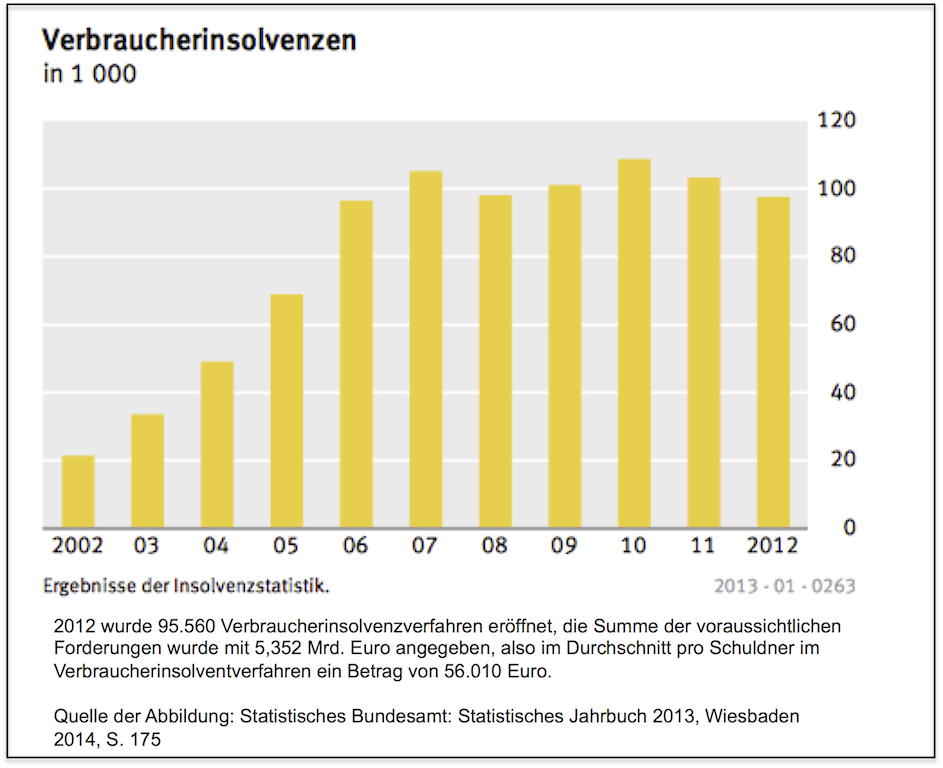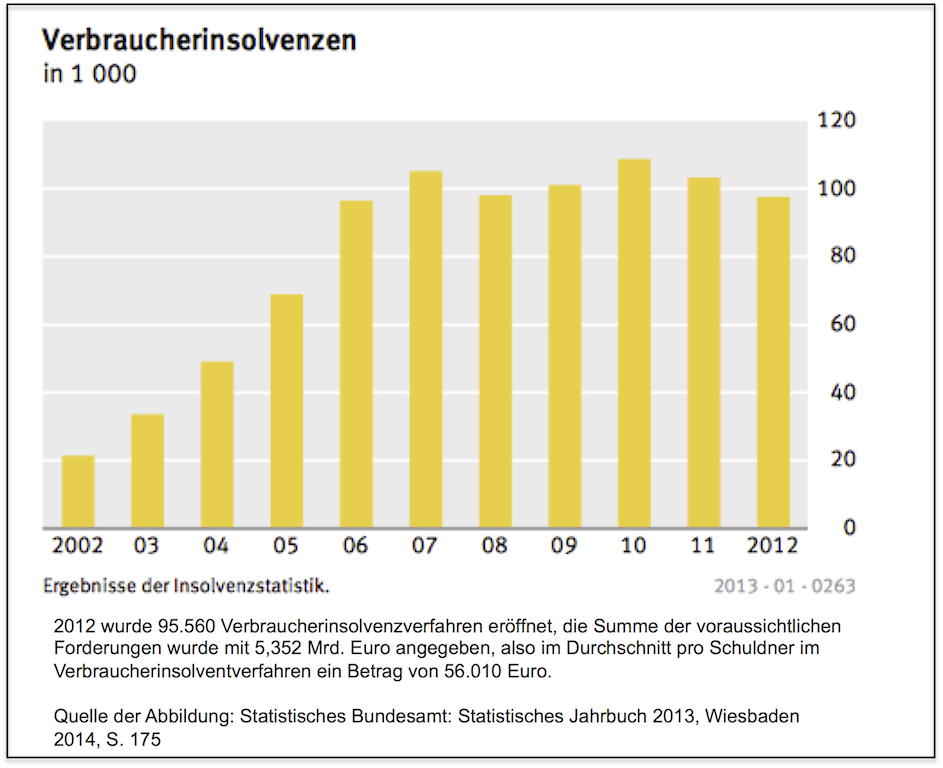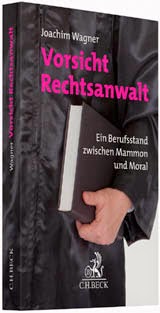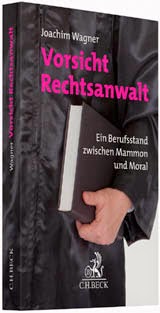Es ist aber auch nicht einfach in der Sozialpolitik – komplexe und immer heterogener werdenden Lebensumstände müssen in konkrete sozialrechtliche Vorschriften gegossen werden. Neben der Tatsache, dass die daraus resultierenden Regelungen sofort ganz viel Phantasie freisetzen, wie man sie umgehen kann (das erleben wir beispielsweise derzeit im Bereich der anstehenden Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns), ist es unvermeidbarerweise immer auch so, dass Regelungen, mit denen man „mehr Gerechtigkeit“ herstellen möchte, nicht selten und oftmals als ungeplante Nebenfolge ihrer praktischen Umsetzung beispielsweise über Stichtagsregelungen neue „Gerechtigkeitslücken“ aufreißen. Wenn dann noch die Gesetzgebung aufgrund des tagespolitischen Drucks mit der heißen Nadel gestrickt werden muss, sind handwerkliche Fehler quasi nicht zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund kann es nicht wirklich überraschen, dass jetzt sukzessive auf einer der wichtigsten „Gerechtigkeitsbaustellen“, also der so genannten „Rente mit 63“, Baumängel (für die einen) bzw. „Notausgänge“ (für die anderen) erkennbar werden.
Man kann die Andeutungen konkretisieren: Es geht um die Frage, wie man verhindern kann, dass die „Rente mit 63“ in praxi die Möglichkeit eröffnet, zu einer „Rente mit 61“ zu werden. Dabei schien dieses Problem doch beim Ringen innerhalb der Großen Koalition um einen Kompromiss zum „Rentenpaket“ im vergangenen Monat eigentlich gelöst – wenn auch damals schon mit einigen erheblichen Unwuchten (vgl. hierzu den Beitrag Ein Geben und Nehmen: Die Große Koalition einigt sich auf das vorerst endgültige Design des „Rentenpakets“):
Aufgrund der vereinbarten Anrechnung von Zeiten der Arbeitslosigkeit mit Bezug der Versicherungsleistung Arbeitslosengeld I auf die zu erfüllenden 45 Beitragsjahr, die Voraussetzung sind, damit man die Rente mit 63 ohne Abschläge in Anspruch nehmen kann, stand man vor dem Problem, dass sich die Möglichkeit eröffnete, dass ein Arbeitnehmer bereits mit 61 mit der Erwerbsarbeit aufhört, zwei Jahre lang Arbeitslosengeld I bezieht und dann in den vorgezogenen, abschlagsfreien Ruhestand wechselt. Hier vermuteten einige Gegner der „Rente mit 63“ die Gefahr, dass es zu einer neuen „Frühverrentungswelle“ kommen könne. Darauf hatte man dann bei den vereinbarten Korrekturen im Gesetzesentwurf reagiert: »Zeiten des Arbeitslosengeldbezugs werden wie bereits im vorliegenden Entwurf ohne zeitliche Beschränkungen angerechnet. Um (angebliche) Missbräuche auszuschließen, hat man sich nun darauf verständigt, dass Zeiten des Arbeitslosengeldbezugs in den letzten zwei Jahren vor der abschlagsfreien Rente mit 63 nicht mehr mitgezählt werden bei der Berechnung der erforderlichen 45 Beitragsjahre. Eine Ausnahme von diesem Ausschluss ist jedoch dann vorgesehen, wenn die Arbeitslosigkeitszeiten durch eine Insolvenz oder eine vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht wurden.«
Aber bereits damals habe ich in dem Beitrag darauf hingewiesen, dass die gefundene Regelung gewisse logische Inkonsistenzen aufweist, vor allem mit Blick auf die angestrebte „gerechte“ Lösung:
»Die Aufladung der „Rente mit 63″ mit Gerechtigkeitsüberlegungen erweist sich immer mehr als das, was es ist – eine große Illusion. Nehmen wir nur als Beispiel die neu gefundene Ausnahmeregelung, dass Zeiten der Arbeitslosigkeit zwei Jahre vor dem Renteneintritt in die abschlagsfreie Rente mit 63 dann anerkannt werden können bei der Berechnung der Beitragsjahre, wenn sie aus einer Insolvenz des Unternehmens resultieren. Die Besserstellung dieses Falls wird dem Arbeitnehmer sicher nicht besonders gerecht erscheinen, der mit 61 von seinem Arbeitgeber gekündigt wurde, beispielsweise aus betriebsbedingten Gründen und dem vielleicht ein oder gerade die zwei Jahre fehlen, um die abschlagfsreie Rente mit 63 in Anspruch nehmen zu können.«
Das alles ist schon schwierig genug. Jetzt aber gibt es Neuigkeiten von der Front der – für den einen oder die andere überraschenden – „Schlupflöcher“ oder „Schleichwege“. In dem Artikel Legaler Schleichweg in die Rente berichtet Karl Doemens von folgendem Tatbestand aus der „Rente-mit 63“-Welt hinsichtlich der beschlossenen Stichtagsregelung für das Anrechnen von Arbeitslosenzeiten:
»Zwar werden dem Gesetz nach die letzten beiden Jahre vor Beginn des Ruhestands nicht berücksichtigt. Aus einer schriftlichen Antwort des Sozialministeriums geht jedoch hervor, dass diese Sperrzeit entfällt, wenn die Betroffenen für wenige Stunden in der Woche einen Minijob übernehmen … Praktisch könnte also ein Arbeitnehmer mit 61 Jahren aus dem Job ausscheiden, zwei Jahre Arbeitslosengeld beziehen, in dieser Zeit wöchentlich vier Stunden als Verkäufer oder Fahrer arbeiten und damit den Anspruch auf die abschlagsfreie Rente mit 63 erwerben.«
Das ist innerhalb des bestehenden Systems mit der staatlichen Förderung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse absolut konsequent, wenn an dieser Stelle auch von den Protagonisten nicht gewünscht. Voraussetzung bei den Minijobbern ist allerdings, dass sie nicht auf die Rentenversicherungspflicht ihrer kleinen Beschäftigungsverhältnisse verzichtet haben. Dann arbeiten sie und zahlen Beiträge – wenn auch sehr kleine – in die gesetzliche Rentenversicherung ein und erfüllen damit natürlich in den bestehenden Systemen den Tatbestand, dass sie Beitragsjahre vorweisen können.
Das hat schon Eingang gefunden in die praktische Sozialberatung. Doemens weist in seinem Artikel auf ein internes Info-Blatt der Rechtsabteilung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hin, in dem der Minijob ab 61 ausdrücklich als eine „Lösungsoption“ empfohlen wird, um die Beitragszeit zu erreichen. Netto-Einkünfte bis 165 Euro im Monat werden nicht auf das Arbeitslosengeld angerechnet.
Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sieht keinen Grund für Nachbesserungen: „Dass diese Gestaltung in der Lebenswirklichkeit tatsächlich in nennenswertem Umfang angewendet wird, erscheint wenig wahrscheinlich“, so wird das Bundesarbeitsministerium zitiert. Glaube statt Wissen, das ist sowieso ein Strukturmoment der neueren Sozialgesetzbung.
Abschließend wieder zurück zu den eigentlich Betroffenen: Für die stellt sich das teilweise ganz anders dar als auf Seiten derjenigen, die jetzt eine „Frühverrentungswelle“ befürchten. Bereits angesprochen und hier noch einmal aufgerufen: Eines der Gerechtigkeitsprobleme, das aus dem bislang gefundenen Kompromiss zur Nichtanrechnung von Arbeitslosengeld I-Zeiten nach dem 61. Lebensjahr resultiert, ist die Tatsache, dass man zugleich eine weitere Ausnahme von dieser Regelung vereinbart hat, die vorsieht, dass dieser Ausschluss dann nicht greift, wenn der Arbeitslose deshalb Arbeitslosengeld I bezieht, weil sein Betrieb Insolvenz angemeldet hat. Wenn aber das Unternehmen nicht völlig den Bach runter geht, sondern „nur“ einzelne ältere Arbeitnehmer mit 61 Jahren entlässt, dann greift wieder die Nicht-Anrechnung. Wenn wir uns so einen Fall praktisch vorstellen, dann erweist sich das jetzt aufgezeigte „Schlupfloch“ tatsächlich als ein durchaus denkbare „Schleichweg“ oben in die Rente mit 63, nämlich in den Fällen, in denen zur Erfüllung der 45 Beitragsjahre gerade ein oder zwei Beitragsjahre fehlen. Die davon betroffenen können und werden – sollte es nicht noch eine nachträgliche Änderung im Gesetzentwurf geben – von der Möglichkeit Gebrauch machen, über einen Minijob die Voraussetzungen dann doch noch erfüllen zu können. Ihnen kann man es sicherlich am wenigsten verdenken, wenn sie das dann tun.