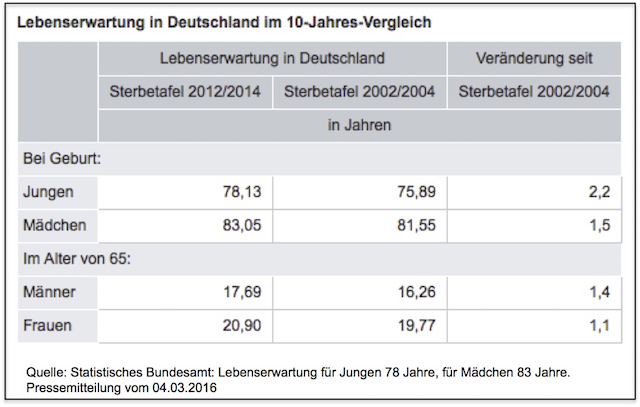Was ist denn da los? Seit Jahren wird seitens der Mainstream-Ökonomen das Thema Ungleichheit und (mögliche) negative Folgen daraus für die Gesellschaft marginalisiert und reflexhaft alle Diskussionsstränge hinsichtlich der (möglichen) Konsequenzen aus einer zunehmenden Ungleichheit als „Umverteilungsideologie“ und damit irgendwie ewiggestrig gebrandmarkt. Und wenn dann auch noch das Thema „Armut“ aufgerufen wird, setzt ein breites mediales Gegenfeuer ein, voller Empörung dahingehend, diesen Begriff in Deutschland überhaupt zu verwenden. Bei uns ist doch keiner arm. Man denke an dieser Stelle nur an die aggressiven Abwehrreaktionen, die von den „Armutsberichten“ ausgelöst werden. Das konnte jüngst erst wieder studiert werden am Beispiel des neuen Armutsberichts des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der diesmal zusammen mit weiteren Organisationen aus dem Sozialbereich herausgegeben wurde (vgl. dazu den Beitrag Von der Armut, ihren Quoten, ihrer kritischen Diskussion – und von abstrusen Kommentaren vom 23. Februar 2016 oder speziell zu den Folgen der Individualisierung, Personalisierung und Moralisierung von Arbeitslosigkeit und Armut das Interview: „Es geht darum, den Begriff Armut zu töten“). Aber offensichtlich tut sich was. Eine Menge im Vergleich zu den vergangenen Jahren, in denen die Marginalisierung des Themenfeldes innerhalb der Volkswirtschaftslehre in Deutschland durchaus erfolgreich gewirkt hat. Das Außenseiter- oder „linke“ Thema erfährt in diesen Tagen eine enorme Resonanz in den Medien. Wenn die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) eine eigene Rubrik Arm und Reich einrichtet und zahlreiche Artikel abfeuert, dann muss etwas in Bewegung gekommen sein. Offensichtlich sind die (Mainstream-)Ökonomen-Reihen nicht mehr fest geschlossen. Dazu gehört auch die Tatsache, dass das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL eine Titelgeschichte bringt unter der Überschrift „Die geteilte Nation. Deutschland 2016: Reich wird reicher, arm bleibt arm“ und darüber auch Werbung macht für das neue Buch des Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, das unter dem in Ökonomen-Kreisen fast schon revolutionär daherkommenden Titel Verteilungskampf. Warum Deutschland immer ungleicher wird (was bislang immer vehement bestritten wurde) veröffentlicht worden ist.
Der DIW-Chef Marcel Fritzsche hat sich für seine Zunft hier in Deutschland weit aus dem Fenster gelehnt: „Die soziale Marktwirtschaft existiert nicht mehr“, so wird er vom SPIEGEL zitiert. Ein echter Verstoß gegen ein semantisches Heiligtum. Aber letztendlich – und das erklärt einen Teil des derzeitigen Hypes um das Thema – reihen sich nun auch einige der prominenten Vertreter der Volkswirtschaftslehre in Deutschland ein in einen Trend, eine Bewegung, die in den angelsächsischen Ländern schon seit längerem diskutiert wird. Bereits im vergangenen Jahr meldete sich der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz mit dem Buch „Reich und Arm. Die wachsende Ungleichheit in unserer Gesellschaft“ zu Wort. Und es braucht sicher nicht mehr ausführlich begründet werden, warum Thomas Piketty mit seinem 2014 veröffentlichten Werk Das Kapital des 21. Jahrhunderts hier angeführt werden muss, wenn es um eine explizit ökonomische Kritik an der Ungleichheit geht.

Ende vergangenen Jahres erschien der von Ulrich Schneider herausgegebene Sammelband Kampf um die Armut. Von echten Nöten und neoliberalen Mythen. In diesem Buch findet man auch einen Beitrag von mir, der das jetzt so in den Mittelpunkt gerückte Thema – eine ökonomische Kritik an der Ungleichheit – behandelt hat. Dabei geht es darum, aufzuzeigen, dass es gute ökonomische Gründe geben kann, zum einen die zunehmende Ungleichheit als fundamentales und damit auch im Wirtschaftssystem wirkendes Problem zu identifizieren, zum anderen aber ist der Beitrag auch ein Plädoyer, sich nicht „nur“ begrenzen zu lassen auf die Gruppe der nach der heutigen statistischen Konvention armen bzw. armutsgefährdeten Menschen, sondern die „unteren 40 Prozent“ einer Gesellschaft in den kritischen Blick zu nehmen:
Stefan Sell: Das ist keine Armut, sondern »nur« Ungleichheit? Plädoyer für eine »erweiterte Armutsforschung« durch eine explizit ökonomische Kritik der Ungleichheit, S. 87-110.
Daraus einige hier relevante Aspekte, wobei sich angesichts der Komplexität eine zugegeben anforderungsvolle Textlänge sowie entsprechende Fußnoten mit Quellenhinweisen nicht vermeiden lassen:
Armut ist ein Teilbereich von Ungleichheit. Und Ungleichheit kann sich zwischen Staaten bzw. Gesellschaften und innerhalb von Staaten bzw. Gesellschaften ausprägen.
Dass es einem deutschen Hartz IV-Empfänger materiell besser geht als den Näherinnen in Bangladesch ist unstrittig, reflektiert aber erst einmal nur die Wohlstandsunterschiede zwischen den beiden Ländern.
Ein anderes, nicht nur räumlich näherliegendes Beispiel: Die enormen Wohlstandsunterschiede zwischen den Armenhäusern der EU, also Bulgarien und Rumänien, zu Deutschland sind Quelle folgenreicher Entscheidungen. Mobile Arbeitskräfte, sowohl mit sehr hohen Qualifikationen (man denke hier nur an die Ärzte aus den beiden Ländern, die mittlerweile in deutschen Krankenhäusern den Betrieb aufrecht erhalten, vor allem in Ostdeutschland) wie auch mit niedrigeren Qualifikationen (die dann als Werkvertragsarbeiter in den deutschen Billig-Schlachthöfen tätig sind oder auf dem Bau, um nur zwei Beispiele zu nennen), führen alle auf ihre Art zu einer weiteren Wohlstandssteigerung in Deutschland (und spiegelbildlich zu enormen, in den profitierenden Ländern in aller Regel völlig ausgeblendeten gesellschaftlichen Verwüstungen in den Ländern, aus denen die Migranten kommen. Man verdeutliche sich das am Beispiel der geschätzt 150.000 – 200.000 osteuropäischen Frauen, die als Haushaltshilfen und Pflegekräfte in Familien in Deutschland dazu beitragen, dass unser Pflegesystem noch nicht zusammengebrochen ist. Viele dieser Frauen haben Familie und müssen monatelang ihre Kinder zurück lassen. Viele von ihnen müssen als Folge der Pendelmigration, die sich hier entwickelt hat, monatelang irgendwie allein über die Runden kommen, wenn sie nicht aufgefangen werden können durch daheim vorhandene Familienmitglieder).
Ein Teil des von den Migranten hier erwirtschafteten Geldes fließt über Transfers an die Familien wieder zurück in die Heimatländer. Aber mit Blick auf den Entzug an Arbeitskräften, vor allem wenn es sich um solche mit teuren Investitionen in deren Humankapital handelt wie bei den Ärzten, führt zu erheblichen Wohlstandsverlusten für die abgebenden Länder. Und in vielen Fällen ist das Auslöser mittel- und langfristig oftmals zerstörerischer Prozesse bei den schwächeren Playern, die übrigens dazu führen, dass entsprechend des Matthäus-Prinzips die, die schon viel haben, immer mehr oder alles bekommen, während die anderen leer ausgehen. Wir sind hier bei dynamischer Betrachtung eben konfrontiert mit kumulativen Prozessen, oftmals in Form einer Scherenentwicklung.
Wenn wir den Blick weiten von der Unsinnigkeit eines anscheinend (wieder) in Richtung auf irgendeine „absolute“ Armutsdefinition zielenden Diskurses über die letztendlich „defensive“ Verteidigung gesetzter relativer Einkommensschwellenwerte zur Bestimmung von Armut und Armutsgefährdung hin zu einer kritischen Betrachtung der Ökonomie der Ungleichheit, dann zeigen viele neuere Studien, dass Ungleichheit auch und gerade nach den Kriterien und Bezugssystemen der „etablierten“ Wirtschaftswissenschaft zunehmend negativ gesehen wird. Und dies eben nicht nur hinsichtlich der individuellen Verwüstungen, die eine ausgeprägte und wachsende Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft anrichten, sondern gerade volkswirtschaftlich im Sinne einer negativen Ungleichheitsbilanz bei Parametern wie Wirtschaftswachstum, Innovationen usw.
Nun gab und gibt es schon immer auch eine sehr kritische Linie innerhalb der Wirtschaftswissenschaft, die schon lange auf die Problematik der Ungleichheitsfolgen hingewiesen und wirtschaftspolitische Konsequenzen eingefordert hat, was sie zugleich ihre Marginalisierung befördert, denn diese Konsequenzen können hinsichtlich eines Ziels, das da lautet Ungleichheit zu reduzieren, nur umverteilender Natur sein, was immer auch bedeutet, das man irgendwo und vor allem jemanden etwas weg nehmen muss. Stellvertretend für diese Linie muss die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik genannt werden, die jedes Jahr ihr Memorandum, eine Art Gegengutachten zu dem Jahresgutachten der fünf Wirtschaftsweisen, veröffentlicht. Auch im Memorandum 2015 kann man in der Kurzfassung unter der Überschrift „Das Dilemma der ungleichen Verteilung“ lesen:
„Der Schlüssel für eine andere wirtschaftliche Entwicklung liegt (neben der Re-Regulierung der Finanzmärkte) in der Verteilung von Einkommen und Vermögen. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik weist seit vielen Jahren auf den eigentlich trivialen Zusammenhang hin: Ohne eine Steigerung der Masseneinkommen (Löhne und Transferleistungen) gibt es keine Ausweitung der privaten Konsumausgaben. Ohne eine bessere Finanzausstattung des Staates werden die öffentlichen Investitionen nicht erhöht. Ohne eine stärkere Nachfrage werden auch die privaten Investitionen nicht gesteigert. Lange Zeit war die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik damit die einsame und wenig beachtete Ruferin in der Wüste.“ 1)
Auch das in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung angesiedelte Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) unter Leitung von Gustav Horn hat sich immer wieder durch fundierte Beiträge in die ökonomische Diskussion über Ungleichheit und ihre Folgen eingebracht. So publizierte das IMK im September 2014 eine Veröffentlichung mit der Überschrift „Wirtschaftskrise unterbricht Anstieg der Ungleichheit“. 2) Der krisenbedingte Einbruch der Unternehmens- und Vermögenseinkommen Ende der 2000er Jahre im Kontext der großen Finanz- und Wirtschaftskrise hat den Anstieg der Einkommensungleichheit kurzfristig durchbrochen. Aber: Mittelfristig scheint der Trend ansteigender Einkommensungleichheit jedoch anzuhalten, da die Unternehmens- und Vermögenseinkommen im Zuge der gesamtwirtschaftlichen Erholung seit 2012 wieder überproportional steigen.
Im Oktober 2014 veröffentlichte das IMK eine Studie mit dem Titel „Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland: Eine makroökonomische Sicht“. 3) Diese Untersuchung ist deshalb auch besonders relevant, weil sie Bezug nimmt auf die Debatte rund um Thomas Piketty und sein Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“. Bereits vor Pikettys Bestseller hatten Ergebnisse der Verteilungsforschung in Deutschland vermehrt für Schlagzeilen gesorgt. Beispielsweise zeigten Studien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dass die Einkommensungleichheit in den letzten eineinhalb Jahrzehnten in kaum einem anderen OECD-Land stärker gestiegen ist als in Deutschland. „Ebenfalls für großes Aufsehen sorgten im vergangenen Jahr die Ergebnisse einer von der Europäischen Zentralbank (EZB) koordinierten Haushaltsbefragung (HFCN 2013), wonach die Vermögensungleichheit innerhalb der Europäischen Union in Deutschland nach Österreich am größten ist“, so das IMK in seinem Report.
Die IMK-Studie hat einerseits aufzeigen können, welche Datenlücken wir in Deutschland im oberen Einkommens- und Vermögensbereich derzeit (noch) haben, was insgesamt zu einer erheblichen Unterschätzung der Ungleichheitsstrukturen führt. Zugleich aber finden wir im Fazit eine gute Überleitung zu dem nächsten Begründungsstrang einer ökonomischen Kritik an der wachsenden Ungleichheit:
„Die Debatte zur Wiedereinführung der Vermögensteuer … und zur Anhebung des Einkommensteuersatzes für Spitzenverdiener sollte viel starker als bisher unter dem Aspekt geführt werden, dass eine Reduzierung der ökonomischen Ungleichheit auch die Gefahr zukünftiger Wirtschaftskrisen senkt. Nach den Erfahrungen der Großen Depression wurde der Zusammenhang zwischen Ungleichheit und makroökonomischer Instabilität schon einmal verstanden. In den USA etwa erhöhte der Wealth Tax Act als Teil des New Deal von Präsident Franklin D. Roosevelt und als Antwort auf die Weltwirtschaftskrise von 1929 den Spitzensteuersatz der Einkommensteuer auf 79 %.“
Bei allen Argumenten, die bislang zitiert wurden, kann und wird man natürlich aus dem Mainstream den Einwand hören, dass es sich um Minderheitenmeinungen handelt, um keynesianisch argumentierende Ökonomen. Deshalb macht es Sinn, in einem nächsten Schritt aufzuzeigen, dass eine explizit ökonomische Kritik an der Ungleichheit, vor allem an der weiter zunehmenden Ungleichheit, auch und immer öfter aus Institutionen kommt, denen man nun in keinerlei Hinsicht das Etikett „linke“ Ökonomen oder Abweichler von der herrschenden Meinung hinsichtlich ihrer volkswirtschaftlichen Analysen aufkleben kann: Gemeint sind hier die OECD, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank.
Wegweisend sind die Studien der OECD zum Thema Ungleichheit, die nicht nur umfangreiche Analysen vorgelegt, sondern auch explizit wirtschafts- und sozialpolitische Schlussfolgerungen gezogen haben.
Bereits 2008 (Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries) und 2011 (Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising) hatte die OECD zwei umfangreiche Studien über die zunehmende Ungleichheitsentwicklung in den OECD-Staaten veröffentlicht. 2015 folgte eine weitere und überaus hilfreiche Studie unter dem Titel „In It Together. Why Less Inequality Benefits All“, in der materialreich nachgewiesen wird, warum es aus einer explizit ökonomischen Perspektive sehr viel Sinn macht, sich in das Lager der Ungleichheitskritiker und derjenigen, die durch wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen eine Umsteuerung anstreben, zu schlagen. 4)
Die beiden entscheidenden Punkte in dieser Studie aus dem Jahr 2015: Die OECD weist zum einen darauf hin, dass gesicherte empirische Evidenz dafür vorliegt, dass die mittlerweile gegebenen Ungleichheitsstrukturen erheblich negative Effekte auf das langfristige Wirtschaftswachstum haben. Und zum anderen kann die OECD zeigen, dass es sinnvoll ist, sich nicht wie bislang zu fokussieren auf die untersten 10 Prozent einer Gesellschaft, also auf die Ärmsten der Armen (und wie die Deutschen sagen würden: „Armutsgefährdeten“), sondern der festgestellte größte Einflussfaktor auf die negativen Effekte von Ungleichheit auf das Wachstum ist die zunehmende Lücke zwischen „lower income households“ und dem Rest der Bevölkerung – wobei mit „Niedrigeinkommenshaushalten“ die unteren 40 Prozent gemeint sind. Gerade für Deutschland wichtig ist dann diese Schlussfolgerung: „Countering the negative effect of inequality on growth is thus not just about tackling poverty but about addressing low incomes more broadly.“ 5)
Dies ist eine Aufgabe, die sich gerade in Deutschland stellt – denn viele Menschen in den unteren 40 Prozent haben in den vergangenen Jahren eine erhebliche Verschlechterung beispielsweise der Arbeitsbedingungen, zu denen auch die Löhne gehören, erleben müssen. Gleichzeitig sind sie Arbeitslosigkeit wie auch den Kostensteigerungen beispielsweise bei Mieten und Strom wesentlich härter ausgesetzt als die oberen 60 Prozent. In diese Gruppe der 40 Prozent fallen eben nicht nur die Hartz IV-Empfänger, sondern zugespitzt formuliert die „wahren“ Leistungsträger, die viele Unternehmen und Dienstleistungen am Laufen halten.
Bei den wirtschafts- und sozialpolitischen Schlussfolgerungen der OECD fällt auf, dass darauf hingewiesen wird, dass es eben nicht ausreicht so viel Erwerbsarbeit wie nur möglich zu schaffen, egal, wie die ausgestaltet ist. Die OECD-Ökonomen plädiere für eine Beschäftigungsförderung in Verbindung mit einer Ausrichtung auf Jobs guter Qualität. Die vielen Jobs schlechter Qualität, von denen wir gerade im angeblichen „Jobwunderland“ Deutschland ein Lied singen können, haben nach den vorliegenden Analysen in vielen Ländern, auch bei uns, dazu beigetragen, dass die Ungleichheit zugenommen hat und weiter ansteigen wird, wenn sich nichts ändert. Und auch hinsichtlich der Gestaltung des Steuer-Transfer-Systems für eine effiziente Umverteilung streuen die OECD-Ökonomen Salz auf die Wunden vieler Umverteilungsgegner: Die OECD fordert, dass die Progression im Steuersystem wieder ausgebaut wird, sie plädiert für eine Erhöhung der Einkommenshilfen für untere Einkommensgruppen und betont die antizyklische Ausgestaltung der Sozialausgaben, was eben bedeuten würde, sie in Krisen gerade nicht zu kürzen. Alles Teufelszeug für viele, die sich ansonsten immer auf „die“ Ökonomen berufen.
Abschließend wieder zurück zum DIW-Chef. Ungleichheit kostet Wachstum, so hat Markus Sievers seinen Artikel über das neue Buch von Marcel Fratzscher überschrieben. Darin findet man diese Zusammenfassung der Fratzscher’schen Argumentation:
»Fratzscher stützt seinen Befund auf drei Indikatoren. Erstens seien die Vermögen in keinem anderen Land der Eurozone ungleicher verteilt. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung besitze praktisch gar kein Vermögen, wenn man die Schulden und andere Verpflichtungen berücksichtige. Aber auch an der Spitze sei Deutschland „extremer als seine Nachbarn“. Im kaum einem anderen Land auf dem Kontinent besäßen die reichsten zehn Prozent größere Vermögenswerte. Zweitens klaffe die Schwere auch bei den Einkommen zunehmend auseinander. Rund die Hälfte der Arbeitnehmer büße seit 15 Jahren an Kaufkraft an. Über deutliche Zuwächse dürften sich allein die mit den höchsten Löhnen freuen. Und drittens beklagt der DIW-Präsident die geringe Mobilität. Wer es einmal geschafft habe, müsse kaum befürchten, seine Position wieder zu verlieren. Am stärksten ausgeprägt ist der Stillstand laut Fratzscher bei den oberen und unteren zehn Prozent.
Vor allem auf den letzten Punkt, die Chancenungleichheit, stellt der Volkswirt ab. Sie sieht er auch als Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung. Lange sahen Ökonomen große Unterschiede zwischen Oben und Unten als notwendiges Übel. Nötig, um den Einzelnen zu motivieren, sich anzustrengen. An dieser Überzeugung, jedenfalls in dieser Schlichtheit, rütteln seit einigen Jahren internationale Organisation wie der IWF oder die OECD mit Studien. Fraztscher schließt sich diesen Zweifeln an der orthodoxen Lehre an. „Von zu hoher Ungleichheit werden nicht nur die Einzelpersonen, sondern auch die Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt geschwächt“, folgert Fratzscher. Genau dies sei in Deutschland der Fall. Und er verweist auf Berechnungen der OECD, denen zufolge der Anstieg der Einkommensungleichheit seit den 1990er Jahren sechs Prozent an Wirtschaftsleistung gekostet hat.«
Ganz schwach wird es aber bei den politischen Schlussfolgerungen, über die berichtet wird: »Von der Politik verlangt er vor allem mehr Anstrengungen in der Familien- und Bildungspolitik, etwa mehr Unterstützung durch Kitas und eine ordentliche Betreuung in den Schulen. Einen stärkeren Ausgleich durch Steuern lehnt Fratzscher ab. Deutschland verteile mit seinem Steuern- und Abgabensystem genug Geld um – allerdings viel zu oft innerhalb von Einkommensklassen und ohne großen Effekt auf den Zusammenhalt der Gesellschaft.«
Schwach nicht deshalb, weil er die Familien- und Bildungspolitik anspricht und in das Zentrum zu rücken versucht – sondern wenn man weiß, wie schwer kompensatorische Ansätze über die Bildungspolitik zu realisieren sind und was wir mittlerweile wissen über die Scherenentwicklung zwischen „guter“ und „schlechter“ Kindheit, dann muss man schon sehr optimistisch sein, um daran zu glauben, in Kitas und Schulen den Schlüssel für eine fundamentale Schubumkehr bei der Ungleichheitsentwicklung gefunden zu haben. Daran haben sich schon Generationen vorher relativ erfolglos abgearbeitet.
Es gibt noch eine zweite Kritiklinie an dem generellen Ansatz, der jetzt so popularisiert wird, also dem Hinweis, dass Ungleichheit schlecht sei für „harte“ ökonomische Parameter wie dem Wirtschaftswachstum. Geistige Verrenkungen eines besorgten Ökonomen: Eine Polemik zu „Verteilungskampf“, so hat Norbert Häring einen Blog-Beitrag überschrieben. Sein Ansatzpunkt für eine Kritik findet man in diesem Zitat: »Hier sorgt sich jemand – bitte festhalten – dass erhöhte Ungleichheit die Zunahme des für Verteilung blinden und als Wohlstandsmaß ungeeigneten Indikators Bruttoinlandsprodukt dämpfen könnte.«
Er weist darauf hin, dass auch unter Mainstream-Ökonomen mittlerweile unstrittig sei oder sein sollte, dass das Wirtschaftswachstum gemessen als Veränderung des BIP nicht als Wohlstandsmaß taugt, aus vielen Gründen. Mit Blick auf das hier im Mittelpunkt stehende Thema Ungleichheit hebt er hervor:
»Das BIP ist völlig verteilungsblind. Ob eine Million alleinerziehende Mütter mit ihren zwei Millionen Kindern, die unter ärmlichen Bedingungen gerade so durchkommen, pro Familie 1000 Euro mehr im Jahr haben, und sich damit anständiges Essen und anständige Kleider kaufen können, oder ob ein Hedgefondsmanager zwei Milliarden Euro statt nur einer verdient, macht keinen Unterschied für das BIP. Niente, zero, nada, nichts. Es ist genau das gleiche. (Für den Staat macht es allerdings einen Unterschied, weil der Hedgefonds Manager im Gegensatz zu den Familien keine Steuern zahlt, aber das ist ein anderes Thema.)«
Wenn also Ökonomen feststellen, dass Ungleichheit Wachstum bremst, stellt sich doch die Frage: Welches Wachstum? Das Wachstum der Einkommen der armen Familien oder das Wachstum der Einkommen des oberen Prozent? Wir kennen die Antwort.
Gerade vor diesem Hintergrund erscheint dann die Abwehr einer stärkeren Umverteilung von oben nach unten bei den wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen von Fratzscher so schwach – vielleicht wollte er es sich auch einfach nur nicht zu stark verderben mit den anderen Mainstream-Ökonomen.
Besonders kompakt und den ganzen Ansatz ablehnend kommt das Fazit von Norbert Häring daher: »Wenn es uns nicht aufregt, dass die Armen ärmer werden, während die Mittelschicht bestenfalls stagniert und die schon unanständig Reichen grotesk reich werden, dann sollen wir nun anfangen uns zu sorgen, weil dadurch das BIP nicht richtig steigt. Nein danke. Diejenigen, die es stört, die wissen schon, was falsch läuft. Sie sollten nicht der Versuchung erliegen, Ökonomen für Experten auf diesem Gebiet zu halten und um Rat zu fragen. Ökonomen sind seit langem Experten darin, mit ihren Messlatten und Theorien Verteilungskonflikte unsichtbar zu machen. Je weniger Ökonom man ist, desto leichter sieht man sie.«
________________________________________
1) Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik: Memorandum 2015. Kurzfassung, Bremen 2015, S. 7.
2) Horn, G. A., Gechert. S., Rehm, M. und Schmid, K. D.: Wirtschaftskrise unterbricht Anstieg der Ungleichheit. IMK Report, Nr. 97, Düsseldorf 2014.
3) Behringer, J., Theobald, T. und Till van Treeck: Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland: Eine makroökonomische Sicht. IMK Report, Nr. 99, Düsseldorf 2014.
4) OECD: In It Together. Why Less Inequality Benefits All, Paris 2015.
5) OECD (2015: 26). Gestützt wird die OECD-Argumentation auch aus den Reihen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Bereits im vergangenen Jahr wurde dort eine wichtige und überaus deutliche Studie veröffentlicht: Ostry, J. D., Andrew Berg, A. and Tsangarides, C. G.: Redistribution, Inequality, and Growth, Washington, February 2014.