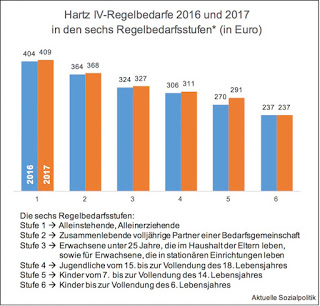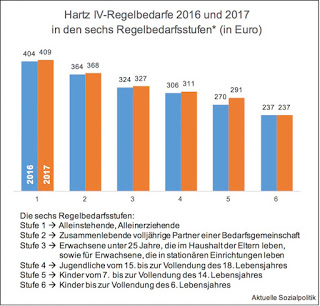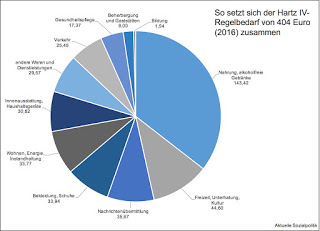Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 27. Juli 2016 – 1 BvR 371/11 wieder einmal ein „Hartz IV-Urteil“ gesprochen. Es geht um die Einkommensanrechnung in einer „Bedarfsgemeinschaft“ eines Vaters mit einer Erwerbsunfähigkeitsrente, der seinen bedürftigen Sohn bei sich in der Wohnung aufgenommen hat. Diese sei rechtmäßig und auch der abgesenkte Regelbedarf des noch nicht 25 Jahre alten Sohnes ebenfalls. Der Beschluss und die dort vorgenommene Argumentation wurde bereits in einer ersten Kommentierung auf dieser Seite kritisch unter die Lupe genommen: Das Bundesverfassungsgericht fordert elterlich-monetäre Solidarität mit den Kindern und fördert zugleich die Auflösung der familiären Bande? Ein Kommentar zum Beschluss 1 BvR 371/11 vom 7. September 2016.
Bevor der Staat Hartz IV nach den Regeln des SGB II zahlt, erzwingt er die Unterstützung von Partner und Familie – wenn alle in einem Haushalt leben. Dass das BVerfG diesen Tatbestand für rechtens erklärt hat, ist wenig überraschend – es segnet damit nur die gängige Praxis ab. Also grundsätzlich, aber eben nicht immer, worauf in der ersten Kommentierung bereits angewiesen wurde, denn vereinfachend und zuspitzend formuliert gilt das nur für die „gutmütigen“ Familien, nicht aber für die – ob faktisch oder nur auf dem Papier – „zerrütteten“ und auch die gut bestückten eigentlichen Bedarfsgemeinschaften können sich der Verpflichtung mehr oder weniger elegant entziehen.
In der ersten Kommentierung wurde mit Blick auf die differenzierte Argumentation der Verfassungsrichter zusammenfassend bilanziert:
»Wenn man die niedrigeren Leistungen für das volljährige Kind und die Anrechnung elterlichen Einkommens nicht schlucken will, wird man gezwungen sein, die gerade erst wieder vom BVerfG abgesegneten elterlich-monetären Fürsorgebande zu durchtrennen über eine (reale? simulierte?) familale Zerrüttung, deren Existenz oder Behauptung ja auch in den Augen der Verfassungsrichter dazu führt, dass die Kinder nicht mehr Bestandteil der Bedarfsgemeinschaft sein können. Wie sich dann die „zerrüttete“ Familie in der Wirklichkeit verhält, kann von Alpha bis Omega reichen und entzieht sich übrigens im Fall der nur auf dem Papier bestehenden Zerrüttung und des faktischen Zusammenhaltens und -wirtschaftens der eigentlich damit verbundenen rechtlichen Konsequenzen, die nun ja auch durch das BVerfG abgesegnet worden sind. Mithin, so die nur auf den ersten Blick irritierende Zuspitzung, leistet der Beschluss des BVerfG einen aktiven Beitrag zur Auflösung der ansonsten verfassungsrechtlich so hoch gehaltenen familiären Bande.
Die offensichtlich erkennbare Malaise kann so formuliert werden: Wenn man sich dem doppelten Druck der a) Einkommensanrechnung bei den Eltern (was andere Erwachsene nicht haben) und b) dem auf 80 Prozent abgesenkten Regelbedarf (der niedriger liegt als bei den anderen Erwachsenen) entziehen will/muss, dann ist man gezwungen, die Situation einer Verweigerung der elterlichen Solidarität herbeizuführen oder – seien wir realistisch – zumindest eine solche zu simulieren. Dass die Ehrlichen wieder einmal die – vom Ergebnis her gesehen – Dummen sind, sei hier nur angemerkt.«
Gernot Kramper hat nun in seinem Kommentar diesen Aspekt und weiterführende Gedanken aufgenommen und unter der Überschrift Hartz-IV-Urteil – jetzt wird Armut ansteckend veröffentlicht.
Auch Kramper geht in seinen Ausführungen auf den Entstehungshintergrund der jetzigen Rechtslage ein, die mit der Einführung des SGB II und der damit verbundenen Ablösung der bis dahin geltenden Regelungen des Bundessozialhilfegesetzes verbunden waren und die man durchaus als Paradigmenwechsel bezeichnen muss, denn bis zum SGB II gab es ein Rückgriffsrecht des Sozialamtes bei Bedürftigkeit eines – auch erwachsenen – Kindes gegenüber den unterhaltsverpflichteten Eltern. Man hat sich, wenn was zu holen war, das Geld bei den Eltern wieder geholt und diese in die Pflicht genommen. Das wurde – eigentlich – mit dem SGB II abgeschafft bei den erwachsenen Kindern. Aber eben nur eigentlich, wie auch Kramper anmerkt:
»Mit der Agenda 2010 fand die Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) 2005 einen cleveren, doch perfiden Dreh, die Unterhaltspflicht in der Theorie fallen zu lassen und in der Praxis noch zu verschärfen. Und das ging in etwa so: „Wir wissen, dass ihr keinen Unterhalt zahlen müsst. Aber wenn wir den Bedarf des Hartzers berechnen, rechnen wir euch trotzdem mit ein. Der kriegt einfach weniger vom Staat. Ihr werdet ihn ja nicht verhungern lassen.“ Bedarfsgemeinschaft nennt sich das Konstrukt der Schröder-Regierung. Und besonders toll: Beim Unterhalt von erwachsenen Kindern gab es immer strikte Höchstgrenzen, bei der Hartz-IV-Berechnung nicht. Hier wird so lange angerechnet, bis alle in der Bedarfsgemeinschaft auf Hartz-IV-Level sind.«
Und auch Kramper identifiziert den entscheidenden Punkt, auf den ich bereits in ersten Kommentar hingewiesen habe:
»Und der erfolgreiche Schutz vor Armut funktioniert genauso wie einst bei Lepra: Am besten meidet man jeden Kontakt zu den Befallenen. Im verhandelten Fall wurde der Vater nur Opfer seiner Gutmütigkeit und Naivität. Er war eben dumm, seinen Sohn weiter zu beherbergen. Hätte er ihn an die Luft gesetzt, wäre ihm eine Menge Ärger erspart geblieben.«
Die Konsequenz daraus kann man mit Kramper durchaus als eine „sozial zersetzende Wirkung“ bezeichnen, denn: »Kam früher ein Familienmitglied in Not, war es der erste Impuls der Verwandten, ihm Obdach zu gewähren. Heute muss man sagen: Alles, nur das nicht! Ist der Arme erst einmal in der Wohnung, wird eine Bedarfsgemeinschaft vom Amt unterstellt und die Verwandten werden bis aufs Hemd ausgezogen. Eigeninitiative und Unterstützung von Verwandten ist schön und gut – aber mal Hand aufs Herz: Wer ist so großzügig, dass er selbst dauerhaft auf Sozialfall-Niveau absinken will?« Eine gute und notwendigerweise zu stellende Frage.
Aber Kramper geht in seiner Kritik auf eine weitere für die Lebenswirklichkeit wichtige Differenzierung ein, die hier herausgestellt werden soll: Die Inpflichtnahme der Eltern in einer Bedarfsgemeinschaft gilt – eigentlich – für alle, aber faktisch nur für die ärmeren Haushalte, wenn sie sich denn so verhalten, wie man es von ihnen erwartet, denn kann sind sie kaum bis gar nicht in der Lage, sich der Kollektivierung durch das Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft zu entziehen: »Wer in seiner Mietwohnung mit drei Zimmern die Tochter mit Kind aufnimmt, die vor ihrem gewalttätigen Mann geflohen ist, wird schnell auf die Bedarfsgemeinschaft festgenagelt. Eine Küche, ein Bad, ein Kühlschrank – da ist es schwer zu beweisen, dass man nicht aus einem Topf wirtschaftet.« Hier schlägt dann die Verbedarfsgemeinschaftlichtung voll durch.
Aber bei anderen Familien ist das anders und damit legt Kramper den Finger auf eine weitere Wunde der eben nicht von allen eingeforderten Beteiligung der Eltern an der Bedürftigkeit des Kindes:
»Nehmen Besserverdiener und Cleverle ihre mittellose Tochter mitsamt Enkel auf, haben sie tausend Möglichkeiten der Hartz-Haftung zu entgehen. Das geht, weil sie wirtschaftlich so beweglich sind, dass sie durch passende Gestaltung der Anrechnung für die Leistungen der Tochter leicht entgehen können. Etwa so: Sie vermieten der Tochter einfach die leer stehende Einliegerwohnung. Damit umgehen sie die Bedarfsgemeinschaft – keine gemeinsame Wohnung – und lassen sich ihre Hilfsbereitschaft noch vom Amt honorieren. Vielleicht nicht fair, aber raffiniert. Doch selbst, wenn das gut situierte Elternpaar keine Einliegerwohnung hat, muss man nicht verzweifeln. Der Klassiker: Mama und Papa mieten eine Wohnung am Markt und vermieten die Bleibe an Tochter und Enkel unter.«
Man erkennt schon an diesen wenigen Zeilen, was für Gestaltungsoptionen sich denen eröffnen, die haben und die im Ergebnis nichts abgeben müssen, während die anderen, die wenig haben, auch noch in die Mangel genommen werden, wenn sie sich den „Fehler“ erlauben, familiäre Solidarität zu praktizieren auch unter sehr prekären Bedingungen. Dazu bemerkt Kramper mit Blick auf die aktuelle Entscheidung des BVerfG: Der unterlegene Kläger soll dagegen von seiner kümmerlichen Erwerbsunfähigkeitsrente abgeben. Mit 615 Euro Rente habe er schließlich „hinreichende Mittel“ und müsse „zur Existenzsicherung seines Sohnes beitragen“.