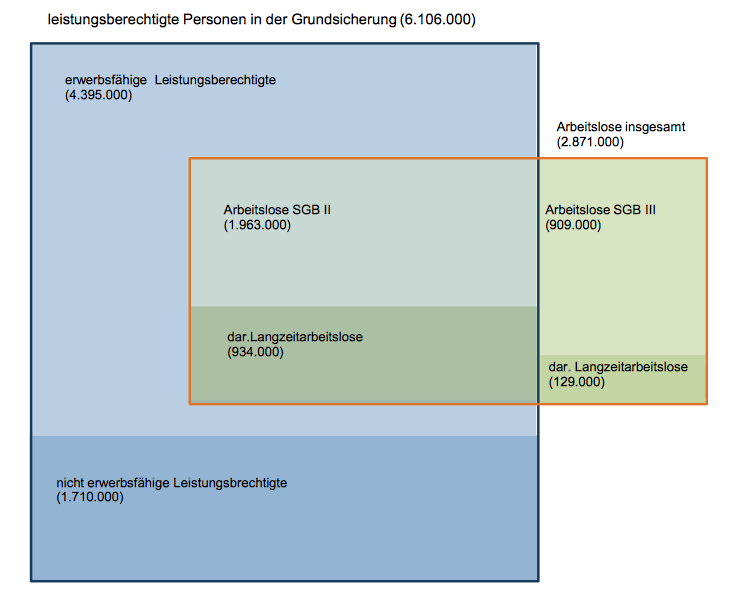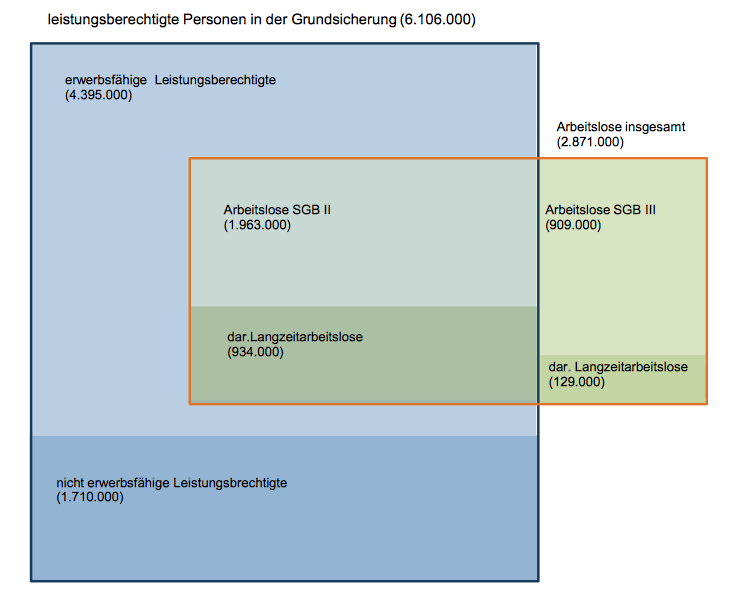»Es gibt einen Anreiz, all jene zu vernachlässigen, bei denen eine Vermittlung eher unwahrscheinlich oder ausgeschlossen ist. Genau diese Leute werden aber in Zukunft das größte Problem sein.«
Einer von mehreren wichtigen Sätzen in einem Interview mit dem Jobcenter-Leiter von Gelsenkirchen, Reiner Lipka, das unter der bezeichnenden Überschrift „Wir versündigen uns“ veröffentlicht worden ist.
Der Hinweis auf die seiner Meinung nach falschen bzw. problematischen Anreize beziehen sich nicht auf irgendwelche Dritte, sondern auf die Institution, in der er selbst arbeitet: »… weil wir zu sehr auf die Arbeitslosenzahlen fixiert sind, tun wir im Moment zu oft das Falsche … Die Jobcenter in Deutschland konzentrieren sich darauf, so viele Menschen wie möglich in Arbeit zu bringen. Danach werden wir alle bewertet, es gibt Rankings: Je weniger Arbeitslose, desto besser.«
Aber er bleibt nicht im Abstrakten stecken, sondern verdeutlicht am Beispiel seiner Stadt Gelsenkirchen, dass es hier um Menschen geht, mit ihren eigenen Geschichten, zugleich eingebettet in eine Umgebung, die für viele der Betroffenen gar nicht erst den Hauch einer Chance eröffnen kann:
»Wenn Sie von hier durch die Fußgängerzone zum Bahnhof gehen, können Sie die Transferempfänger abzählen: Jede vierte Familie in Gelsenkirchen bekommt Hartz IV, viele davon seit Jahren. Wir haben in Gelsenkirchen durch den Wegfall der Zechen und Montanarbeitsplätze 60.000 Arbeitsplätze verloren. Danach hat die Stadt versucht, neue Branchen anzuziehen: Glasindustrie, Bekleidungsindustrie, Solartechnik. Das hat alles nicht funktioniert. Deshalb haben wir heute 75.000 sozialversicherungspflichtige Jobs und 32.000 Hartz-IV-Empfänger.«
Was das für den einzelnen Menschen bedeuten kann, illustriert Lipka an diesem Beispiel:
»Das ist … die 50-jährige alleinstehende Frau, die früher in der Bekleidungsindustrie gearbeitet hat und heute keine Stelle findet. McDonald’s nimmt sie nicht, weil sie dem Unternehmen nicht gut genug ist. Das Callcenter will sie nicht, weil ihre Sprachkompetenz nicht ausreicht. In die Gastronomie können wir nicht vermitteln, weil das Aussehen nicht dem entspricht, was der Arbeitgeber sich wünscht. Es ist doch zynisch, dieser Frau zu sagen: „Jetzt streng dich doch mal was an.“«
Oder wie wäre es mit den Männern, die jahrelang an der Blechpresse gearbeitet haben, die es heute nicht mehr gibt?
Das Gelsenkirchener Jobcenter muss sich eben nicht um „die“ Hartz IV-Empfänger kümmern, den „den“ Hartz IV-Empfänger gibt es nicht. Sondern vor Ort sieht es aus seiner Perspektive so aus:
»Von den 32.000 Hartz-IV-Empfängern können wir 8.000 gar nicht vermitteln, weil sie etwa krank sind oder als 18-Jährige noch zur Schule gehen. Bleiben 24.000. Die besten 6.000 davon können wir noch in Arbeit bringen, wenngleich oft nur für kurze Zeit. Im Durchschnitt sind die Leute fünf Monate beschäftigt, bis sie zu uns zurückkommen.«
Das stellt sich natürlich die Frage: Was tun? Wie kann, wie muss man sich als Jobcenter aufstellen?
Auch dazu hat er eine klare Meinung:
»Die Arbeitsvermittler sind doch heute längst nicht mehr nur Arbeitsvermittler. Sie sind Lehrer, Seelsorger, alles in einem. Die Bundesagentur stellt sich zwar noch immer auf den Standpunkt, dass wir Arbeitsvermittler nicht die Reparaturkolonnen der Republik sein können. Die Frage lautet aber: Wer soll es sonst sein? Nach uns kommt doch keiner. 40 Prozent aller Kinder, die in Gelsenkirchen geboren werden, wachsen in einer Hartz-IV-Familie auf. Ich würde gerne wissen: Was soll aus denen werden?«
Und das leitet über zu dem, was er an Handlungsnotwendigkeiten und Handlungsmöglichkeiten für die Arbeitsvermittlung im Jobcenter sieht.
Er plädiert zum einen deutlich für mehr öffentlich geförderte Beschäftigung: »Wir brauchen wieder mehr öffentliche Beschäftigung. Wenn die Unternehmen die Jobs nicht schaffen, muss es eben der Staat tun. Wir haben so viele Arbeitslose, die gerne etwas tun würden – sie wären so dankbar. Und wir sollten darüber nachdenken, ob reichere Kommunen nicht den ärmeren helfen können.«
Dies zu fordern ist wichtig und setzt einen Punkt – genau so wie die Stellungnahme des nordrhein-westfälischen Arbeitsministers Guntram Schneider (SPD):
»In NRW fehlen Möglichkeiten, Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose zu schaffen. Derzeit seien in NRW rund 300.000 Langzeitarbeitslose gemeldet, sagte Arbeitsminister Guntram Schneider (SPD) … Das sei etwa ein Drittel der bundesweit Betroffenen. „Wir haben eben andere Verhältnisse als in München oder auf der Schwäbischen Alb“, sagte Schneider dazu. Der Bund müsse mehr Mittel bereitstellen – vor allem für Nordrhein-Westfalen. Nötig seien Zehntausende Plätze im sogenannten sozialen Arbeitsmarkt.« (Quelle: Langzeitarbeitslosigkeit: Schneider fordert Hilfe vom Bund)
Die Problemlage in NRW schreit förmlich nach Initiativen in diesem Bereich: »NRW hat deutschlandweit die meisten Langzeitarbeitslosen: 40 Prozent der 777.000 Arbeitslosen waren Ende Juli bereits länger als ein Jahr ohne Arbeit. Die Bundesagentur für Arbeit sieht das Hauptproblem in der fehlenden Ausbildung. 60 Prozent der Langzeitarbeitslosen in NRW haben keine berufliche Ausbildung – bei Arbeitslosen unter 25 Jahren haben sogar 75 Prozent keine Berufsaubildung. „51 Prozent der Arbeitslosen suchen eine Helferstelle, wir haben aber insgesamt nur 15 Prozent Angebote für Ungelernte“, warnte Werner Marquis von der NRW-Regionaldirektion der Bundesanstalt«, so Wilfried Giebels in seinem Artikel Fast jeder zweite Arbeitslose in NRW findet keinen neuen Job.
Hintergrund der Forderung nach mehr öffentlicher Beschäftigung ist die Berichterstattung über erhebliche Kürzungen im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung (über die übrigens schon seit langem fundiert auf der Website O-Ton Arbeitsmarkt informiert wird), so beispielsweise in dem FAZ-Artikel Regierung fördert Langzeitarbeitslose weniger, der sich auf die Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Brigitte Pothmer von den Grünen stützt:
»Während vor vier Jahren noch gut 350.000 Langzeitarbeitslose etwa mit geförderten Arbeitsgelegenheiten oder sogenannter Bürgerarbeit auf eine neue Beschäftigung vorbereitet wurden, waren es zur Jahresmitte 2014 nur noch 136.000 … Die seinerzeit von der schwarz-gelben Regierung beschlossenen Einschnitte haben sich nach dem Regierungswechsel fortgesetzt: Allein seit Mitte 2013 ging die Zahl der geförderten Stellen um 26.500 oder gut 16 Prozent zurück.«
An dieser Stelle kann und muss man dann aber auch die Frage stellen, warum denn die nordrhein-westfälische SPD, die ja in der deutschen Sozialdemokratie nicht ganz unbedeutend ist, nicht viel stärker bei den Koalitionsverhandlungen auf Schritte hin zu einer anderen und für mehr öffentlich geförderte Beschäftigung gedrängt hat. Die SPD hat aber bei den Koalitionsverhandlungen im vergangenen Jahr dieses Thema nicht mal ansatzweise verfolgt, offensichtlich waren Mindestlohn und „Rente mit 63“ wesentlich wichtiger und kräftezehrender, obgleich sie noch bis zur Bundestagswahl in der Opposition heftig für einen „sozialen Arbeitsmarkt“ geworden hat. Die Kritik an dem bisherigen Nichtstun der sozialdemokratischen Bundesarbeitsministerin Nahles im Bereich der Förderung von Langzeitarbeitslosen ist wohl mittlerweile in Berlin angekommen und das Ministerium versucht nun, beruhigend zu wirken, was man bekanntlich am besten dadurch macht, dass man energische Aktivitäten – ankündigt, die am besten auch noch von Dritten bezahlt werden (müssen). Dann kommen solche Artikel auf den Markt: Andrea Nahles plant neues Programm für Langzeitarbeitslose. Zum Jahresende. Natürlich lohnt es sich, nicht nur die Überschriften, sondern weiter im Text zu lesen: »Das Bundesarbeitsministerium will dem zum Jahresende auslaufenden Förderprogramm „Bürgerarbeit“ für Langzeitarbeitslose ein neues nachfolgen lassen. Das neue Programm im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) solle im Herbst vorgestellt werden, sagte eine Sprecherin des Ressorts am Freitag in Berlin.« Also im Klartext: Ein altes Programm fällt weg, ein neues ist auf dem Weg.
Unbestreitbar hat sich der Problemdruck dergestalt weiter erhöht, dass wir eine nicht wegzudiskutierende Verfestigung und Verhärtung der Langzeitarbeitslosigkeit beobachten müssen, eine dauerhaft exkludierte Gruppe von Arbeitslosen, für die dann auch noch parallel die Förderangebote eingedampft worden sind. Hinzu kommt, dass das Förderrecht für Maßnahmen im SGB II in den vergangenen Jahren weiter restriktiv ausgestaltet wurde seitens des Gesetzgebers, mit der Folge, dass vieles Sinnvolles gar nicht gemacht werden darf und das, was man noch machen darf, dadurch, dass es ganz weit weg sein muss vom „normalen“ Arbeitsmarkt, nicht unbedingt integrationsfördernd wirkt, was man aber bei Bedarf, z.B. wenn man sparen will, den Maßnahmen wieder in die Schuhe schieben kann.
Ein aktuelles Beispiel für dieses perfide Vorgehen liefert bezeichnenderweise jemand, der ganz genau weiß, wie das läuft – Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA) und für das SGB II zuständig: »Die geförderten Arbeitsgelegenheiten, im Volksmund „Ein-Euro-Jobs“ genannt, führten, statistisch gesehen, in weniger als zehn Prozent der Fälle zu einem erfolgreichen Einstieg in eine sozialversicherungspflichtige Arbeit. „Sie führen eher zu einer Parallelarbeitswelt“, sagte Alt«, wenn man dem Artikel Regierung fördert Langzeitarbeitslose weniger von Dietrich Creutzburg folgt. Nein, Herr Alt, so geht das nicht. Das ist eine bewusste Schützenhilfe für die Regierung wider besseren Wissens, denn: Die beklagte Parallelarbeitswelt wird doch von den förderrechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Umsetzung in den Jobcentern verursacht, man denke hier nur an die Auswirkungen von „Wettbewerbsneutralität“ und „Zusätzlichkeit“, eine Kritik, die von 99,1% der Experten, die sich in diesem Bereich wirklich auskennen und arbeiten, bestätigt werden wird. Und das weiß auch der Herr Alt. Und zweitens: Gerade die Arbeitsgelegenheiten („Ein-Euro-Jobs“) sollen/müssen auf Zielgruppen unter den Langzeitarbeitslosen angewendet werden, bei denen es oftmals aufgrund ihrer „Vermittlungshemmnisse“, wie das im Amtsdeutsch heißt, gar nicht um eine kurz- oder vielleicht mittelfristige Integration in eine „richtige“ Erwebsarbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt geht und gehen kann, sondern um Vorstufen, die mal hoffentlich dort enden, also um eine Stabilisierung der Erwerbsfähigkeit. Dann müsste man aber den „Erfolg“ dieser Maßnahmen ganz anders messen und darf das nicht reduzieren auf eine Zielgröße, die gar nicht mit der Maßnahme verbunden war. So was nennt man Rosstäuscherei.
Von interessierter Seite werden solche zusammengebogenen „Argumente“ gerne benutzt, um eine ziemlich uninformierte Sicht auf die Dinge unter die Leute zu bringen. So kann man bei Dietrich Creutzburg lesen, der extra einen Kommentar unter dem bezeichnend-zynischen Titel „Produktiver Stellenabbau“ verfasst und veröffentlicht hat: »… was die alte Regierung aus Union und FDP im Zuge eines Sparpakets begonnen hatte, setzt die neue Regierung mindestens bis dato fort. So viel Konsequenz verdient Respekt. In der aktuellen Arbeitsmarktlage gibt es … auch keinen Grund, Arbeitslose massenhaft in Beschäftigungstherapien fest- und damit aus der Arbeitslosenstatistik herauszuhalten.«
Aber abschließend wieder zurück zu Reiner Lipka vom Jobcenter in Gelsenkirchen. Er hat Ideen und probiert diese auch aus, wie man anders umgehen kann mit den Langzeitarbeitslosen – zugleich ist das ein lehrreiches Beispiel für ein letztendlich nicht lösbares Grunddilemma von Arbeitsmarktpolitik, wenn sie denn fokussiert wird (bzw. werden muss) auf die „Angebotsseite“ des Arbeitsmarktes, also auf die Arbeitnehmern und die Arbeitslosen und gleichzeitig kaum oder keine Instrumente auf der Nachfrageseite hat, also bei den Arbeitsplätzen.
Lipka bezieht sich explizit auf den aus dem angelsächsischen Raum kommenden „Work-first“-Ansatz, keineswegs eine irgendwie neue Erfindung (vgl. dazu beispielsweise bereits den Beitrag Der „Work first“-Ansatz für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im SGB II, der 2011 in der Zeitschrift G.I.B-Info veröffentlicht worden ist oder auch die Darstellung bei Frank Nitzsche: „Es ist Ihr Job, einen Job zu finden“. Positive Bilanz nach 18 Monaten Modellprojekt „Ansätze zur Aktivierung und berufliche Eingliederung als eigenständige Dienstleistung der Jobcenter“ in NRW, in: G.I.B. Info, Heft 2/2013, S. 28 ff.). Lipka präsentiert uns das wieder mit handfesten Beispielen aus der Praxis. Wenn man mit den Menschen redet und ihnen zuhört, dann kommt oft raus, dass die Probleme ganz andere sind: Gewichtsprobleme, Schuldenprobleme:
»Ich halte es zum Beispiel für unfair, eine stark übergewichtige Kundin oder Kunden immer wieder zu einer Bewerbung im Einzelhandel zu schicken. Das ist für sie ein Spießrutenlauf. Es ist besser, zuerst bei ihren persönlichen Problemen zu helfen. Wir bieten deshalb mittlerweile Kurse in Ernährungsberatung, Farb- und Stilberatung oder Kosmetik an. Wir haben sogar schon Walking-Stöcke besorgt … Eine Frau hat neulich 45 Kilo abgenommen, jetzt hat sie eine Stelle als Erzieherin gefunden.«
Es spricht ein weiteres Problem an: Dass ein Hartz-IV-Empfänger oft wenig mobil ist.
»Wir geben finanzielle Anreize an Arbeitslose, für Arbeitsaufnahmen außerhalb der Stadtgrenzen. Und wir versuchen es mit neuen Ideen: Wir besorgen manchen Arbeitslosen zum Beispiel seit Kurzem einen Mietwagen, drei Monate lang. Die sind dann stolz wie Oskar, wenn wir ihnen den Schlüssel in die Hand drücken. Die kommen nach Hause und sagen: Schau mal, mein eigener Dienstwagen. Den habe ich vom Jobcenter … Wir haben das 200 Mal gemacht bisher, nur einmal ist einer für eine Spritztour nach Süddeutschland durchgebrannt. Das Entscheidende ist doch, dass wir die Menschen ermutigen, ihre Probleme anzugehen.«
Man könnte die Liste der Beispiele aus diesem Handlungszusammenhang noch lange erweitern. Allerdings ist es natürlich so, dass diese modern daherkommende Ansätze auch an die Systemgrenzen des gegebenen Arbeitsmarktes stoßen. Anders formuliert: Wenn – aus welchen Gründen auch immer – schlichtweg zu wenig Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, dann kann man noch so viel an den Menschen rumfummeln und sie wieder motivieren und sie vielleicht sogar begeistern, es ist wie mit einer Brücke, die man über einen Fluss baut – das andere Ufer muss auch erreichbar sein. Deshalb ist immer auch die Nachfrageseite des Arbeitsmarktes hoch relevant – und sei es – worauf Lipka ja auch hinweist – in Form einer vernünftigen öffentlich geförderten Beschäftigung.