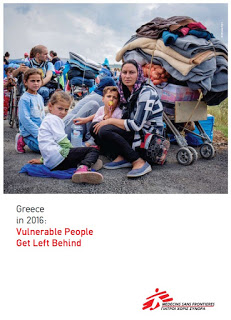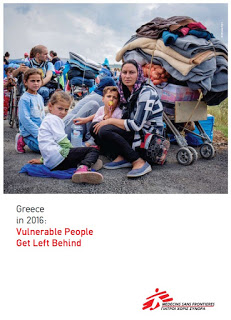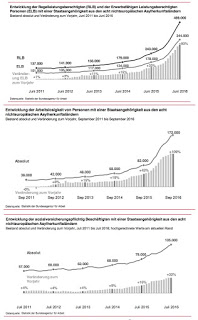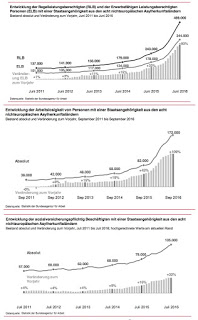Sie haben es wieder getan. Wie jedes Jahr im oftmals trüben November haben sie ihr Jahresgutachten der Bundesregierung in Gestalt der Bundeskanzlerin höchstpersönlich übergeben. Gemeint sind die umgangssprachlich als „fünf Wirtschaftsweise“ titulierten derzeit vier Herren und eine Dame, die den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bilden. Es handelt sich um ein Gremium der wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung. Der Rat wurde durch ein Gesetz im Jahre 1963 installiert mit dem Ziel einer periodischen Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. In der eigenen Aufgabenbeschreibung des Rates findet man neben der durchaus nachvollziehbaren Aufforderung, sich mit Wirtschaftsthemen zu befassen, u.a. diesen Hinweis: »Aufzeigen von Fehlentwicklungen und Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder Beseitigung, jedoch ohne Empfehlungen für bestimmte wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen.« Das sollten wir uns mal merken.
Das Jahresgutachten 2016/17 steht unter der wie auf einem Wahlplakat gedruckten Überschrift „Zeit für Reformen“. Und gleich im Vorwort, noch vor dem Dank an alle, die irgendwas beigetragen haben, statuieren die Wirtschaftsweisen ihren Anspruch mit energisch daherkommenden Formulierungen: »Im vorliegenden Jahresgutachten skizziert der Rat Reformen für Europa und Deutschland, um die politische Handlungsfähigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stärken. Jetzt ist die Zeit, diese Reformen umzusetzen.« Wie war das noch mal mit der Formulierung aus der Aufgabenbeschreibung?
Man ist das aus den vielen Jahren zuvor ja schon gewohnt – erneut handeln die Herren und derzeit eine Dame auch weite Teile der Sozialpolitik ab und sie machen genau das, was sie eigentlich nicht sollen: Bestimmte sozialpolitische Maßnahmen nicht nur empfehlen, sondern deren – natürlich baldigste – Umsetzung durch die Politik auch noch mit einer nicht mehr diskussionsbedürftigen Eindeutigkeit zu versehen. Trotz des Gewöhnungseffekts wird man immer wieder in Erstaunen versetzt, dass man sich offensichtlich in unseren komplexen Sozialsystemen mit einer derart schlafwandlerischen Sicherheit bewegen kann, völlig unbeeindruckt von den Widrigkeiten der Tiefen und Untiefen der Sozialpolitik, die von den Betroffenen und den wirklichen sozialpolitischen Experten wahrgenommen und diskutiert werden.
Auch im diesjährigen Jahresgutachten widmen sie ganze Kapitel der Sozialpolitik. Da gibt es beispielsweise das Kapitel 7: Altersvorsorge: Drei-Säulen-Modell stärken. Das folgende Kapitel 8 befasst sich mit Flüchtlingsmigration: Integration als zentrale Herausforderung. Und dann setzen sie noch einen drauf mit dem Kapitel 9: Keine Kapitulation vor der verfestigten Arbeitslosigkeit. Und natürlich mussten auch sie zur Kenntnis nehmen, dass es eine intensive und sehr kritische Diskussion in unserem Land gibt hinsichtlich der Ungleichheit in der Gesellschaft. Was sie dann in diesem Kapitel verarbeitet haben: Starke Umverteilung, geringe Mobilität. Wen man es bis hierher geschafft hat, dann kommt Entlastung, denn die Weisen verlassen das sozialpolitische Terrain und sie arbeiten sich zum Ausklang an der Energiewende und der Transformation in China ab.
Nun gibt es im Jahresgutachten im ersten Kapitel eine Zusammenfassung, was man sich unter den angeblich notwendigen Reformen so vorstellt. Hier einige der sozialpolitisch besonders relevanten Leckerbissen, die man im Gutachten finden kann (S. 26 ff.):
Das Beschäftigungswachstum sollte in den Mittelpunkt der Bemühungen gestellt werden. »Ein flexibler Arbeitsmarkt mit einer hohen Qualifikation der Arbeitnehmer und entsprechenden Anreizen, produktive Leistung zu erbringen, ist langfristig am besten geeignet, um Beschäftigung sicherzustellen und wirtschaftliche Teilhabe zu gewährleisten.« Und mit welchem Beispiel will der Rat das illustrieren?
»Ein gutes Beispiel dafür sind die Reformen der Agenda 2010, die in Wechselwirkung mit einer allgemeinen Lohnzurückhaltung dazu beigetragen haben, die Arbeitslosigkeit zu drosseln und damit einen weiteren Anstieg der Einkommensungleichheit zu verhindern. Eine höhere Umverteilung der Einkommen ist somit immer gegen die Schwächung des Anreizes abzuwägen, durch Qualifikationserwerb und Leistungsbereitschaft hohe Markteinkommen zu erzielen.«
An dieser Stelle werden nicht nur diejenigen aufstöhnen, die tagtäglich erfahren müssen, dass die Kombination aus Qualifikationserwerb und Leistungsbereitschaft eben oftmals nicht zu hohen Markteinkommen führen. Es werden sich auch Stimmen zur Wort melden, die zaghaft anfragen, ob nicht mit der Agenda 2010 der Auf- und Ausbau des größten Niedriglohnsektors in Europa einhergegangen ist, worauf Gerhard Schröder noch heute stolz ist.
Aber einfach vom Tisch wissen können die Wirtschaftsweisen natürlich nicht, dass wir ein echtes Ungleichheitsproblem haben. Sonst müsste man zu viele Ökonomen, die darauf hinweisen, für total bescheuert erklären und die Datenlage gibt denen ja auch noch an vielen Stellen recht. Also wählt man die Strategie der Vorwärtsverteidigung. Zuerst hau man so eine Diagnose raus:
»Allerdings ist die Vermögensungleichheit in Deutschland hoch, und die Einkommens- und Vermögenspositionen sind verfestigt.«
Fast schon ist man bereit, Gefühle zu entwickeln, da schlägt die argumentative Guillotine zu:
»Der geringe Aufbau von privaten Nettovermögen hat verschiedene Gründe. So reduziert beispielsweise das bereits umfangreiche Steuer- und Sozialversicherungssystem gerade für einkommenschwächere Haushalte die Anreize und Möglichkeiten zur privaten Vermögensbildung.«
So ist das, wenn man die einkommensschwächeren Haushalte „zu gut“ absichert über den Sozialstaat, sie haben dann einfach keinen Anreiz mehr, privates Vermögen zu bilden. Darauf muss man erst einmal kommen und das sollte man den Betroffenen aber ganz schnell sagen.
Überhaupt kann man an diesem sensiblen Punkt exemplarisch verdeutlichen, wie gespalten der Sachverständigenrat zugleich ist, worauf Markus Sievers in seinem Artikel Wer hört noch auf die Weisen? hinweist. Anders ausgedrückt: Vier gegen einen:
»Grundlegende Differenzen zeigen sich auch in der Debatte über die Gerechtigkeit in Deutschland. Diese Diskussion werde hierzulande intensiv geführt, konstatieren die vier Mehrheitsökonomen. Das aber stößt auf ihr Unverständnis. „Allerdings ist die Ungleichheit im vergangenen Jahrzehnt weitgehend unverändert geblieben.“ Dagegen heißt es in einem Minderheitsvotum von Bofinger: „Bei der Entwicklung der Nettoeinkommen von Personen in Haushalten mit mindestens einem erwerbsfähigen Haushaltsmitglied hat sich seit dem Jahr 1999 eine deutliche Schere herausgebildet.“ Für die zehn Prozent am oberen Rand seien die Einkommen seitdem um zehn Prozent gestiegen, für die am unteren um zehn Prozent gefallen.«
Dass der Sachverständigenrat sogleich der immer wieder geforderten Wiederbelebung der Vermögenssteuer eine Absage erteilt, wird viele nicht wirklich verwundern. Aber was dann tun gegen die Ungleichheit, die sich zudem verfestigt hat?
Man ahnt es schon, da muss dann mal wieder die frühkindliche Bildung ran: »Dazu zählen Maßnahmen, die das Bildungssystem durchlässiger machen, sowie ein verpflichtendes, kostenfreies Vorschuljahr.«
Ja Wahnsinn. Für mehr Durchlässigkeit sind irgendwie alle und der konkrete Vorschlag mit einem „verpflichtenden, kostenfreien Vorschuljahr“ offenbart nicht nur hinsichtlich der Semantik das totale Zurückbleiben der sachverständigen Räte hinter einer jahrelangen Diskussion und Forschung im Bereich der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Dass man im November 2016 eine Forderung in den Raum stellt, die man vielleicht um die Jahrtausendwende hätte aufstellen können, spricht für die totale Leerstelle, die man hier identifizieren muss.
Und der Arbeitsmarkt? Auch hier bleibt man in der eigenen Blase gefangen. Es wird dann zum einen darauf hingewiesen, dass wir mit Blick auf die Erwerbstätigen die bislang höchste Beschäftigtenzahl erreicht haben, zugleich aber ist bis zu den Wirtschaftsweisen das vorgedrungen, was Arbeitsmarktexperten seit vielen Jahren unter Begriffen wie verfestigte und verhärtete Langzeitarbeitslosigkeit diskutieren. Dafür hat man natürlich ein Rezept aus der alten Hausapotheke: »Der Niedriglohnsektor ist für die Bewältigung dieser Herausforderungen der Dreh- und Angelpunkt.« Na klar, das war erwartbar:
»Aufgrund des zu erwartenden Anstiegs des Arbeitsangebots im niedrigproduktiven Bereich, beispielsweise durch den Arbeitsmarkteintritt von anerkannten Asylbewerbern, muss die Aufnahmefähigkeit des Niedriglohnsektors weiter gestärkt werden … Zusätzlichen Maßnahmen, die Neueintritte behindern und Schutzwälle um die bereits Beschäftigen errichten, sollte eine Absage erteilt werden. Um die Arbeitnehmer von übermäßigen Anpassungserfordernissen abzuschirmen, dürften die bestehenden Mechanismen am Arbeitsmarkt wie Kündigungsschutz und Tarifbindung bereits hoch genug sein.«
Bitte? Ist die ganze Diskussion über die seit Jahren abnehmende Tarifbindung etwa an den Wirtschaftsweisen vorbeigegangen? Oder wollen sie das einfach nicht aufrufen?
Ja, natürlich, die Drängler unter den Lesern werden es wissen – jetzt ist der Mindestlohn nicht mehr weit weg.
»Der Mindestlohn stellt dabei eine Hürde für die Aufnahmefähigkeit des Niedriglohnsektors dar, weil er die Entstehung von Arbeitsplätzen für Niedrigproduktive behindert. Diese Hürde ist im derzeitigen Konjunkturaufschwung mit Rekordbeschäftigungsstand und steigenden Löhnen geringer als bei einem Konjunkturabschwung.«
Sie werden sich nie abfinden mit dem Mindestlohn, was auch alles nicht passiert.
Zu den Arbeitsmarkt-Vorschlägen vgl. auch der Beitrag Wirtschaftsweise zur Langzeitarbeitslosigkeit: Deregulierung des Arbeitsmarktes soll helfen von O-Ton Arbeitsmarkt – mit dieser Anmerkung: »Im Übrigen interessant: Die bei fast allen Kapiteln des Gutachtens enthaltene „andere Meinung“ gibt es zum Thema „verfestigte Arbeitslosigkeit“ nicht.«
Und das nur als Fußnote: Dass man offensichtlich in einem „weisen“ Gutachten am Ende des Jahrs 2016 das hier schreiben kann, zeigt die unauslöschliche Liebe zu völlig altbackenen Positionen:
»Ein erleichterter Zugang in geschützte Dienstleistungsbereiche, etwa durch Abschaffung des Meisterzwangs bei nicht gefahrgeneigten Berufen, könnte die Selbstständigkeit fördern.«
Auch hier hat man entweder die zahlreichen ernüchternden Erkenntnisse hinsichtlich der Nicht-Beschäftigungswirkungen der Deregulierung im Handwerk nicht zur Kenntnis genommen oder man ignoriert die geflissentlich, weil man nicht das kindliche Gottvertrauen in die Deregulierung an sich aufzugeben bereit ist. Dass ist aber selbst für Ökonomen ein trauriges Stück.
Wünschenswert sei eine stärkere Förderung der Qualifikation am unteren Ende der Qualifikationsskala. Und auch hier wird eine offensichtlich seit mehreren Jahrzehnte lebende Leiche ins Feld geführt: »Dies könnte zum Beispiel durch eine stärkere Modularisierung von Ausbildungswegen erreicht werden.« Wann endlich begreift man auch im Rat, dass gerade die breite und auch länger dauernde Ausbildung ein richtiges Pfund ist, das wir (noch) haben in unserem Land und dass die bestehenden Ausbildungen ein sicher wichtiger Faktor für die (noch) guten Rahmenbedingungen darstellen.
Beim Thema Flüchtlinge finden sich die üblichen salbungsvollen Worte hinsichtlich der besonderen Bedeutung einer Integration in Bildungseinrichtungen und/oder in Jobs. Konkreter:
»Fördermaßnahmen, wie Arbeitsgelegenheiten oder Lohnzuschüsse könnten sich für anerkannte Asylbewerber eher als für andere Arbeitslose als geeignet erweisen, um sie an den Arbeitsmarkt heranzuführen … Die Einstiegshürden in den Arbeitsmarkt sollten niedrig gehalten werden. Denn flexible Beschäftigungsmöglichkeiten, beispielsweise Zeitarbeit und Werkverträge, sowie selbstständige Arbeit bieten Chancen für den Einstieg in den Arbeitsmarkt.«
Und was ist mit dem so wichtigen Feld der Gesundheitspolitik? Auch hier nur altes Gebäck und konsequenterweise zitieren die Wirtschaftsweisen einfach nur noch aus ihren alten Gutachten, wenn es um das von ihnen erneut aufgerufen Ziel geht, „Ineffizienzen“ im Haifischbecken Gesundheitspolitik zu beseitigen:
»Dazu zählen die Stärkung der Vertragsfreiheit durch Ausweitung der Nutzung von Selektivverträgen (JG 2012 Ziffern 629 ff.), der Übergang zur monistischen Krankenhausfinanzierung (JG 2012 Ziffer 635), die Wiedereinführung und ziel- führende Weiterentwicklung der Praxisgebühr (JG 2012 Ziffer 594), die Aufhe- bung des Fremd- und Mehrbesitzverbots von Apotheken (JG 2010 Ziffer 425) und die Ausdehnung von Kosten-Nutzen-Analysen im Arzneimittelbereich auf den Bereich der alternativen Medizin … Das jüngste Urteil des EuGH, das die Preisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland im Widerspruch zu EU-Recht sieht, könnte mehr Wettbewerb unter Apotheken ermöglichen.«
Und mehr als schmunzeln muss man im Jahr 2016, wenn der Rat schreibt: »Außerdem hält der Sachverständigenrat die einkommensunabhängige Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) durch die Einführung einer Bürgerpauschale mit integriertem Sozialausgleich nach wie vor für die beste Finanzierungsform.« Warum soll man auch seine Meinung ändern, selbst wenn diese Diskussion nun schon seit Jahren beerdigt ist.
Ja, natürlich sagen sie auch was zur Rentenpolitik, die in diesen Tagen so im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit steht. Aber auch hier gilt – man sollte nichts erwarten, was einen irgendwie überraschen könnte und vor allem keine Auseinandersetzung mit dem nun mal komplexen Diskurs über das vielschichtige Alterssicherungssystem. Einige Empfehlung geben sie uns mit auf den Weg:
»Die Folgen des demografischen Wandels in der GRV lassen sich nicht beseitigen, aber abmildern. Dazu ist aus Sicht des Sachverständigenrates eine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters nach 2030 notwendig. Angesichts der steigenden ferneren Lebenserwartung bietet sich eine Kopplung an diese an, damit die relative Rentenbezugsdauer über die Zeit nicht weiter ansteigt. Dies würde bis zum Jahr 2080 bei einer Lebenserwartung von 88 Jahren für Männer und 91 Jahren für Frauen zu einem gesetzlichen Renteneintrittsalter von 71 Jahren führen.«
Und wie ist das mit den Selbständigen und deren oftmals nur rudimentär vorhandene Alterssicherung?
»Eine Ausweitung des Versichertenkreises durch eine Pflichtversicherung von Selbstständigen in der GRV ist keine Lösung des Nachhaltigkeitsproblems. Sie dürfte zu einer Leistungsausweitung für die heutige Rentnergeneration führen, während sich das Nachhaltigkeitsproblem für zukünftige Generationen verschärft. Der Sachverständigenrat plädiert hingegen für eine Vorsorgepflicht für Selbstständige, wobei Wahlfreiheit darin bestehen sollte, diese über die gesetzliche oder private Altersvorsorge zu erfüllen.«
Und auch das ist nicht überraschend – der Sachverständigenrat plädiert für eine Stärkung der zweiten und dritten Säule der Alterssicherung in Deutschland, also für einen weiteren Ausbau der kapitalgedeckten Systeme. »Mit einem stärkeren Gewicht auf die betriebliche und private, Riester-geförderte Altersvorsorge wird das System insgesamt krisenfester und federt gleichzeitig verschiedene Risiken ab«, wird einfach mal so behauptet, ohne auch nur zu zucken angesichts der vielfältigen Kritik an so einer Behauptung.
Besonders dreist ist die Bewertung der von vielen als gescheitert eingestuften Riester-Rente:
»In der privaten Altersvorsorge muss es darum gehen, den Verbreitungsgrad der Riester-Rente vor allem bei Geringverdienern zu erhöhen. Dabei dürften die Unkenntnis der Förderberechtigung, die (falsche) Annahme, später auf die Grundsicherung im Alter angewiesen zu sein, Marktintransparenz und fehlende finanzielle Bildung für den unzureichenden Verbreitungsgrad verantwortlich sein. Eine Verbesserung des Finanzwissens, eine allgemeine Förderberechtigung und mehr Transparenz wären daher sinnvoll.«
Die Leute, vor allem die in den unteren Einkommensbereichen, sind einfach zu blöd, die Ästhetik der Riester-Rente in all ihrer Pracht zu verstehen.
Aber auch hier muss wieder auf den Riss hingewiesen werden, der durch den Sachverständigenrat geht. Mit Peter Bofinger stellt ein Wirtschaftsweiser der Mehrheit bei fast allen wichtigen Punkten eine andere Position entgegen. Sieben Minderheitsvoten belegen die tiefen Meinungsverschiedenheiten. Dazu Markus Sievers in seinem Artikel am Beispiel der Riester-Rente:
»Das Mehrheits-Quartett lobt die Einführung der Riester-Rente als wichtigen und richtigen Schritt. Auch diese Einschätzung provoziert Widerspruch. Diese private Vorsorge mit staatlicher Unterstützung habe gerade bei den Menschen mit niedrigen Einkommen nicht zu einem erhöhten Sparaufkommen geführt, so Bofinger. Weil gleichzeitig aber die Leistungen der gesetzlichen Rente gekürzt wurden, drohe verstärkt Altersarmut.«
In Ordnung, alles muss ein Ende haben, so auch der kurze Ausflug in das sozialpolitische Niemandsland des Sachverständigenrats. Das ist insgesamt eine Nullnummer. Und erneut zeigt sich, dass es gut wäre, wenn man ein wirklich kompetentes Gremium zur Begleitung der Sozialpolitik hätte – wenn man ein überhaupt diesen Gremien noch irgendeinen Sinn zuschreiben möchte. Inhaltlich ist das, was man sozialpolitisch aus dem Gutachten serviert bekommt, ein extrem einseitiges und an vielen Stellen völlig von den Forschungsbefunden und den praktischen Erfahrungen in den Sozialsystemen entkoppeltes Gebräu aus angebotsorientierter Ökonomen-Denke, die uns in keinerlei Hinsicht weiterhilft.