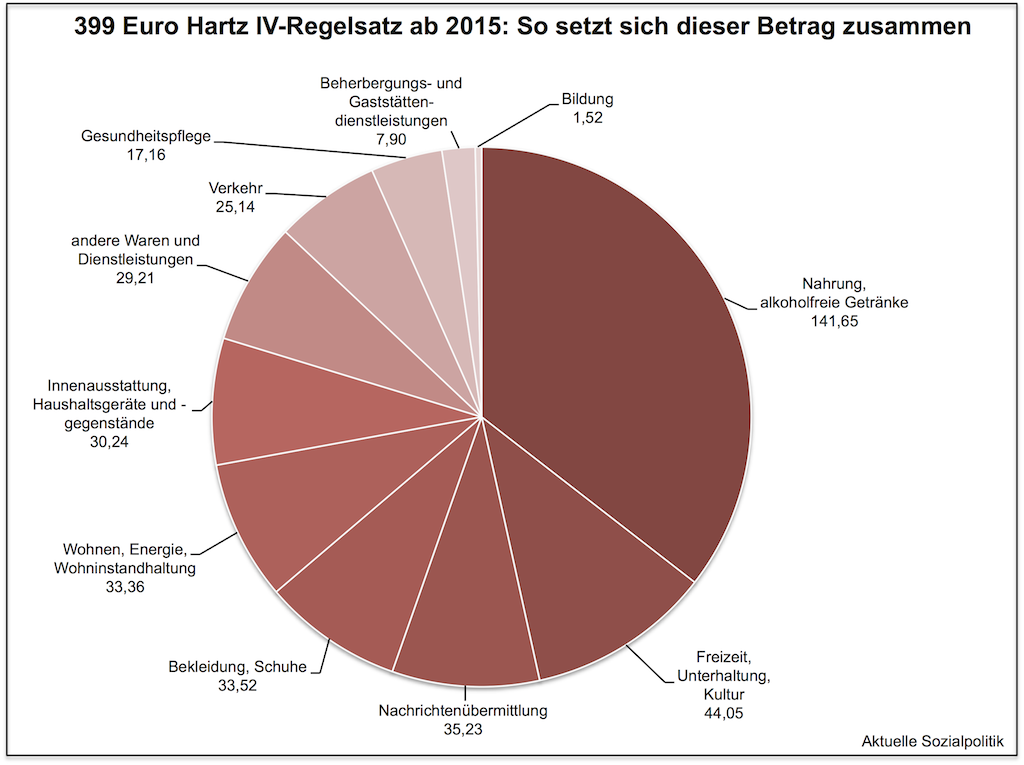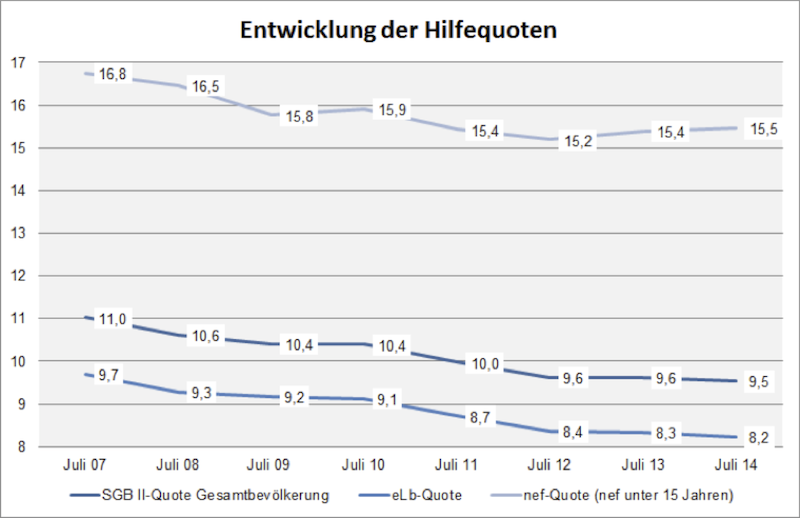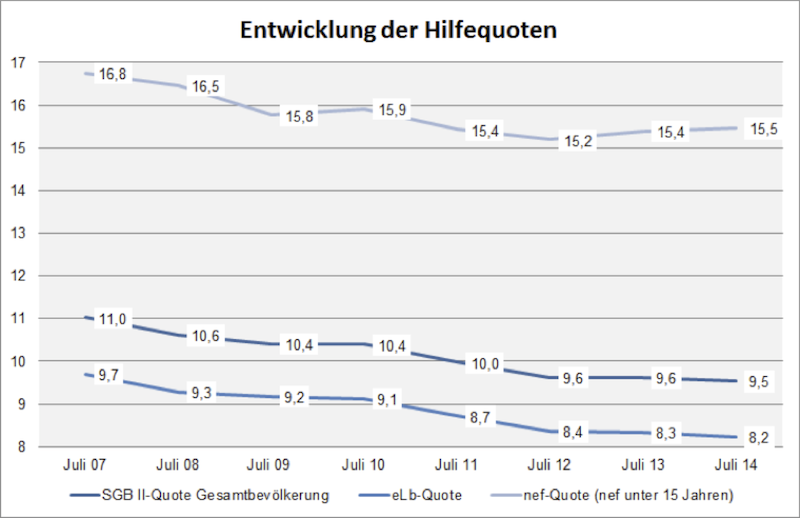Da wird schon wieder so ein Stück aus der Mottenkiste namens Instrumentalisierung von „Wissenschaft“ inszeniert, um scheinbar seriös daherkommende, Ängste produzierende bzw. verstärkende Aussagen zu benutzen, um mit dem gesellschaftspolitischen Feuer zu spielen. Und wieder einmal fungiert die BILD-Zeitung als Regisseur des ganzen unsauberen Spiels. Die „BILD am SONNTAG“-Ausgabe vom 22.02.2015 (die Abbildung zeigt einen Screenshot des Artikels in der Online-Ausgabe) macht so richtig Stimmung und man schüttelt in einem ersten Reflex verwundert den Kopf, um dann zunehmend damit beschäftigt zu sein, Ärger und Wut zu kontrollieren. Aber zuerst der Sachverhalt: Focus Online fasst die Berichterstattung der BILD-Zeitung unter dieser Überschrift zusammen: Goldene Generation von Rentnern: „Am Ende droht die Diktatur der Alten“. Und setzt dann noch einen nach: „Altersarmut existiert in Deutschland praktisch nicht“. Das muss man erst einmal sacken lassen, denn diese – nun ja – mehr als waghalsige Aussage stammt nicht von irgendeinem dahergelaufenen Redakteur oder Volontär, sondern der – man kann diese Typisierung schon nicht mehr lesen – „Top-Ökonom“ Thomas Straubhaar habe sie vorgetragen. Für ihn stellt Altersarmut in Deutschland derzeit kein Problem dar. »Der überragende Teil der Über-65-Jährigen braucht jenseits von Rente, betrieblicher und eigener Vorsorge keinen weiteren Cent vom Staat, um über die Runden zu kommen. Den Rentnern geht es im Vergleich zu jungen Familien oder Alleinerziehenden und auch im internationalen Vergleich also rosig.“ Wie erfolgreich die deutsche Wirtschaft und der deutsche Sozialstaat in den vergangenen 60 Jahren gewesen sei, zeige sich nirgends so deutlich wie bei den Rentnern.« Dürfen wir jetzt an dieser Stelle ein Loblied auf die heutzutage viel geschmähte umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung erwarten und – was an den Kern des eigentlichen Problems heranführen würde – eine Kritik der unendlichen Geschichte der als „Reformen“ verkauften Kürzungen innerhalb des eigentlich und bislang erfolgreichen Hauptsystems der Alterssicherung in Deutschland? Das wäre ja mal was, aber darum geht es den Regisseuren dieses Dramas gar nicht, deshalb bleibt alles im Nebel, um zur eigentlichen Stoßrichtung der Inszenierung zu kommen: Panik verbreiten. Dafür bedient man sich des „Wissenschaftlers“.
In seinen Worten hört sich dass dann so an:
»Es ist dramatisch: In Deutschland kann schon heute keine Politik mehr gegen die Interessen der Senioren gemacht werden. Wer an den Privilegien der Älteren rüttelt, wird abgestraft. Wahlsiege sind nur noch mit den Stimmen der Rentner möglich. Die Große Koalition hat verstanden, dass die Chancen für eine Wiederwahl steigen, wenn sie Politik für die Älteren macht. Die jüngere Generation gerät dabei politisch in die Defensive, am Ende droht die Diktatur der Alten.«
Quel malheur – eine „Diktatur der Alten“. Da muss man doch was gegen tun. Auch hier wird die Stimme des Ökonomen, sorry, es muss natürlich richtig heißen: „Top-Ökonomen“ ins Feld geführt, denn er fordert ein Kinderwahlrecht und – jetzt nicht wirklich überraschend – ein flexibleres Renteneintrittsalter: »Erstens müsste die Regierung ein Familienwahlrecht einführen. Für jedes Kind hätten die Eltern dann eine Stimme zusätzlich. Zweitens: Nur eine Hälfte der geschenkten wunderbarerweise immer längeren Lebenszeit geht in Altersfreizeit, die andere Hälfte sollte gearbeitet werden.« Und der umtriebige Journalist Roland Tichy sekundiert in seinem Kommentar Die Rente wird dünn wie ein Pizzateig in der BILD-Zeitung und man muss einfach einen Auszug aus diesem Erguss zitieren, auch wenn das für jeden, der sich etwas mit der Materie beschäftigt, einfach nur peinlich ist:
»Weil wir immer länger leben, wird unsere erarbeitete Rente gestreckt – und dabei dünn wie ein Pizzateig. Damit der nicht zu dünn ist, müssen wir länger arbeiten. Das ist gemein, aber ist es wirklich schlimm?
Mal ehrlich: Die Kinder der Generation Zahnspange mussten nie frieren – außer im Skilift. Sie haben nie gehungert – außer bei der Frühjahrsdiät. Und sie stemmen freiwillig in der Muckibude Gewichte – weil körperliche schwere Arbeit Gott sei Dank eher selten geworden ist.
Wir sind so fit wie nie zuvor. Die heute 70-Jährigen sind geistig, biologisch und gesundheitlich so gut drauf wie die 50-Jährigen damals, 1960. Mal ehrlich: Längst nicht alle, aber viele Frührentner von heute wissen doch oft gar nicht wohin mit ihrer Kraft, Lebenslust und Energie. Das ist einer der Gründe, warum heute nicht mehr die Studenten demonstrieren, sondern die Grauen, von Stuttgart 21 bis Dresden-Pegida.
Und es wird immer besser: Die Kinder des Jahres 2000 werden fast alle 100 Jahre alt, sagen die Forscher übereinstimmend. Das ist die gute Nachricht. Aber mit 62 in Rente und bis 100 Rente kassieren – diese Rechnung wird nicht aufgehen.«
Nur eine – entnervte – Anmerkung: Auch hier taucht wieder völlig losgelöst die falsche Behauptung auf, dass die Kinder des Jahres 2000 fast alle 100 Jahre alt werden, „sagen die Forscher übereinstimmend“. Dass das schlichtweg nicht stimmt, habe ich an anderer Stelle schon ausgeführt (vgl. dazu den Beitrag Weil der Riester-Mensch durchschnittlich hundert Jahre alt wird und weil er die FAZ liest, kann er sicher glauben, dass sie sicher ist, die (Riester)-Rente vom 27.10.2014).
Aber hier soll es vor allem um die frei nach dem Motto „Frechheit siegt“ vorgetragene Behauptung des Top-Ökonomen gehen, es gebe in Deutschland keine Altersarmut. Das nun ist gelinde gesagt eine ordentliche Verdrehung der Tatsachen. Hierzu beispielsweise der Beitrag Sie wächst und wird weiter wachsen – die Altersarmut. Neue bedrückende Zahlen am Anfang einer bitteren Wegstrecke vom 04.11.2014. Dort kann man lesen:
»Fast genau eine halbe Million Menschen sind es, die in den Statistiken auftauchen als Empfänger von Leistungen der Grundsicherung für Ältere nach SGB XII, also dem „Hartz IV“ eigener Art für ältere Menschen … Innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat sich die Zahl der älteren Grundsicherungsempfänger schlichtweg verdoppelt. Und man muss an dieser Stelle sogleich anfügen: Es handelt sich hier um die Älteren, die auch tatsächlich Leistungen beziehen – wenn es um das Thema Altersarmut geht, dann müsste man natürlich noch die älteren Menschen hinzuzählen, die eigentlich Anspruch hätten auf die Grundsicherungsleistungen, diese aber aus ganz unterschiedlichen Gründen faktisch nicht in Anspruch nehmen. Dabei handelt es sich um keine kleine Gruppe.
Es geht hierbei um das Problem der „verdeckten Armut“. Die Verteilungsforscherin Irene Becker hat dazu 2012 einen Beitrag publiziert, in dem sie die Ergebnisse einer Untersuchung vorgestellt hat, die der Frage nachgegangen ist, wie sich die verdeckte Armut unter Älteren seit der 2003 erfolgten Einführung der „Grundsicherung im Alter“ entwickelt hat … Aus den Zahlen der repräsentativen Befragung ergibt sich: Von gut einer Million Menschen ab 65 Jahren, denen damals Grundsicherung zustand, bezogen nur 340.000 tatsächlich Leistungen. Die „Quote der Nichtinanspruchnahme“, so der technische Begriff für die Dunkelziffer der Armut, betrug 68 Prozent.«
Dass bereits heute Altersarmut ein reales Problem ist, kann man beispielsweise solchen Kommentaren entnehmen: Die Koalition vergisst die armen Alten, so Katharina Schuler: »Neue Zahlen belegen: Die Altersarmut in Deutschland nimmt zu. Doch ausgerechnet zu diesem Problem gibt es von der Koalition bisher kaum mehr als ein Lippenbekenntnis.« Oder Die Alten werden immer ärmer oder Altersarmut nimmt in Deutschland zu.
Und dass in Zukunft die Altersarmut – ceteris paribus – kontinuierlich ansteigen wird, worauf die BILD-Berichterstattung ja auch durchaus richtig hinweist, hängt primär mit den politischen, also von Menschenhand gemachten Eingriffen des Staates in das Alterssicherungssystem zusammen, den so genannten „Rentenreformen“, vor allem seit denen der damaligen rot-grünen Bundesregierung Anfang des Jahrtausends. Nur hält die BILD-Zeitung sich an diesen Tatsachen nicht auf, die Leser könnten ja auf die durchaus naheliegende Idee kommen, dass man politische Entscheidungen auch wieder politisch verändern könnte. Auf diese Spur will man die Leute nicht setzen, sondern das eigentlich Ziel ist die Konstruktion eines Generationenkonfliktes, das Herbeischreiben gar eines Kriegs der Generationen, der unvermeidlich auf uns zuzukommen scheint.
»Millionen heutiger und künftiger Rentnerinnen und Rentner bezahlen für den zur Jahrhundertwende vorgenommenen Paradigmenwechsel in der Alterssicherung mit einem stetig sinkenden Versorgungsniveau«, so der ausgewiesene Rentenexperte Johannes Steffen im November des vergangenen Jahres vor dem Hintergrund des damals veröffentlichten Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung (»Drei-Säulen-Modell« der Alterssicherung ist gescheitert. Trotz geförderter Privatvorsorge keine Lebensstandardsicherung. Auf der Website „Portal Sozialpolitik“ von Johannes Steffen finden sich zahlreiche fundierte Materialien zu dieser Thematik).
Und das eine zunehmende Altersarmut – wie gesagt: ceteris paribus – sicher ist, verdeutlichen auch andere, wissenschaftliche Bestandsaufnahmen zum Thema: »Das Einkommen im Alter hängt von der Erwerbshistorie, den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und vom Haushaltskontext ab. Die langfristige Abschätzung von Einkommensrisiken im Alter ist schwierig. Bereits heute zeichnen sich allerdings bestimmte Risikogruppen ab. Langzeitarbeitslosigkeit oder Niedriglohnbeschäftigung, die schon in der Erwerbsphase ein Armutsrisiko darstellen, wirken kumuliert im Ruhestand fort. Zugleich werden die Einkommen aus der GRV nicht mehr ausreichen, um das Einkommensniveau im Ruhestand zu erhalten.« So eine Schlussfolgerung in der Analyse Zukünftige Altersarmut von Johannes Geyer vom DIW Berlin aus dem Sommer des vergangenen Jahres.
Aber um Fakten und seriöse Diskussionen geht es dem „Top-Ökonomen“ und vor allem der BILD-Zeitung nicht. Hier soll Stimmung gemacht werden. So, wie man an anderer Stelle gerne Arme gegen Noch-Ärmere aufzuhetzen versucht, sollen hier „Jüngere“ gegen „Ältere“ in Stellung gebracht werden. Es bleibt nur zu hoffen, dass dieses miese Manöver als solches erkannt wird. Und noch besser wäre es, wenn man dann endlich seriös und mit Blick auf die Betroffenen von der real existierenden wie auch der erwartbaren Altersarmut sprechen kann in diesem Land.
Foto: Screenshot von der BILD-Online-Seite am 22.02.2015