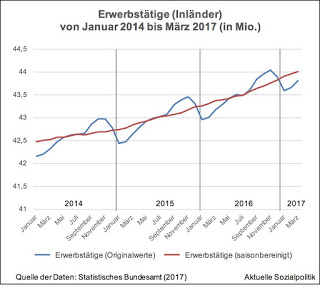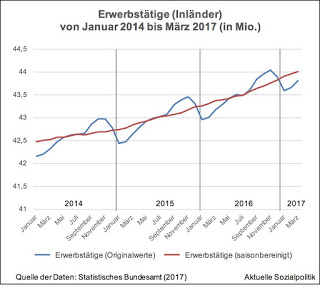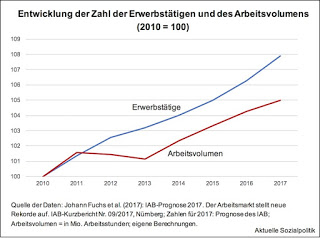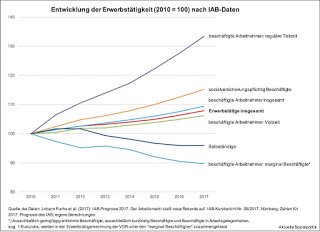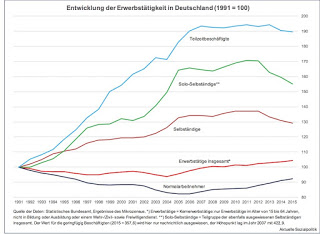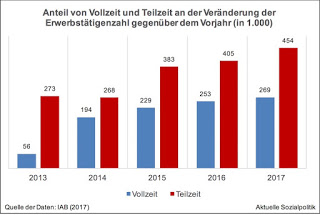»Wir wollen Sicherheit und Verlässlichkeit für die Beschäftigten!
Deshalb müssen wir auch an die Befristung vieler Arbeitsverhältnisse ran.
Vor allem jungen Menschen wird zu viel zugemutet: Sie sollen eine ordentliche Ausbildung machen, sich im Job weiterbilden, sie sollen eine Familie gründen und wollen sich manchmal auch noch um ihre Eltern kümmern, sie sollen für Wohneigentum sorgen, und im Idealfall sollen sie sich auch noch ehrenamtlich engagieren.
Das alles geht nicht, wenn die eigene Zukunft auf wackligen Beinen steht! Das kann nicht unser Angebot für die Jugend sein!
Und darum werden wir die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen abschaffen!«
Wer das gesagt hat? Die meisten werden richtig raten – Martin Schulz war das. In Bielefeld, auf dem Arbeitnehmerkongress der SPD im Februar dieses Jahres, wo er über „Arbeit in Deutschland“ gesprochen hat. Na gut, da geht einiges durcheinander, werden die pedantisch veranlagten Kenner der Materie einwerfen – geht es jetzt um Befristungen allgemein, um die „nur“ für die Jugend (und wann hört die auf – manche Eltern berichten von Jugendlichen in ihren Haushalten, die das 30. Lebensjahr überschritten haben) oder geht es um sachgrundlose Befristungen, was etwas anderes ist als eine Befristung mit Sachgrund, die man laut Schulz offensichtlich nicht abschaffen will? Die Debatte, die sich im Anschluss an diese Rede entzündet hat, sowie grundsätzliche Fragen der Befristungen von Arbeitsverhältnissen wurden bereits in dem Beitrag Die befristeten Arbeitsverträge zwischen Schreckensszenario, systemischer Notwendigkeit und Instrumentalisierung im Kontext einer verunsicherten Gesellschaft am 23. Februar 2017 behandelt. Nun hat sich der DGB zu Wort gemeldet mit dieser Ansage: »Über 3,2 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in befristeten Arbeitsverhältnissen – Tendenz steigend. Befristungen schaffen neben beruflicher Unsicherheit auch niedrigere Löhne. Dabei nutzen Arbeitgeber gesetzliche Regelungen aus, die ursprünglich Arbeitslosigkeit bekämpfen sollten. Der DGB fordert den Gesetzgeber deshalb auf, die Möglichkeit der Befristung ohne sachlichen Grund zu beenden.«
Die Bestandsaufnahme hinsichtlich der befristeten Arbeitsverträge und die gewerkschaftlichen Forderungen sind vom Bundesvorstand des DGB in diese Veröffentlichung gepackt worden:
DGB (2017): Sachgrundlose Befristungen – ein Massenphänomen, Berlin, Juni 2017
Darin wird auf den Einschnitt hingewiesen, den das Beschäftigungsförderungsgesetz von 1985 mit sich gebracht hat. Bis dahin waren Befristungen, die über die Probezeit hinausgingen, nur zulässig, wenn ein besonderer sachlicher Grund vorlag. »Mit dem neuen Gesetz konnten Arbeitslose zunächst bis zu einem Jahr befristet eingestellt werden. Die Regelung war zunächst bis 1991 befristet, doch wurde es immer wieder verlängert und in den folgenden Jahren wurden die Möglichkeiten der Befristung zudem erweitert.« Und zwar befristet ohne irgendeinen Sachgrund. „Für einen Arbeitsuchenden ist eine – wenn auch zunächst nur befristete – Arbeit besser als gar keine Arbeit“, so stand es im Gesetzentwurf zum sogenannten Beschäftigungsförderungsgesetz von 1985.
Mittlerweile können Arbeitsverhältnisse nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) ohne einen Sachgrund bis zu zwei Jahre lang befristet und innerhalb dieses Zeitraums bis zu dreimal verlängert werden.
Hinzu kommt: Bei neugegründeten Unternehmen können die Arbeitsverträge ohne Sachgrund sogar bis zu vier Jahren abgeschlossen werden.
Und noch eine Sonderregelung: Wenn die Arbeitnehmer/innen das 52. Lebensjahr vollendet haben und vorher arbeitslos waren, ist sogar eine Befristung bis zu fünf Jahren zulässig.
Hinzu kommt, dass auch die Befristungen mit einem Sachgrund durchaus weit angelegt sind. Im TzBfG findet man acht Sachgründe für Befristungen (vgl. § 14 Abs. 1 TzBfG). Greifen wir an dieser Stelle daraus nur mal zwei heraus: Ein sachlicher Grund für eine Befristung liegt vor, wenn „der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht“. Aber wann genau ist das (nicht) der Fall? Wie sieht es mit dem Definitionsspielraum des Arbeitgebers aus und dem mehr als begrenzten bzw. gar nicht vorhandenen Kontrollspielraum des Arbeitnehmers?
Und ein weiterer sachlicher Grund liegt vor, wenn „der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird“. Das wird gleich noch eine besondere Rolle spielen.
Den Arbeitgebern steht also eine breite Palette von Gründen mit und ohne Sachgrund zur Verfügung.
Man muss allerdings bei den Befristungen genauer hinschauen, denn es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe auf der Arbeitgeberseite, Arbeitsverträge zu befristen oder dies tun zu müssen, auch wenn er gerne anders handeln würde. Nehmen wir als ein Beispiel von vielen eine Kindertageseinrichtung, in der eine dort unbefristet beschäftigte Erzieherin in die Elternzeit geht, aber wiederkommen will und wird, beispielsweise nach zwei Jahren. Die Ersatzkraft für diese Mitarbeiterin kann vom Träger der Kita nur einen befristeten Arbeitsvertrag bekommen für die Abdeckung dieses Zeitraums, außer der hat an anderer Stelle einen sicheren Arbeitskräftebedarf genau nach Rückkehr der unbefristet Beschäftigten.
In einer Studie von Hohendanner et al. (2016) wurden die zentralen Unterschiede zwischen dem öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft bei den Motivlagen für Befristungen herausgearbeitet:
»Als wichtigste Befristungsmotive nannten öffentliche Arbeitgeber Vertretungen und fehlende Planstellen. Für die Privatwirtschaft ist die Erprobung neuer Mitarbeiter der wichtigste Befristungsgrund.« Und: Öffentliche Arbeitgeber nutzen befristete Arbeitsverträge als zentrales Instrument der Personalanpassung.
Letztendlich werden wir Zeugen einer massiven Polarisierung der Beschäftigungsstrukturen innerhalb des öffentlichen Dienstes. Auf der einen Seite haben wir hier die sichersten und – nicht nur bei Beamten – mit Unkündbarkeit ausgestattete Arbeitsplätze, auf der anderen Seite reagiert das System darauf spiegelbildlich mit der Schaffung einer hochgradig flexibilisierten Schicht an Beschäftigten, wo im starken Maße mit Befristungen gearbeitet wird (und aus Systemsicht gearbeitet werden muss) und in denen der Unsicherheitsfaktor kombiniert wird mit ausgeprägter Perspektivlosigkeit, was Anschlussoptionen angeht. Aus der Sicht der betroffenen Verwaltungen ist das aber irgendwie auch zwingend, denn eine grundsätzlich denkbare unbefristete Einstellung ist deshalb ein „Risiko“, weil der Arbeitgeber den Beschäftigten nicht wieder entlassen kann, wenn beispielsweise keine Mittel mehr zur Verfügung stehen für den besonderen Bereich, in dem die Stelle geschaffen wurde.
Auch wenn der DGB in seiner neuen Veröffentlichung andauernd zwischen den Befristungsebenen hin und her wechselt (beispielsweise werden bei den Zahlen alle befristeten Arbeitsverträgen herangezogen, das Papier ist aber überschrieben mit Sachgrundlose Befristungen – ein Massenphänomen), die Forderungen der Gewerkschaften kommen eindeutig daher (vgl. dazu DGB 2017: 8):
Sachgrundlose Befristung beenden: Arbeitsmarktpolitisch gibt es keine Notwendigkeit für die sachgrundlose Befristung, aber immer öfter wird dieses Instrument als verlängerte Probezeit missbraucht. Die sachgrundlose Befristung muss deswegen beendet werden. Denn wer befristet beschäftigt ist, kann sein Leben nicht planen und muss ständig fürchten, im Konfliktfall wieder auf der Straße zu stehen.
Aber auch bei den Befristungen mit Sachgrund fordert der DGB Veränderungen:
Änderungen bei Befristungen mit Sachgrund: Einige Befristungen mit Sachgrund sind manchmal sinnvoll und notwendig. Aber auch bei der begründeten Befristung sind Veränderungen notwendig, damit durch das Aneinander- reihen von Sachgründen nicht neue Kettenbefristungen entstehen. Derzeit können mehrere Befristungen mit verschiedenen Sachgründen aneinandergereiht werden.
Hinzu kommt, dass befristet Beschäftigte einen Anspruch auf bevorzugte Einstellung bekommen sollen. Außerdem fordert der DGB die Aufhebung des Sachgrundes „Befristung wegen befristeter Haushaltsmittel“. Hierbei handelt es sich um eine ausschließlich auf den öffentlichen Dienst bezogene Regelung. »Für eine solche Bevorzugung des öffentlichen Dienstes gibt es keinerlei Notwendigkeit. Die Regelung ist missbrauchsanfällig, weil durch die Jährlichkeit der Haushalte immer wieder neue Befristungsgründe geschaffen werden können.«
Gefordert wird mangels Wirksamkeitsnachweis auch die Aufhebung der Sonderregelung für Existenzgründer, außerdem – so der DGB – gilt für Kleinbetriebe ohnehin kein umfassender Kündigungsschutz.
Man könnte meinen, dass der DGB damit auf eine Wellenlänge liegt mit Martin Schulz, dem Kanzlerkandidaten der SPD. Denn der fordert ja auch eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen. Nur muss man hier wieder genauer hinschauen – der Befristungsanteil insgesamt im öffentlichen Dienst ist höher als in der Privatwirtschaft, die würde aber von der Abschaffung der sachgrundlosen Befristung besonders betroffen sein (was man begrüßen oder kritisieren kann, wenn die tatsächlich überwiegend die Funktion einer verlängerten Probezeit angenommen hat – und darauf deuten auch Analysen hin mit dem Befund, dass je höher der Anteil sachgrundloser Befristungen an den in den Betrieben eingesetzten befristeten Beschäftigungsverhältnissen ist, umso höher fällt die Anzahl der innerbetrieblichen Übernahmen in unbefristete Beschäftigung aus), während die hohen Befristungsanteile im öffentlichen Dienst nicht deutlich reduziert werden könnten.
So hatte das IAB der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen einer Anhörung im Bundestag im Jahr 2013 anlässlich einer damals schon von den Linken geforderten Abschaffung der sachgrundlosen Befristung in der Stellungnahme ausgeführt: »Die Anzahl sachgrundloser Befristungen hat sich zwischen den Jahren 2001 und 2013 von etwa 550.000 auf 1,3 Millionen erhöht … Damit hat sich der Anteil sachgrundloser Befristungen an allen im IAB-Betriebspanel erfassten Befristungen von 32 auf 48 Prozent erhöht.« Sachgrundlose Befristungen »werden verstärkt im Groß- und Einzelhandel oder im Verarbeitenden Gewerbe genutzt, während sie … in den öffentlichen und sozialen Dienstleistungen … eine untergeordnete Rolle spielen. Tendenziell zeigt sich, dass sachgrundlose Befristungen in Branchen mit einem hohen Befristungsanteil eher unterproportional genutzt werden.« Anders formuliert: Eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen würde an dem besonders befristungsintensiven öffentlichen Dienst ziemlich vorbeigehen.
Allerdings unterscheiden sich die Forderungen des DGB in einem gewichtigen Punkt von der Forderung „nur“ nach Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen bei Martin Schulz (und übrigens auch in anderen Parteien, bei den Linken und den Grünen etwa). Denn der DGB fordert explizit die Aufhebung des Sachgrundes „Befristung wegen befristeter Haushaltsmittel“ – und der betrifft den öffentlichen Dienst und das Befristungsgeschehen dort im Kern.
Zu welchen mehr als fragwürdigen Exzessen die Befristungspraktiken im öffentlichen Dienst führen können, sei an diesem Beispiel illustriert: Polizei Köln verliert 62 Mitarbeiter, so ist ein Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger überschrieben.
»Insgesamt 62 Tarifbeschäftigte hatte die Behörde ab August 2016 eingestellt, jeweils befristet auf zwei Jahre.
Die Gehälter werden aus dem Maßnahmenpaket der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration bezahlt. Das Ziel der Regierung war es, mehr Polizisten auf die Straße zu bekommen. Die Idee: Die Tarifbeschäftigten sollen die Beamten vor allem aus Verwaltungstätigkeiten herauslösen.«
Die Angestellten arbeiten zum Beispiel in Geschäftszimmern, in der Liegenschaftsverwaltung oder in der Sachbearbeitung. Man habe „qualifizierte und engagierte“ Mitarbeiter gewonnen, so der Polizeipräsident. »Viele hätten für den Wechsel zur Polizei ihre bestehenden Jobs gekündigt.«
Der Polizeipräsident habe sich immer wieder für eine Entfristung der Verträge eingesetzt – bislang vergeblich. Die 62 Angestellten bei der Polizei müssen sich nun bald neue Jobs suchen.
»Zwar sollen die Stellen erst bis 2024 nach und nach abgebaut werden, aber bis dahin müssen sie alle zwei Jahre neu ausgeschrieben werden. Eine Weiterbeschäftigung über zwei Jahre hinaus ist rechtlich nicht möglich, es müssen also immer wieder neue Mitarbeiter eingearbeitet werden.« Ein doppelter Wahnsinn: Die eingearbeiteten Mitarbeiter müssen gehen, möglicherweise in die Arbeitslosigkeit, wenn sie keine Anschlussbeschäftigung finden. Ihre Stellenhülsen bleiben, müssen aber mit frischem Nachschub besetzt werden – und die müssen sich erst einmal einarbeiten, bis auch sie dann in die Nähe der 2-Jahres-Grenze kommen. Und um die Sache dann „abzurunden“: Ab 2024 sind die Stellen dann weg, dann müssen die normalen Polizeibeamten die Tätigkeiten wieder übernehmen.
Man muss das wohl nicht weiter kommentieren.
Und in dem Blog-Beitrag Die befristeten Arbeitsverträge zwischen Schreckensszenario, systemischer Notwendigkeit und Instrumentalisierung im Kontext einer verunsicherten Gesellschaft vom 23. Februar 2017 wurde auf eine weitere Auffälligkeit aus dem öffentlichen Bereich hingewiesen, die ein politisches Geschmäckle hat: Wie weit Theorie und Praxis in der wirklichen Wirklichkeit auseinanderliegen (können), verdeutlicht ein Blick auf das Haus der (bis vor kurzem) Bundesfamilienminusterin Manuela Schwesig (SPD), die selbst mal vor einiger Zeit mit Blick auf die (möglichen) Auswirkungen der Befristungen beklagt hat: „Befristete Jobs wirken wie die Anti-Baby-Pille.“ Und dann werden wir damit konfrontiert: »Im Familienministerium ist der Anteil der befristet Beschäftigten zwischen 2004 und 2013 rasant gestiegen: von 1,2 auf 18,6 Prozent … Damit gehört das Familienministerium zu den Spitzenreitern unter den befristenden Bundesministerien.«
Und das kann man aktualisieren: »Die SPD geißelt befristete Arbeitsverhältnisse. Umso brisanter sind deshalb neue Zahlen über Zeitverträge in verschiedenen Bundesministerien«, schreibt Sven Astheimer in seinem Artikel Befristungen steigen rasant in SPD-Ministerien. Er bezieht sich darin auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Jutta Krellmann von den Linken – »ausgerechnet in den SPD-geführten Ministerien für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie für Arbeit und Soziales legte die Zahl der Befristungen zuletzt besonders stark zu.«
»Im Familienressort wuchs die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse zwischen 2013 und 2016 um rasante 37,5 Prozent auf insgesamt 440. Damit verfügt in dem bis Anfang Juni von der stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden Manuela Schwesig geführten Ministerium mehr als jeder fünfte Beschäftigte über einen Arbeitsvertrag mit Ablaufdatum. Im Arbeitsministerium von Parteifreundin Andrea Nahles stieg die Zahl der befristet Beschäftigten im selben Zeitraum um 26 Prozent. Von den rund 2700 Angestellten dort ist knapp jeder Zwölfte betroffen. Im Wirtschaftsministerium von Brigitte Zypries (ebenfalls SPD) blieb die Zahl der Zeitverträge mit 1765 dagegen gleich und im Verteidigungsressort von Ursula von der Leyen (CDU) sank sie sogar um 8,7 Prozent auf rund 3000.«
Im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, einer dem Bundesfamilienministerium nachgeordneten Behörde, liegt der Anteil der Befristungen sogar bei 27 Prozent – 22 Prozent sind sogenannte sachgrundlose Befristungen.