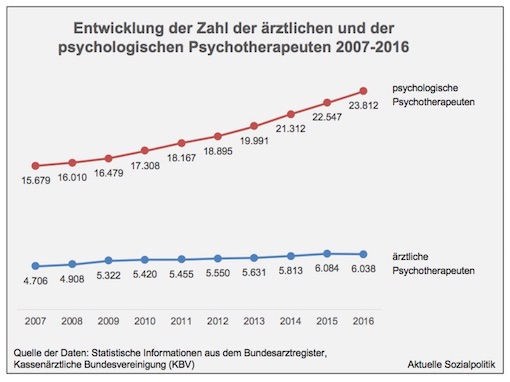Die medizinische Technik, Krankheitsrisiken vorherzusagen, macht starke Fortschritte. Es droht eine „unversicherbare Klasse“, so die These von Urban Wiesing in einem Gastbeitrag für die „taz“. Wiesing ist Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Tübingen. Er ist Vorsitzender der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer. Er geht zurecht von einem Grundtatbestand der Versicherungsökonomie aus: Versicherungen versichern Risiken, aber keine Gewissheiten. »Ein brennendes Haus lässt sich nicht mehr gegen Feuer versichern. Und ein Haus, von dem man weiß, dass es in zehn Jahren brennen wird, lässt sich nur zu hohen Prämien gegen Feuer versichern. Der Wert des Hauses muss durch die Prämien in zehn Jahren angespart sein – zuzüglich Kosten und Gewinn für die Versicherung.«
Wenn man das jetzt überträgt auf den Bereich der privaten Krankenversicherung, dann wird das Problem erkennbar: Wenn die private Versicherung weiß, dass in zehn Jahren der Versicherte an dieser oder jener Krankheit erkranken oder gar versterben wird, dann muss sie sich genau so verhalten wir im Fall des Hauses. Mit Blick auf die zunehmende Zahl an Untersuchungen, mit denen zukünftige Krankheiten diagnostiziert werden können (=> prädiktive Medizin), droht eine „uninsurable social underclass“. Werden die Betroffenen auf die GKV verwiesen, dann hätte der fehlende Kontrahierungszwang der PKV dieser wieder einmal zur „Rosinenpickerei“ verholfen. Aus dem Dilemma resultiert für Wiesing ein weiterer Argumentationsbaustein für die Einführung einer „Bürgerversicherung“: »Je mehr Risiken durch prädiktive Diagnostik zur Gewissheit werden, umso schwieriger wird es, betroffene Menschen privat gegen Krankheit zu versichern. Für dieses Problem gibt es eine einfache und umfassende Lösung: die Bürgerversicherung. Sie unterlässt, wozu private Versicherer gezwungen sind, nämlich die individuelle Risikokalkulation. Sie muss jeden Bürger aufnehmen, und dann ist es egal, ob der Bürger weiß, dass er in Zukunft an einer schweren Erkrankung leiden wird oder nicht. Und jeder Bürger kann die Vorteile der prädiktiven Diagnostik nutzen, ohne befürchten zu müssen, nicht mehr versicherbar zu sein.«
mehr