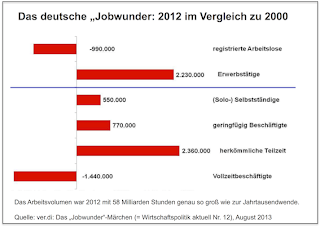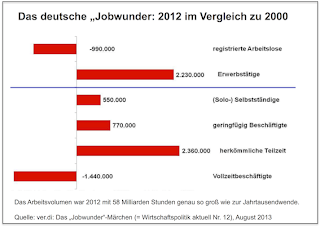Die Debatte über die Zuwanderung von Menschen nach Deutschland geht munter weiter – sowohl in der mehr als einseitig-verzerrenden Variante der skandalisierenden Rede von der „Armutszuwanderung“ mit dem dort mitlaufenden Bild von „unsere“ Hartz IV-Töpfe auslöffelnden Massen aus den südeuropäischen Armenhäusern der EU (wobei das keinesfalls auf Deutschland bzw. Bayern beschränkt ist, wie der Wettstreit um Härte gegen Zuwanderer zeigt, dem man derzeit in Großbritannien beobachten muss), wie aber auch in einem parallel dazu vorgetragenen Lobgesang auf die vielen „qualifizierten“ Zuwanderer, die wir als Gesellschaft – die aufgrund der demografischen Entwicklung angeblich auf die Knie geht – so dringend brauchen. Insofern wird der vom Statistischen Bundesamt für 2013 gemeldete wahrscheinliche Zuwanderungsüberschuss von mehr als 400.000 Menschen in diesem Diskussionsstrang sicher freudig begrüßt:
»Die ohnehin schon hohen Wanderungsgewinne in den beiden Vorjahren (2011: +279.000, 2012: +369.000) werden der Schätzung zufolge 2013 nochmals übertroffen: Das Statistische Bundesamt rechnet damit, dass sogar erstmals seit 1993 etwas mehr als 400.000 Personen mehr aus dem Ausland zugezogen als ins Ausland fortgezogen sind. Damals hatte der Wanderungssaldo bei 462.000 gelegen.«
Aber wie immer liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte oder anders formuliert: Die Wirklichkeit ist weitaus komplexer und selten schwarz oder weiß.
Ein Aspekt soll hier besonders herausgestellt werden, der eine wichtige, wenn nicht die zentrale Rolle spielt bei der teilweise hysterischen Debatte über (angeblich) ganz viele Armutsflüchtlinge, also Menschen, die nur deshalb zu uns nach Deutschland kommen, weil sie hier aus ihrer Sicht auf „paradiesische“ Sozialleistungen stoßen, mit denen sie dann – im Vergleich zu ihren Herkunftsländern – ein Leben „in Saus und Braus“ zu führen in der Lage sind. Es geht also um die Möglichkeit (oder den Ausschluss) vom Bezug der Sozialleistungen des Aufnahmelandes. Die Populisten haben das verdichtet auf die Rede über „Sozialtourismus“ oder „Sozialbetrug“ – und damit jeden Bezug von Hilfe unter das Dach eines ungerechtfertigten, ja eines illegalen Verhaltens gestellt. Hintergrund dieser völligen Verzerrung sind (neben ihrem Mobilisierungspotenzial einheimischer Wähler) auch die widersprüchlichen Signale, die von der deutschen Sozialgerichtsbarkeit ausgesendet werden. Da liegen Urteile vor, in denen die eher restriktive Rechtslage bestätigt wird, nach der das deutsche Sozialgesetzbuch II grundsätzlich ausdrücklich ausschließt, dass arbeitssuchende EU-Bürger Hartz IV erhalten, während andere Urteile den Hartz IV-Bezug auch von Anfang an meinen öffnen zu müssen – mit der Begründung, die bestehenden Leistungsausschlüsse in Deutschland seien europarechtlich nicht zu halten.
Dem obersten Sozialgericht unseres Landes wurde es zunehmend mulmig (auch vor dem steigenden Erwartungsdruck, eine Richtungsentscheidung zu treffen) und so hat es die Grundfrage an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) weitergeleitet – und nun warten alle, wie das europäische Gericht entscheiden wird, denn dieser Verweisung des BSG an das EuGH ist die Anerkenntnis, dass es ein europarechtliches Problem gibt.
Corinna Burdas hat die Gefechtslage in ihrem Artikel „Europa entscheidet über Hartz IV für EU-Ausländer“ skizziert (wobei die Anmerkung gestattet sei, dass es weniger „Europa“ sein wird, als der EuGH, was nicht nur ein semantischer Unterschied ist):
»Ginge es … tatsächlich allein um deutsches Recht, wäre die Rechtslage klar. Paragraph 7 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 des Sozialgesetzbuches(SGB) II stellt nämlich unmissverständlich fest, dass das Arbeitslosengeld II in Höhe von nunmehr maximal 391 Euro im Monat nicht an Ausländer gezahlt wird, die sich allein zur Arbeitssuche in Deutschland aufhalten. Mit dieser Ausschlussklausel solle der „Sozialtourismus“ von Personen verhindert werden, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht oder kaum integrierbar seien, wie etwas das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen jüngst in einem Eilverfahren feststellte … im Zentrum des Streits stehen … im wesentlichen zwei – europäische – Regelwerke, die das Problem der Zuwanderung innerhalb der Grenzen der EU geradezu konträr lösen: Die europäische „Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit“ stellt klar, dass alle EU-Bürger gleich behandelt werden müssen. Die gleiche Frage regelt die „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen“, allerdings mit dem genau umgekehrten Ergebnis: Diese „Unionsbürgerrichtlinie“ erlaubt es den Mitgliedstaaten ausdrücklich, EU-Ausländer von der Sozialhilfe auszunehmen. Gestützt wird das durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs: Er erlaubte im Juni 2009, Sozialhilfe erst dann zu gewähren, wenn der Arbeitssuchende eine tatsächliche Verbindung mit dem Arbeitsmarkt des Aufenthaltsstaats hergestellt hat. Von dieser Ausnahme hat Deutschland mit Paragraph 7 SGB II Gebrauch gemacht. «
Nun stellen sich natürlich viele die Frage, was und wie der EuGH entscheiden wird. Bekanntlich ist man auf hoher See und vor Gericht in Gottes Hand, was jede seriöse Prognostik erschwert bis verunmöglicht, aber man kann einen Blick nach links oder rechts werfen, um anhand anderer Entscheidungen Hinweise auf die anstehende zu finden: Ein Urteil zu einem Rentner, der staatliche Hilfen in Österreich beantragte, gibt solche Hinweise, mein Christian Rath in seinem Artikel „Wenn Deutsche das Ausland überlasten„. Er bezieht sich auf ein Urteil des EuGH aus dem September 2013 (Az.: C-140/12), das in Deutschland kaum bekannt ist.
Der Fall hat auch deswegen eine gewisse Pikanterie, denn er betrifft nicht die drohende Überlastung des deutschen Sozialsystems durch EU-Ausländer, sondern umgekehrt die drohende Überlastung des österreichischen Sozialsystems durch in die Alpenrepublik eingewanderte Deutsche.
Rath beschreibt die Fallkonstellation und die Entscheidung des EuGH zusammenfassend so:
»Konkret ging es um den deutschen Rentner Peter B., der 2011 mit seiner Ehefrau nach Österreich zog. B. bezieht aus Deutschland eine kleine Erwerbsminderungsrente. In Österreich beantragte er zusätzlich die dortige Ausgleichszulage, mit der unzureichende Renten auf das Existenzminimum aufgestockt werden. Die österreichischen Behörden verweigerten B. jedoch die Ausgleichszulage. Er habe gar kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Österreich, weil er nicht über ausreichende Mittel verfüge, um seinen Lebensunterhalt selbst zu finanzieren. Die Behörden beriefen sich dabei auf eine entsprechende Klausel im österreichischen Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz.
Der EuGH beanstandete die österreichische Klausel. Die dortigen Gerichte müssten vielmehr prüfen, ob die Gewährung der Leistung im konkreten Fall das Sozialsystem „unangemessen“ belastet.«
Die EuGH-Argumentation, dass Österreich prüfen müsse, ob die Gewährung der Leistung im vorliegenden Fall das Sozialsystem „unangemessen“ belastet, war auch Referenzpunkt für eine Entscheidung des nordrhein-westfälischen Landessozialgerichts: Hartz IV dürfe für arbeitssuchende EU-Bürger nicht automatisch und ohne Ausnahme ausgeschlossen werden.
Christian Rath sieht in der EuGH-Entscheidung den deutschen Rentner in Österreich betreffend die folgenden Hinweise für das anstehende Urteil zum Hartz IV-Bezug für EU-Ausländer in Deutschland betreffend:
»So misst der EuGH den Fall nicht an der „EU-Verordnung zur Koordinierung der Systeme sozialer Sicherheit“, die in der Regel eine strikte Gleichbehandlung der EU-Bürger bei Sozialleistungen fordert. Maßstab sei vielmehr die Unionsbürger-Richtlinie, die ausdrücklich vorsieht, dass EU-Bürgern in bestimmten Konstellationen „Sozialhilfe“ verweigert werden kann.
Der Begriff der „Sozialhilfe“ wird zudem weit ausgelegt. Auch die österreichische Ausgleichszulage für Rentner wird deshalb als „Sozialhilfe“ eingestuft. Dies spricht dafür, dass der EuGH auch deutsche Hartz IV-Leistungen als „Sozialhilfe“ im Sinne des EU-Rechts werten wird.«
Damit wären wir in einem Kernbereich der zu entscheidenden Problematik angekommen, auf den auch Corinna Burdas in ihrem Beitrag hingewiesen hatte: So sei es »ungeklärt, ob das 2005 eingeführte Arbeitslosengeld II unter den Begriff der Sozialhilfe fällt oder eher eine „beitragsunabhängige Geldleistung“ ist, die nach der Unionsbürgerrichtlinie nicht ausgeschlossen werden darf. Damals wurden Sozialhilfe und die frühere Arbeitslosenhilfe zu einer Leistung zusammengefasst.«
So richtig kompliziert wird es, wenn man berücksichtigt, dass der EuGH in seinem Österreich-Urteil auch eine Pflicht zur „finanziellen Solidarität“ der Aufnahmestaaten betont hat, vor allem, wenn die Bedürftigkeit des EU-Bürgers „nur vorübergehender Natur“ ist. Ein „automatischer Ausschluss der wirtschaftlich nicht aktiven Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten“ von der Sozialhilfe sei deshalb unzulässig.
Schon wieder so ein unbestimmter Rechtsbegriff, der auf eine neue Mega-ABM für Juristen hindeutet: „Nur vorübergehender Natur“ – wie kann man das operationalisieren? Wann ist die Bedürftigkeit „nur vorübergehend“ und wann wird sie etwas anderes? Man verdeutliche sich die hier verborgene Problematik nur an der deutschen Diskussion über den „harten Kern“ an (formal?) erwerbsfähigen Langzeitarbeitslosen im Grundsicherungssystem, die sich seit Jahren im Leistungsbezug befinden (vgl. hierzu ausführlicher die quantitativen Befunde in der Studie von Obermeier, Tim; Sell, Stefan und Tiedemann, Birte: Messkonzept zur Bestimmung der Zielgruppe für eine öffentlich geförderte Beschäftigung. Methodisches Vorgehen und Ergebnisse der quantitativen Abschätzung, Remagen, 2013).
Übrigens kann man hinsichtlich der Debatte über den „harten Kern“ der Hartz IV-Empfänger in Deutschland auch einen grundlegenden und jetzt hoch relevanten Differenzierungsaspekt unserer sozialen Sicherungssysteme erkennen, denn mit Blick auf die Menschen, die sich seit Jahren im Hartz IV-Bezug befinden, wird immer wieder vorgetragen, dass sie aben nur noch formal erwerbsfähig seien, aber mittel- und langfristig keine Perspektiven haben werden auf einen Arbeitsplatz, so dass man doch überlegen solle, diese Menschen aus der „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (SGB II) herauszunehmen und sie in das SGB XII (Sozialhilfe) zu überführen. Und da haben die Deutschen selbst ein echtes Zuordnungsproblem, denn die Abgrenzung, also SGB II für die Erwerbsfähigen und SGB XII für die Nicht-(mehr)-Erwerbsfähigen, ist nur scheinbar eindeutig, man werfe nur einen Blick in die Zielbestimmung des (Rest-)Sozialhilfe-Gesetzes SGB XII, also in den § 1: „Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.“ Ja wenn die Leistung sie befähigen soll, unabhängig von ihr zu leben, dann steckt dahinter ganz offensichtlich die Vorstellung, dass zumindest die Option vorhanden sein muss, dass sich die Sozialhilfe-Empfänger beispielsweise durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit wieder von der Bedürftigkeit befreien können, außer man reduziert die Optionen auf ein Entkommen aus der Hilfsbedürftigkeit auf einen auch bei Nicht-Erwerbstätigkeit erzielbaren Lotto-Gewinn, wenn man denn mitspielt.
Vor diesem Hintergrund könnte man schon auf den Gedanken kommen, dass das EuGH nicht im Sinne einer Ausschlussregelung entscheiden wird, denn EU-Bürger, die in Deutschland Arbeit suchen, wollen ja noch wirtschaftlich aktiv sein und deshalb benötigen sie nach EU-Logik eigentlich einen stärkeren Schutz im Aufnahmestaat als Rentner, so könnte man argumentieren. Ob die Richter das tun werden, steht in den Sternen und bleibt mithin abzuwarten.
Und bei aller Fokussierung auf die hier besprochene Problematik sollte man nicht vergessen: »Wer schon einmal in Deutschland gearbeitet hat oder ein Gewerbe betreibt, hat Anspruch auf Arbeitslosengeld II – zumindest als Aufstockungsleistung, wenn der Verdienst nicht zum Leben ausreicht. Auch Kindergeld erhalten alle EU-Bürger – übrigens unabhängig davon, ob sich die Kinder in Deutschland aufhalten«, so Corinna Budrich in ihrem Artikel.
Und eine letzte, gleichsam fundamentale Anmerkung: Wir sind hier konfrontiert mit gesellschaftlichen Kräften, die man nicht wirklich und vor allem nicht im entferntesten wird vollständig abblocken können. Man muss sehen: Wenn wir ein derart großes Wohlstandsgefälle haben zwischen den Mitgliedsstaaten der EU, das sich derzeit sogar noch vergrößert aufgrund der divergierenden ökonomischen Entwicklung, dann werden Menschen in einem „Binnenmarkt“ mit dem grundsätzlichen Recht der Personen-Freizügigkeit versuchen, ihr Glück zu suchen dort, wo die Lebensbedingungen deutlich besser sind oder zumindest erscheinen.
Natürlich kann das, wenn man realistisch und pragmatisch bleibt, nicht bedeuten, dass man jegliche Zuwanderung einschränkungslos zu akzeptieren hat. Man muss sich in diesem Fall darüber im Klaren sein, dass das zu massiven gesellschaftlichen Spannungen und Konflikten führen würde, die möglicherweise unverantwortbare Folgen hätten. Aber einen Mittelweg zu finden, wie man den aus dem nicht-aufhaltbaren Streben nach einem besseren Leben resultierenden Wanderungsbewegungen und den berechtigten Schutzinteressen der „Insider“ der Aufnahmeländer gerecht werden kann, das bleibt eine Aufgabe von Politikgestaltung, die a) höchst komplex ist und b) deren Lösung einem durch Gerichtsentscheidungen nicht abgenommen werden. Gerade wenn das so ist, muss man den modernen Populisten und ihrem das gesellschaftliche Klima vergiftenden öffentlichen Debatten so weit es geht Einhalt gebieten, man sollte aber auch nicht den Fehler machen, so zu tun, als wäre Zuwanderung im Gegenteil nur toll und ein großes Geschäft. Für manche Arbeitgeber und manche Branchen ist das sicher so, aber für viele andere Menschen sind damit oftmals erhebliche Konflikte und auch Verschlechterungen ihrer Lebensbedingungen verbunden, die man dann nicht den Populisten überlassen sollte.