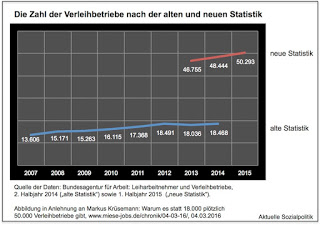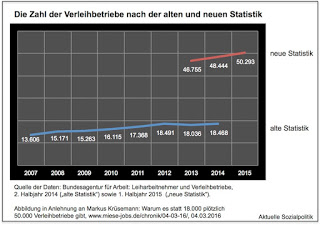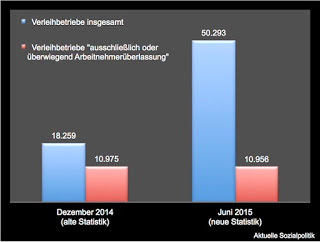Es ist schon ein Kreuz mit der Sozialpolitik und ihren Baustellen in diesen Tagen. Da wird jahrelang über Möglichkeiten des dringend erforderlichen Bürokratieabbaus für die Jobcenter diskutiert, zahlreiche Vorschläge gemacht und am Ende kommt nach langem Fingerhakeln in der Großen Koalition der Entwurf eines „Rechtsvereinfachungsgesetzes“ heraus, das nicht nur so gut wir keinerlei substanzielle Vereinfachungen enthält, sondern ganz im Gegenteil wurden an zahlreichen Stellen faktische Rechtsverschärfungen zuungunsten der Hartz IV-Empfänger eingebaut, die noch für manchen Ärger sorgen werden. Und man muss es an dieser Stelle deutlich sagen – dieser Entwurf stammt aus einem sozialdemokratisch geführten Ministerium und die SPD befindet sich derzeit ganz offensichtlich auf dem Sinkflug. Zum einen sicherlich von einem Teil der Medien herbeiberichtet, zum anderen aber eben auch, weil sozialdemokratisches Kernkapital erneut vernichtet wird mit dieser doch oft sehr einseitig und zuungunsten der Arbeitnehmer und der Hilfeempfänger daherkommenden, zudem kleinteilig angelegten und nicht selten nur noch als krämerhaft zu bezeichnenden sozialpolitischen Gesetzgebung. Das merken die Menschen.
In so einer Gemengelage ist es für die Verantwortlichen immer besonders wichtig, etwas, was man als Erfolg verkaufen will und muss und meint zu können, zu feiern und das nicht durch irgendwelche Kritik verunreinigen zu lassen. Man braucht was für die Bilanz. Und diese Tage waren wir Zeugen einer solchen Inszenierung, deren Gelingen immer auch voraussetzt, dass die Kritik oder die Hinweise darauf, dass es eigentlich gar nicht so ist wie behauptet, nicht zu schnell kommt, denn nach einiger Zeit haben die Menschen die Sache abgespeichert und vergessen und übrig bleibt das Bild im Kopf, dass da eine ordentliche Regelung auf den Weg gebracht wurde. Gemeint ist hier der gefeierte Durchbruch bei der Regulierung der Leiharbeit.
Dass man das, was da abgefeiert wurde, durchaus kritisch sehen kann, wurde bereits am 13. Mai 2016 in diesem Beitrag angedeutet: Ein „historischer Schritt“ oder doch eher nur Reformsimulationsergebnisse? Auf alle Fälle hat die Bundesregierung das ungeliebte Thema Leiharbeit und Werkverträge (vorerst) vom Tisch. Und Arbeitgeber und Gewerkschaften geben sich gemeinsam erleichtert. Und zwischenzeitlich zeichnen sich immer deutlicher die Konturen der Folgen einer Umsetzung dessen ab, was in den bisherigen Referentenentwürfen (vgl. dazu den letzten Referentenentwurf vom 14.04.2016) unter Berücksichtigung der noch einzuarbeitenden Kompromisspunkte aus dem Koalitionsausschuss vom 10.05.2016.
Während auch die Presse weitgehend unkritisch die Jubelbotschaft von der gelungenen Verbesserung der Lage der Leiharbeiter unters Volks getragen hat, kommen Fachleute zu teilweise völlig anderen Bewertungen als beispielsweise die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), die es als großen Fortschritt feiert, das Leiharbeiter endlich „verbriefte Rechte“ bekommen werden.
Als Beispiel sei hier der renommierte Arbeitsrechtler Peter Schüren in den Zeugenstand gerufen, seines Zeichens Direktor des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Wirtschaftsrecht an der Universität Münster. Schüren hat der Sendung „Arbeitsplatz“ (SWR 1) am 14.05. 2016 ein Interview gegeben: Konzept gegen den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen – Großer Wurf oder fauler Kompromiss?, so die Fragestellung des Gesprächs (» Audio-Datei). Auf die Frage, ob sich nun die Situation für die Leiharbeiter verbessern wird, antwortet er mit nein, er sieht sogar eher eine Verschlechterung gegenüber dem Status Quo. Das lässt aufhorchen. Er macht die angesprochene Verschlechterung beispielsweise daran deutlich, dass seit 2011 eine Überlassung von Arbeitnehmern nur vorübergehend folgen darf. Genau diese Begrenzung wird jetzt aufgehoben, was Schüren kritisiert. Aber wird nicht überall herausgestellt, dass ein Punkt im neuen Gesetz die Begrenzung auf 18 Monate ist als Normalfall, für die längstens ein Arbeitnehmer verliehen werden darf?
Hier nun gilt zum einen, dass vorgesehen ist, dass diese maximale Überlassungsdauer durch tarifvertragliche Regelungen in der – wohlgemerkt – Entleihbranche, also beispielsweise der Metallindustrie, sogar ohne gesetzgeberische Begrenzung nach oben verlängert werden kann. Das ist schon heftig, wenn man normalerweise das Bild vor Augen hat, dass mit Tarifverträgen die Situation der Arbeitnehmer verbessert werden soll. Aber ein zweiter Punkt ist noch entscheidender: Die maximale Einsatzdauer von 18 Monaten bezieht sich nämlich auf den einzelnen Leiharbeitnehmer und nicht auf den Arbeitsplatz im Einsatzbetrieb. Das ist eben kein trivialer Unterschied.
Auf das Grundproblem habe ich bereits 2013, als es um die Vereinbarung im Koalitionsvertrag ging, in einem Interview mit Spiegel Online hingewiesen (vgl. „Karussell für Leiharbeiter“ vom 28.11.2013): »Schon jetzt sieht das Karussell für viele Leiharbeiter doch so aus: Sie werden von einer Leiharbeitsfirma angestellt, die verleiht sie an einen Betrieb. Nach der vorgeschriebenen Frist müssen sie dort gehen, werden vom Arbeitnehmerüberlasser gekündigt. Dann sind sie arbeitslos, bis das Spiel von vorne anfängt.«
Der jetzt im Jahr 2016 vorliegende Referentenentwurf lässt genau das zu: Ein Dauerbedarf beim Entleiher kann mit einer endlosen Kette von Leiharbeitern befriedigt werden. Das wird nunmehr ganz legal gestellt.
Dazu passt dann auch, dass ein Ergebnis des im Koalitionsausschusses vom 10. Mai 2016 gefundenen „Durchbruchs“ lautet: »Bei der Errichtung der Überlassungszeit eines Arbeitnehmers werden die sog. „Unterbrechungszeiten“ verkürzt von sechs auf drei Monate.« Wie praktisch. Wenn jemand 18 Monate auf einem Arbeitsplatz im Entleihunternehmen gearbeitet hat, muss er oder sie nur drei Monate woanders eingesetzt werden oder arbeitslos gewesen sein, um auf dem gleichen Arbeitsplatz wieder entliehen zu werden und er oder sie fängt dann wieder bei Null an.
Man könnte mit Blick auf die faktischen Verschlechterungen im Kontext des von den Protagonisten derzeit bejubelten“Fortschritts“, dass nach 9 Monaten im Grunde „equal pay“ erreicht werden muss (es sei denn, es bestehen – wieder – tarifvertragliche Sonderregelungen, konkret: Branchenzuschläge, die einen längeren Übergang ermöglichen) auch darauf hinweisen, dass bislang die Rechtslage so war, dass eigentlich ab dem 1. Tag „equal pay“ vorgeschrieben ist. Es sei denn, es gibt eine davon abweichende tarifvertragliche Regelung in der Verleihbranche mit den Gewerkschaften. Genau die gibt es bekanntlich zwischen den Leiharbeitarbeitgebern und der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit. Und die normieren eigene Tarife für die Leiharbeiter und heben damit das „equal pay“-Gebot aus. Diese Tarifverträge laufen derzeit noch bis 31.12.2016. Wenn die Gewerkschaften dieses Tarifverträge auslaufen lassen würden und zugleich erklären würden, dass sie keine Folgeverträge aushandeln würden, dann wäre ein tarifloser Zustand gegeben und mithin „equal pay“ ab dem ersten Tag vorgeschrieben, also ab dem 1.1.2017, weil auch eine Nachwirkung verhindert wird durch die Erklärung, keinen neuen Tarifvertrag abzuschließen zu wollen. Nur mal so als Anmerkung, was man durchaus machen könnte, wenn man sich denn vorstellen könnte, zu wollen.
In diesem Beitrag soll es aber vor allem um einen weiteren Punkt in der Liste der Verschlechterungen gehen: Es geht um das leidige Thema der illegalen Arbeitnehmerüberlassung und der damit – eigentlich – verbundenen Rechtsfolgen. Das habe ich bereits in dieser 2013 publizierten Veröffentlichung angesprochen:
Sell, Stefan: Lohndumping durch Werk- und Dienstverträge? Problemanalyse und Lösungsansätze. Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 13-2013, Remagen 2013
Dort findet man auf den Seiten 6-7 folgende Hinweise:
»Eigentlich ist die Sache relativ einfach: Wenn unter dem Deckmantel eines Werk- oder Dienstvertrags faktisch eine Arbeitnehmerüberlassung betrieben wird, dann sind die Konsequenzen, die bereits heute im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geregelt sind, hart und einfach: Der Schein-Vertrag ist nichtig, der Arbeitsvertrag zwischen dem faktischen Verleiher und den überlassenen Arbeitnehmern ebenfalls und der überlassene Arbeitnehmer wird zum Arbeitnehmer des Entleihers mit allem daraus resultierenden Ansprüchen. Besonders bedrohlich für den Entleiher ist die Strafbarkeit wegen Beitragshinterziehung gemäß § 266a StGB. Besonders aus diesem Bedrohungsszenario könnte eine wirkungsvolle Abschreckung funktionieren, so dass viele Unternehmen, die in Inhouse-Outsourcing praktizieren, darauf achten müssen, die Grenzen zu Arbeitnehmerüberlassung nicht zu überschreiten. Was aber soll an dieser Stelle das „könnte“ im letzten Satz? Es soll überleiten zu dem bereits erwähnten Schlupfloch, mit dem man den dadurch erreichen Abschreckungseffekt wieder neutralisieren kann. Denn „erfreulicherweise“ für den Auftraggeber funktioniert die skizzierte Abschreckungswirkung heute nicht richtig – und zwar dann nicht, wenn der Scheinwerkunternehmer oder Scheindienstleister über eine Überlassungserlaubnis verfügt. Wenn das der Fall ist, dann tritt die beschriebene Rechtsfolge eines Arbeitsverhältnisses zum Entleiher nicht ein. Die Ansprüche des eigentlich überlassenden Arbeitnehmers richten sich in diesem Fall nicht gegen das Entleih-Unternehmen, sondern gegen das Verleih-Unternehmen. Und genau diese Konstruktion ist in der Praxis weit verbreitet: Die Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis fungiert demnach als „Reservefallschirm“ bei verdeckter Überlassung. Im Ergebnis bedeutet das, dass der faktische Entleiher bei einem Scheinwerk- oder Scheindienstvertrag praktisch kein Risiko eingeht, aber die Kostenvorteile, die sich realisieren lassen, mitnehmen kann.«
Und bereits damals habe ich mit Bezug auf den Arbeitsrechtler Peter Schüren darauf hingewiesen, dass man das relativ einfach heilen kann, wenn man denn gesetzgeberisch will:
»Aus der Logik einer anzustrebenden Abschreckungswirkung liegt der Lösungsansatz für dieses Problem auf der Hand: Man muss durch eine gesetzgeberische Änderung im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz den Durchgriff der Sanktionen auf den Auftraggeber sicherstellen.
Der Arbeitsrechtler Peter Schüren hat hierzu einem handhabbaren – und gesetzgeberischen Willen vorausgesetzt auch schnell umsetzbaren – Vorschlag entwickelt: Um zu verhindern, das Schein-Werk- bzw. Schein-Dienstverträge unter dem „Schirm“ einer vorhandenen Überlassungserlaubnis gelangen, sollte der bestehende Gesetzeswortlaut im § 9 Nr. 1 AÜG geändert werden. Vorgeschlagen wird die folgende Ergänzung des § 9 Nr. 1 AÜG (die Ergänzung ist hier kursiv hervorgehoben):
„Unwirksam sind:
1. Verträge zwischen Verleihern und Entleihern sowie zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern, wenn der Verleiher nicht die nach § 1 erforderliche Erlaubnis hat oder bei vorhandener Erlaubnis die Überlassung des Leiharbeitnehmers nicht eindeutig als Arbeitnehmerüberlassung kenntlich macht,“ (Schüren 2013: 178) … Durch diese überaus scharf wirkende Ergänzung innerhalb des AÜG würde der faktische Entleiher erhebliche Sanktionen fürchten müssen, bis hin zur Strafbarkeit seines Verhaltens, was eine erhebliche Abschreckungswirkung entfalten würde.« (Sell 2013: 11).
Nun sind drei Jahre ins Land gezogen – und endlich scheint sich dieser auf Schüren zurückgehende Vorschlag in die Wirklichkeit zu begeben. Selbst die IG Metall jubelt, folgt man dem Artikel Große Koalition beendet Gesetzes-Blockade auf der Seite www.faire-werkvertraege.de. Dort findet man unter der Überschrift „Scheinwerkverträge erschwert“ folgenden Passus:
»Bei Werkverträgen macht der Gesetzesentwurf Schluss mit dem verbreiteten Etikettenschwindel: Werden Arbeitgeber bei einem illegalen Scheinwerkvertrag erwischt, drohen ihnen künftig rechtliche Konsequenzen. Eine Verleiherlaubnis „auf Vorrat“ hilft nicht mehr weiter. Vielmehr muss laut dem Gesetzesentwurf von Anfang an vertraglich klargestellt werden, ob es sich um Arbeitnehmerüberlassung oder um einen Werkvertrag handelt. Ein Umdeklarieren während der Vertragslaufzeit soll nicht mehr möglich sein. Auch die Informationsrechte von Betriebsräten werden gestärkt. Zudem sieht Gesetzesentwurf ein Beratungsrecht im Rahmen der Personalplanung bei Fremdvergabe vor.«
Also alles gut? Mitnichten.
Wem auch immer ist es gelungen, in den Referentenentwurf, der nunmehr in das Gesetzgebungsverfahren eingespeist wird, einen folgenschweren Passus einzubauen, der die Hoffnung der IG Metall, die man dem Zitat entnehmen kann, ein grausiges Ende bereiten wird. Peter Schüren hat das in einem Beitrag unter der Überschrift „Widerspruchsrecht gem. § 9 Nr. 1 AÜG 2017 – Ein Kuckuckskind im Koalitionsvertragsnest?“ (Schüren, jurisPR-ArbR 19/2016 Anm. 1) so auf den Punkt gebracht:
»Das fingierte Arbeitsverhältnis zum Entleiher ist seit 1972 die Rechtsfolge bei der Überlassung eines Arbeitnehmers ohne Erlaubnis. Die Folgen sind bekannt, furchterregend und folglich abschreckend. Ein Unternehmen, das Scheinwerkverträge zur Kostensenkung nutzt, geht ein großes Risiko ein.
Der BMAS-Entwurf (3. Versuch, Fassung vom April 2016) sieht für die illegale Überlassung ein Widerspruchsrecht des einzelnen Arbeitnehmers gegen das fingierte Arbeitsverhältnis vor …
Auf den Punkt gebracht: Das Widerspruchsrecht bei illegaler Überlassung schützt nur den illegalen Entleiher – den schützt es freilich sehr wirksam.«
Das geplante Widerspruchsrecht konterkariert vollständig die seit langem geforderte und an sich folgenschwere sowie konsequente Inhaftnahme des faktischen Entleihers bei Scheinwerkverträgen.
»Die Regelung wäre für einige ein Segen: Unternehmen, die sich illegal Personal ausleihen, könnten damit viele Millionen sparen. Und die beteiligten Führungskräfte würden besser schlafen, weil sie sich nicht mehr vor dem Staatsanwalt fürchten müssen«, so Peter Schüren.
Der hat gemeinsam mit Sabrina Fasholz bereits 2015 auf das Scheunentor hingewiesen, das nunmehr offensichtlich geöffnet werden soll: In dem Artikel „Inhouse-Outsourcing und Diskussionsentwurf zum AÜG – Ein Diskussionsbeitrag“, erschienen in der Neuen Zeitschrift für Arbeitsrecht (Heft 24/2015, S. 1473 ff.), führen die beiden mit Blick auf die vorgesehene „schriftliche Erklärung“, beim Verleiher bleiben zu wollen, aus:
»Indessen legt die Regelung ist dem vorausschauenden Verleiher und dem vorsichtigen Entleiher nahe, alle Arbeitnehmer, die im Rahmen eines dubiosen Werk- oder Dienstvertrags überlassen werden, eine solche Erklärung vor Arbeitsantritt beim Kunden vorsorglich unterschreiben zu lassen. Dann könnte die neue Regelung tatsächlich ein „Riesenproblem“ lösen: Die fingierten Arbeitsverhältnisses zum Endlager mit der anknüpfenden Beitragspflicht in den Zweigen der Sozialversicherung wären weg.
Will das BMAS den großen „Reservefallschirm“ Überlassungserlaubnis beseitigen – und dann durch viele kleine Reservefallschirme ersetzen? So wie der Vorschlag jetzt ist, gleicht die schriftliche Erklärung der möglicherweise illegal überlassenen Arbeitnehmer, sie wollten beim Verleiher bleiben, in ihrer Wirkung den teils dubiosen Entsendebescheinigungen (A1), die bei ausländischen Scheinwerkunternehmen „zur Sicherheit“ für die Mitarbeiter aus der Heimat mitgebracht werden und die so ein fingiertes Arbeitsverhältnis bei illegaler Überlassung seit 2006 verhindern.« (Schüren/Fasholz 2015: 1475).
Auch Wolfgang Hamann von der Universität Duisburg-Essen hat in einem Beitrag in der Zeitschrift „Arbeit und Recht“ (Heft 4/2016) darauf hingewiesen: »Ob die geplante Neuregelung geeignet ist, das Ende der „Vorratserlaubnis“ einzuläuten, muss bezweifelt werden. Eher werden zukünftig die im Rahmen grenzwertiger Werkverträge zum Einsatz kommenden Arbeitnehmer selbst für das „Auffangnetz“ sorgen. Sie werden vor oder spätestens bei Aufnahme der Arbeit im Fremdbetrieb in einem ihnen von ihrem Arbeitgeber oder dessen Auftraggeber vorgelegten Formular erklären, dass sie an den Arbeitsvertrag mit ihrem Vertragsarbeitgeber festhalten. Derartige Erklärungen sind der Entwurfsfassung zufolge nicht ausgeschlossen.« (S. 136).
Diesen problematischen Punkt behandeln auch Klaus Ernst und Jutta Kielmann in ihrer Kommentierung: Die Bundesregierung plant Verschlechterungen bei Leiharbeit und Werkverträgen – Kritik am Referentenentwurf des BMAS (April 2016), Berlin, 12.05.2016. Sie schreiben:
»Wenn das neue Widerspruchsrecht eingeführt ist, wird das Unternehmen, das solches Fremdpersonal einsetzt, schon bei Arbeitsaufnahme von jedem Fremdmitarbeiter verlangen, dass er einen solchen Widerspruch abgibt. Dann ist der illegale Entleiher in Sicherheit: Es gibt kein Arbeitsverhältnis zum Entleiher, keine Lohnzahlungspflicht und zwangsläufig keine Strafbarkeit wegen Beitragshinterziehung mehr. Der illegale Entleiher stünde nach dieser „Reform“ sogar besser da als ein legaler Entleiher, denn er haftet nicht einmal als Bürge für die Sozialversicherungsbeiträge – diese Haftung gibt es bei legaler Überlassung.«
Möglicherweise fragt sich an dieser Stelle der eine oder die andere, warum überhaupt bzw. mit welcher Begründung die Bundesregierung diese Regelung aufgenommen hat in den Gesetzestext für den Entwurf: Man will den Arbeitnehmer davor „schützen“, dass er vom Entleiher in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen werden müsste. Das nun wiederum ist ein wirklich putziges Argument angesichts der empirischen Realität. Dazu wieder Peter Schüren:
»Aus der Praxis ist kein einziger Fall bekannt, in dem ein Arbeitnehmer erfolgreich gezwungen wurde, nach einer illegalen Überlassung beim Entleiher zu bleiben. Normalerweise muss sich ein Arbeitnehmer gegen harten Widerstand einklagen, wenn er tatsächlich im fingierten Arbeitsverhältnis bleiben will. Auch das BMAS hat keinen solchen Fall gefunden, in dem ein Arbeitnehmer über das fingierte Arbeitsverhältnis seinen Arbeitsplatz beim illegal tätigen Verleiher gegen seinen Willen wegen der Fiktion verloren hat.
Aber es gäbe in Zukunft mit Sicherheit tausende von Fällen der illegalen Überlassung, in denen das Widerspruchsrecht die Führungskräfte der illegalen Entleiher vor der Strafbarkeit wegen Beitragshinterziehung schützen könnte.«
Vor diesem Hintergrund hat Schüren die vorgesehene Widerspruchsregelung in seinem SWR-Interview auch als einen „tollen Trick“ bezeichnet – aber nicht für die betroffenen Leiharbeiter, sondern für die illegalen Arbeitnehmerüberlasser.
Fazit: Wir sind hier mit einem echten Schildbürgerstreich konfrontiert, wenn es denn einen um die Begrenzung der missbräuchlichen Inanspruchnahme von Leiharbeit geht. Oder steckt da mehr hinter als nur ein Versehen, eine gesetzgeberische Tollpatschigkeit? Das wäre ein starkes Stück, aber nicht wirklich überraschend.
Man kann folglich nur hoffen, dass im Gesetzgebungsverfahren diese Verschlechterung noch gekippt wird. Die Gewerkschaften müssten – eigentlich – ein großes Interesse daran haben, das zu erreichen. Wenn nicht, dann müsste man über deren wahren Interessen nochmals nachdenken. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass das mit dem „tollen Trick“ für die anderen einfach noch nicht wirklich angekommen ist. Das wäre zu hoffen.
Die Leiharbeitsbranche selbst versucht derzeit, von diesen wirklichen Problemen abzulenken. So berichtet die FAZ unter der Überschrift: Zeitarbeit sorgt sich um Tausende Arbeitsplätze: »In einer aktuellen Umfrage durch die Marktforschungsgesellschaft Lünendonk rechnen die 25 größten Anbieter für Leiharbeit im laufenden Jahr nur noch mit einem Marktwachstum von 2,9 Prozent. Im vergangenen Jahr legte die Branche noch um 6,4 Prozent auf knapp 30 Milliarden Euro zu. Die Zahl der Leiharbeiter stieg um 3,5 Prozent auf rund 930.000, wie aus der Studie hervorgeht«, berichtet Sven Astheimer in seinem Artikel:
»Die Unsicherheit der Unternehmen entspringt vor allem Nahles’ Vorgabe, dass Zeitarbeiter und Stammkräfte des Einsatzunternehmens nach neun Monaten gleich bezahlt werden müssen. Aber bis heute sieht das Gesetz keine Definition vor, welche Bestandteile das umfasst: nur das Grundgehalt oder ist die komplette Vergütung gemeint? Dann müsste das Zeitarbeitsunternehmen bei der Bezahlung seiner Mitarbeiter vielleicht auch den Kantinen-, Dienstwagen- oder Kitazuschuss der vergleichbaren Stammbelegschaft des Kunden abbilden. Geklärt würde die Frage dann wohl vor Gericht, eine Prozesslawine droht.«
Und weiter: »Denn wenn die Rechtsunsicherheit so hoch bleibe, würden viele Zeitarbeitskonzerne und Kunden auf Nummer Sicher gehen und ihre Mitarbeiter vor Ablauf der neun Monate abziehen.« Klar, das werden sie sowieso in vielen Fällen machen, das sieht man doch schon heute als Normalfall. Und darüber hinaus gibt es ja auch noch eine andere Option:
»Wenn das Gesetz in den kommenden Wochen ausgearbeitet wird, will die Branche bei Nahles deshalb darauf dringen, dass den Tarifpartnern die Möglichkeit für eine Pauschalierung der Gleichbezahlung gegeben wird. Die IG Metall habe schon angedeutet, dass sie sich auf die Lösung „Stundenentgelt plus Zulagen“ einlassen würde, das sei akzeptabel. Damit wäre die hohe Rechtsunsicherheit ausgeräumt.«
Man könnte auf die Idee kommen, dass die Gewerkschaften ein Interesse haben (müssen), auch diesen Punkt abzuräumen – so jedenfalls die Interpretation, die sich aufdrängt, wenn man dem Artikel folgt. Sollte es wirklich so sein, dass die mächtigen Betriebsräte der großen Unternehmen wie Daimler und andere sich durchgesetzt haben dergestalt, dass man die Leiharbeiter als Flexibilitätsreserve für die Absicherung der Stammbelegschaften braucht? Das wäre keine ehrenrührige Debatte, sie müsste nur mal endlich mit offenen Visier geführt werden.
Auf der anderen Seite – so schlecht scheint es der Branche nicht zu gehen, wenn man solche Zahlen zur Kenntnis nehmen muss:
»An der Spitze stand auch im vergangenen Jahr der niederländische Randstad-Konzern, der auf einen Umsatz von knapp 2 Milliarden Euro in Deutschland kam. Wenn sich die gute Entwicklung des ersten Quartals fortsetzt, könnte die Marke von 2 Milliarden Euro im Jahresverlauf geknackt werden. Der weltgrößte Personaldienstleister Adecco aus der Schweiz hat mit 1,65 Milliarden Euro den zweiten Platz souverän behauptet. Auf Rang drei der Liste kehrte Manpower mit 775 Millionen Euro Jahresumsatz zurück.«
Aber auch hier darf die Tränenvase für die „arme Branche“ nicht fehlen:
»Eine weitere Entwicklung, die das Wachstum der Branche bremst, sind zunehmende Engpässe an Personal. Gerade in Süddeutschland, wo vielerorts Vollbeschäftigung herrscht, sei es kaum noch möglich, qualifiziertes Personal zu finden, heißt es. Selbst Helfer seien mancherorts rar. Deshalb rekrutieren die Unternehmen verstärkt im Ausland, etwa in Polen oder Tschechien.«
Wundert es uns an dieser Stelle, dass die betroffenen Unternehmen sogleich Forderungen an den Staat richten? Nicht wirklich: „Die Anerkennung von Qualifikationen ist aber weiterhin ein großes Problem“, wird Reiner Dilba, Geschäftsführer der Leiharbeitsfirma Orion, zitiert. Da bekommt das BMAS doch gleich neue Hausaufgaben.
Während die Verleiher munter weiter vor sich hinfordern, sollte man die wirklich enttäuschende Regelungsfolgen, die in diesem Beitrag angesprochen worden sind, nicht vergessen. Wenn das so bleibt, dann ist die „Reform“ des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes ein trojanisches Pferd im Arbeitnehmerlager. Das kann doch nicht gewollt sein. Oder?