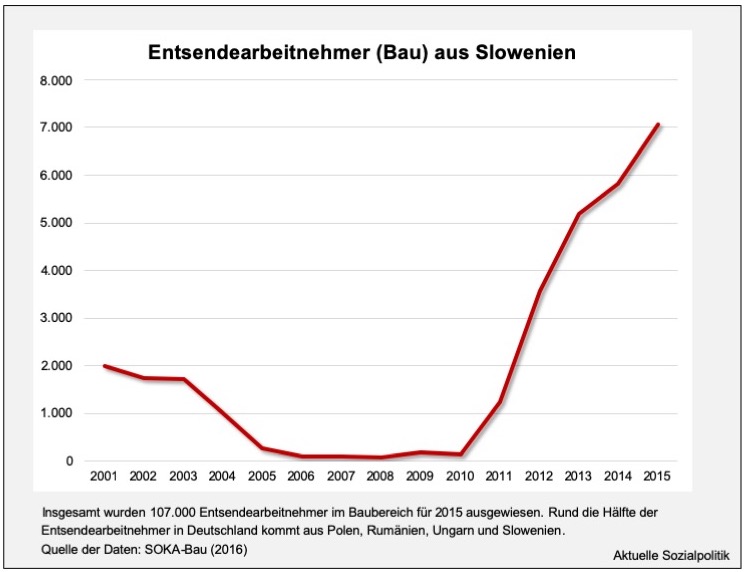»Zwischen Göteborg und Porto liegen 2500 Kilometer – oder dreieinhalb Jahre. Im November 2017 hatte sich die EU in Schweden erstmals auf grundlegende gemeinsame soziale Standards geeinigt: angemessene Mindestlöhne, die Gleichbehandlung von Frauen und Männern, das Recht auf lebenslange Weiterbildung, eine gute Gesundheitsversorgung«, so Jakob Mayr in seinem wenigstens mit einem Fragezeichen im Titel versehenen Bericht Wie sozial darf’s denn sein? »In Göteborg vereinbarten die Staats- und Regierungschefs eine „europäische Säule sozialer Rechte“. In der portugiesischen Küstenstadt Porto diskutieren sie jetzt, ob diese Säule wirklich trägt – mit Blick auf die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, die die Sozialsysteme einiger EU-Mitgliedsstaaten überfordert hat.«
Und offensichtlich scheint es nicht nur bei Diskussionen geblieben zu sein, folgt man solchen Meldungen: EU-Staaten verpflichten sich auf konkrete Sozialziele: »Eine hohe Beschäftigungsquote, Fortbildungsgarantie und der gezielte Kampf gegen die Armut: Die EU will die soziale Lage in Europa bis 2030 spürbar verbessern.« Das sind bedeutsame Ziele. Was genau hat man denn nun vereinbart? »In einer Erklärung verpflichteten sich die Teilnehmenden des Sozialgipfels auf konkrete Ziele, um die soziale Lage bis 2030 spürbar zu verbessern. So soll bis zum Ende des Jahrzehnts eine Beschäftigungsquote von mindestens 78 Prozent in der EU erreicht werden. Mindestens 60 Prozent der Erwachsenen sollen jährlich Fortbildungskurse belegen und die Zahl der Menschen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind, soll um mindestens 15 Millionen reduziert werden.« Zur Einordnung der letzten Zahl: Aktuell sind nach Angaben des Europäischen Statistikamtes Eurostat rund 91 Millionen Menschen in den 27 EU-Ländern von Armut oder sozialem Ausschluss bedroht.