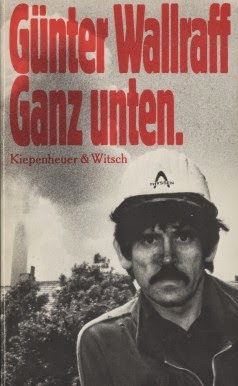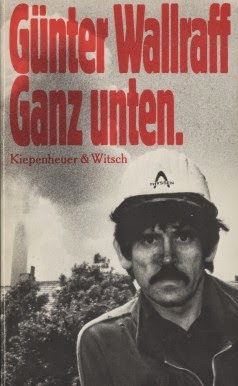Gibt es Hoffnung? Wenn man solche Schlagzeilen liest, dann muss es solche geben: Katholische Kirche plant moderneres Arbeitsrecht. Was steht an? Verabschiedet sich die katholische Kirche nun doch von ihren umfassenden Sonderrechten, was die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen mit den Beschäftigten in kirchlich gebundenen Einrichtungen angeht? Gewährt sie nun auch ihren Mitarbeitern die Grundrechte, die „normale“ Arbeitnehmer schon lange haben, also beispielsweise das Streikrecht? So weit soll es dann doch nicht gehen, insofern ist die Überschrift dieses Artikels zum gleichen Sachverhalt zutreffender: Katholische Kirche will offenbar Arbeitsrecht lockern. Es geht um eine ganz bestimmte Lockerungsübung, die übrigens nur in Aussicht gestellt wird, konkret: Um die für die katholische Kirche ganz offensichtlich schwierige Frage, wie man mit geschiedenen und wieder neu verheirateten Mitarbeitern umzugehen gedenkt – eine Fallkonstellation, die ja in unserer Gesellschaft öfter vorkommen soll und die eigentlich – sollte man meinen – den Arbeitgeber aber so gar nichts angeht. So einfach ist es hier eben nicht.
»Geschieden, neu verheiratet – und prompt gefeuert: So erging es Angestellten von katholischen Arbeitgebern bisher. Doch offenbar zeichnet sich in der Kirche jetzt ein Umdenken ab«, können wir dem Bericht entnehmen, der gleich ein „moderneres“ Arbeitsrecht ante portas sieht. Denn:
»Die katholische Kirche will … auf wiederverheiratete Geschiedene zugehen und ihr Arbeitsrecht in einem wichtigen Punkt ändern. Eine automatische Kündigung von Geschiedenen, die eine neue Ehe eingehen, solle künftig nicht mehr vorgesehen sein … Das gehe aus dem Änderungsvorschlag für die „Grundordnung des kirchlichen Dienstes“ in den deutschen Bistümern hervor. Der Vorschlag ist demnach Ergebnis von Beratungen einer Arbeitsgruppe unter Leitung des ehemaligen Freiburger Erzbischofs Robert Zollitsch und des Verbands der Diözesen Deutschlands. Er solle für alle katholischen Arbeitgeber gelten, also auch für Krankenhäuser und die Caritas.«
Und dann kommt vor dem grundsätzlichen Hintergrund des Tatbestands, dass die katholische Kirche Ehescheidungen nicht anerkennt und infolgedessen standesamtliche Wiederverheiratungen deshalb als „widerrechtlich“ betrachtet, ein Passus, der vor allem hinsichtlich der dort verwendeten Begrifflichkeit ein Armutszeugnis für eine Kirche reflektiert, denn zur vorgeschlagenen „Reform“ heißt es:
»Dem Bericht zufolge soll ein solcher „kirchenrechtlich unzulässiger Abschluss einer Zivilehe“ aber künftig nur noch als Kündigungsgrund gelten, „wenn dieser nach den konkreten Umständen objektiv geeignet ist, ein erhebliches Ärgernis in der Dienstgemeinschaft oder im beruflichen Wirkungskreis zu erregen und dadurch die Glaubwürdigkeit des kirchlichen Dienstes zu beeinträchtigen“.«
Also weiterhin eine Kündigung, wenn die (erneute) Eheschließung zwischen zwei Menschen „ein erhebliches Ärgernis“ darstellt – so eine Formulierung lässt schon tief blicken und muss einen halbwegs sensiblen Menschen erschauern lassen. „Ein erhebliches Ärgernis“.
Unabhängig von der ganzen Fragwürdigkeit dieser Begrifflichkeit – wenn man sich nun darauf einlässt, weil es ja hier nicht um die eigene Meinung geht, sondern um das Verständnis eines sehr großen Arbeitgebers in unserem Land, dann stellt sich schon nach dem ersten Hinschauen sofort die Frage, wer definiert denn eigentlich wann und warum das „Ärgernis“ Wiederverheiratung ein „erhebliches Ärgernis“ wird? Wo ist die Grenze zu einer willkürhaften Entscheidung angesichts eines derart unbestimmten Rechtsbegriffs?
Natürlich gibt es immer die unterschiedlichen Perspektiven auf ein und denselben Sachverhalt – also ist die Flasche halb voll oder halb leer. Die Bewertung als eine „deutliche Lockerung gegenüber der bisherigen Regelung“ – wenn denn die nun vorgeschlagene Revision kommen würde -, stellt ab auf die aktuelle Grundordnung der Kirche, nach der von einer Kündigung nur „ausnahmsweise“ abgesehen werden, „wenn schwerwiegende Gründe des Einzelfalles diese als unangemessen erscheinen lassen“. So kann man das auch sehen.
Wie es in dieser Frage weitergeht? Bis November soll ein abschließender Entwurf vorliegen, den die Deutsche Bischofskonferenz dann beschließen müsse. Es wird berichtet, dass die meisten Stellungnahmen der Diözesen zu dem Entwurf positiv seien, nur ein Bistum lehne ihn weitgehend ab. Man muss das alles einordnen in einen komplexen und wahrscheinlich nur für absolute Insider diese Organisation betreffende Diskussionslinie innerhalb der katholischen Kirche, die sich vor allem entzündet an der Bedeutung und Zukunft der inmitten sehr weltlicher Arbeit steckenden Caritas. Wie schwer man sich tut, die gesellschaftlichen Veränderungen neu abzubilden, kann man dieser Veröffentlichung der Deutschen Bischofskonferenz entnehmen:
Deutsche Bischofskonferenz: Das katholische Profil caritativer Dienste und Einrichtungen in der pluralen Gesellschaft, Bonn, April 2014
Aber lösen wir uns von dem beschriebenen Sachverhalt und werfen die Frage in den Raum, wie man vor dem Hintergrund der nun erkennbaren, eigentlich marginalen Änderung des Umgangs mit den Mitarbeitern (die allerdings – das sei hier deutlich hervorgehoben – in vielen Einzelfällen tragische Folgen für die davon Betroffenen mehr als bislang verhindern könnten, wo vielen der wirtschaftliche Boden unter den Füßen weg gerissen wurde, nur weil sie einen anderen Menschen geheiratet haben nach einer Scheidung) von einem „moderneren“ Arbeitsrecht sprechen kann?
Ein wirklich modernes Arbeitsrecht – so viel vorweg – würde sich zuvörderst dadurch auszeichnen, dass es selbstverständlich für alle gilt. Und das man die dort normierten Regeln auch einklagen kann. Vor staatlichen Gerichten. Ein modernes Arbeitsrecht würde keine so umfassende Sonderrechtszone für hunderttausende Beschäftigte zulassen, wie es sie aber derzeit den Kirchen gewährt wird. Besondere Arbeitsverhältnisse mögen ihre Berechtigung gehabt haben, als die Kirchen ausschließlich oder überwiegend mit Schwestern und anderem „eigenem“ Personal gearbeitet haben. Aber in einer Zeit, in der dieses Sonderrecht auch für die vielen Beschäftigten gilt, die in voll aus Steuer- und/oder Beitragsmitteln finanzierten Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, Jugendhilfeeinrichtungen, Kindertageseinrichtungen usw. arbeiten. Und es argumentiere an dieser Stelle keiner, dass man sich ja seinen Arbeitgeber aussuchen könne, man müsse ja nicht bei der katholischen Kirche arbeiten – wenn man sich der Marktanteile kirchlich gebundener Einrichtungen beispielsweise im Krankenhaus- oder Kita-Bereich in manchen Regionen unseres Landes anschaut, dann wird man zur Kenntnis nehmen müssen, dass es für zahlreiche Berufe aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich gar keine Arbeitgeber-Alternative vor Ort gibt, sie sind durch die Faktizität der Trägerschaftsstrukturen darauf angewiesen, in kirchlich gebundenen Einrichtungen eine Beschäftigung zu finden, die sie dann aber dem Sonderrecht der Kirchen unterwirft, das ihnen wiederum in Teilbereichen eigentlich selbstverständliche Rechte „normaler“ Arbeitnehmer vorenthält.
Die Verhaltensweise des Staates und seiner Organe ist hier – um es vorsichtig auszudrücken – „ambivalent“. Zum einen stützt die Rechtsprechung die Sonderrolle der Kirchen in der Arbeitswelt, zuletzt haben wir das wieder zur Kenntnis nehmen müssen im Kontext einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts die leidige Kopftuchfrage betreffend (vgl. hierzu meinen Blog-Beitrag Das Kreuz mit den „Sonderrechten“. Ein neues Urteil des Bundesarbeitsgerichts stärkt die Kirchen in ihrem Kampf gegen Kopftücher vom 24. September 2014). Zum anderen ist der Staat und seine Sozialversicherungen nicht nur der mit Abstand größte Finanzier der meisten Einrichtungen und Dienste, sondern er ermöglicht den Kirchen auch eine im Vergleich zu den allermeisten anderen Ländern (in denen die Kirchen auf Spenden ihrer Mitglieder angewiesen sind) absolut sichere Finanzierungsbasis über die vom Staat eingezogene „Kirchensteuer“. Das beschert den Kirchen hier in Deutschland eine sehr solide Finanzbasis. Vgl. dazu den Artikel Rekord-Einnahmen bei den Kirchen: »Nach jüngsten Schätzungen erwarten die Bistümer und Landeskirchen für 2014 elf Milliarden Euro Einnahmen aus der Kirchensteuer – so viel wie noch nie.« 2012 und 2013 waren auch schon jeweils Rekordjahre hinsichtlich der Höhe der eingenommenen Kirchensteuer.
Die Kirchensteuerdiskussion soll und kann an dieser Stelle gar nicht geführt werden, sehr wohl aber darf und muss mit Blick auf das hier besonders interessierende Thema Arbeitsrecht die Frage aufgeworfen werden, wann wir endlich wirklich ein „moderneres“ Arbeitsrecht bekommen – moderner dadurch, dass es erst einmal für alle Arbeitnehmer gilt. Das Pfarrer oder Mönche in einem Sonderarbeitsrechtsverhälnis zu ihrer Kirche verbleiben können, würde keiner verweigern. Aber die normale Krankenschwester, Erzieherin oder der Sozialarbeiter und die Hauswirtschaftskräfte – sie alle gehören unter das Dach eines „moderneren“ Arbeitsrechts. Diesen Schritt wird man von den Kirchen nicht erwarten können, er muss vom Staat gemacht werden.