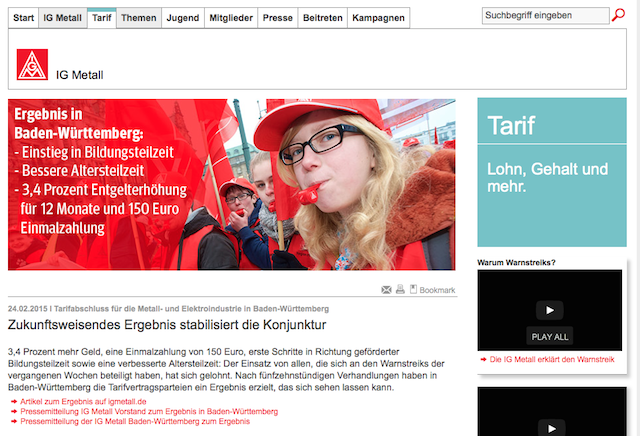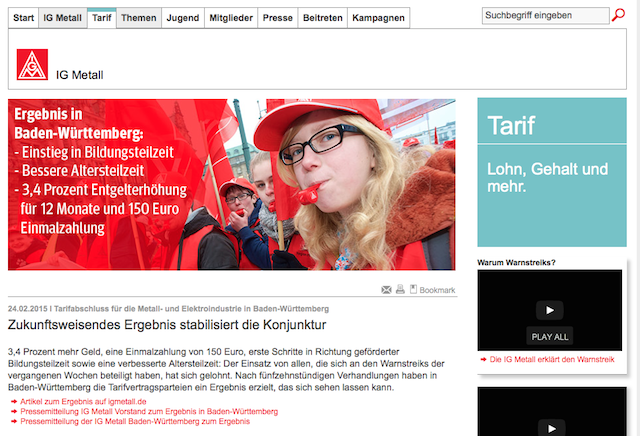»Kirchliche Kitas, Schulen und Krankenhäuser werden größtenteils aus öffentlichen Mitteln finanziert. Die Kirchen bestimmen aber über die Moralvorstellungen ihrer Angestellten und verlangen deren Kirchenmitgliedschaft. Sind diese Sonderrechte noch zeitgemäß?« So lautet die Fragestellung eines längeren Beitrags von Gaby Mayr unter der Überschrift Die Sonderrechte der Amtskirchen, der vom Deutschlandradio Kultur ausgestrahlt worden ist. Ein immer wieder vorgetragenes Thema von grundsätzlicher Bedeutung, das besonders dann ins Bewusstsein gerufen wird, wenn die Amtskirche mal wieder sanktionierend tätig geworden ist (vgl. dazu aus der jüngsten Vergangenheit nur den Artikel Erzieherinnen wegen ihres Privatlebens gekündigt. Darin werden zwei unterschiedliche Fälle behandelt: Eine lesbische Erzieherin verliert ihren Job in einem Kinderhort, weil sie ihre Freundin heiratet, was auf großes Unverständnis und Kritik stößt. Einer anderen Erzieherin, die in einer Einrichtung der Diakonie arbeitet, wird gekündigt, weil sie in ihrer Freizeit Pornos dreht. In diesem Fall sei die Kündigung rechtmäßig, so das Landesarbeitsgericht in München).
Gaby Mayr beleuchtet in ihrer Reportage die gesamt Bandbreite dessen, was als „Kirchenprivilegien“ kontrovers diskutiert wird, beispielsweise dass der Staat mit seinen Finanzbehörden für die Kirchen den Kassenwart gibt (Stichwort Kirchensteuereinzug). Übrigens: Der staatliche Steuereinzug wurde in einem Konkordat von 1933 zwischen der Hitlerregierung und dem Heiligen Stuhl geregelt. Es ist der einzige internationale Vertrag der Nazi-Regierung, der nicht aufgehoben wurde.
Der Schwerpunkt des Beitrags liegt aber auf dem Sonderrecht der Kirchen hinsichtlich des Arbeitsrechts – dazu gehört auch und in diesen Tagen besonders prominent das Streikverbot der Mitarbeiter konfessionell gebundener Einrichtungen, was wir in den kommenden Tagen erleben werden, wenn die Erzieher/innen der kommunalen Kindertageseinrichtungen in einen unbefristeten Arbeitskampf ziehen werden. Ihre Kolleginnen aus den katholischen und evangelischen Einrichtungen können da nur als Zaungäste die Daumen drücken.
Hinsichtlich des eigenen Sonderarbeitsrechts der Kirchen ist viel überkommene Tradition im Spiel, die man zu Recht kritisieren kann und muss – aber auch, das macht die Sache noch schlimmer – auch viel Willkür. Hierzu ein Beispiel aus dem Beitrag von Gaby Mayr:
»Bei den beiden großen christlichen Kirchen folgen Gesetzgeber und Gerichte häufig dem, was die Kirchen selber für ihr gutes Recht halten. So gab im Oktober 2014 das Verfassungsgericht einem katholischen Krankenhaus Recht, das einen Chefarzt wegen seiner Wiederverheiratung nach der Scheidung entlassen hatte. Das falle unter das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, urteilte Karlsruhe.«
Das ist die eine Seite der Medaille. Nun könnte man an dieser Stelle argumentieren, schlimm genug, dass man für eine Angelegenheit aus dem Privatleben dermaßen und möglicherweise existenzbedrohend sanktioniert werden kann. Aber wenn dann wenigstens die Praxis des Umgangs mit dem Thema einheitlich und verlässlich wäre – also wenn die Lage so wäre, dass jeder, der sich auf eine Tätigkeit in einem konfessionell gebundenen Unternehmen einlässt, weiß, das es diese Konsequenzen haben wird. Aber dem ist in praxi gerade nicht so. Ich kenne zahlreiche Chefärzte katholischer Krankenhäuser, die in – aus katholischer Sicht – völlig „unverantwortlichen“ privaten Verhältnissen leben. Und kein Hahn kräht danach. Weil auch die katholischen Träger von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen wissen genau, was das Wort Fachkräftemangel bedeutet. Und wenn sie die Positionen nicht anders besetzt bekommen, dann drücken sie auch gerne mal zwei Augen ganz dicke zu.
Aber jetzt kommt Hoffnung auf, wenn man denn den Überschriften trauen darf: Deutsche Bischöfe ändern kirchliches Arbeitsrecht oder Katholische Kirche geht auf geschiedene Mitarbeiter zu, um nur zwei Berichte zu zitieren. Was ist passiert? Hat man endlich ein Einsehen, dass 99% der Katholiken sowieso anders leben, als es die kirchliche Moral sich so vorstellt? Akzeptiert man, dass die Menschen ein Recht haben, selbst zu entscheiden, wie sie ihr Privatleben verbringen?
Die Antwort wird nicht überraschen, denn sie fällt typisch katholisch aus: Ein bisschen schon und man weiß um diese an sich verwerflichen Dinge, aber man will es auch nicht übertreiben mit dem Entgegenkommen. Signale der Ermunterung und Hoffnung, dass es vorangeht, aussenden und die Zügel in der Hand zu halten hoffend, so kann man das vielleicht beschrieben.
Schauen wir uns den Sachverhalt an, um den es geht:
Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) hat eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts beschlossen – das hört sich doch erst einmal vielversprechend an. Die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) klärt uns auf vgl. dazu den Beitrag Deutsche Bischöfe ändern kirchliches Arbeitsrecht): »Reformen gibt es insbesondere im Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen und Angestellten, die in eingetragenen Lebenspartnerschaften leben. Außerdem sollen die Gewerkschaften – als Reaktion auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 2012 – mehr Mitsprache bei der Aushandlung der Arbeitsbedingungen erhalten.«
Wie immer im Leben muss man ins Kleingedruckte schauen: Beschlossen wurde eine Änderung der sogenannten „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ (Grundordnung – GrO). Da stehen jetzt die Neuerungen drin. Aber: Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken appellierte an die 27 Oberhirten, ein einheitliches kirchliches Arbeitsrecht in Deutschland zu erhalten. Sicher ist das nicht. Denn vergangene Woche hatten nur «mehr als zwei Drittel» der Diözesanbischöfe für die Reform gestimmt. Sollte der ein oder andere Bischof die neue Grundordnung nicht in Kraft setzen, gilt in seinem Bistum die alte Rechtslage.
Scheidung und erneute standesamtliche Heirat soll in katholischen Krankenhäusern, Kindergärten oder Schulen in Deutschland nur noch in Ausnahmefällen ein Kündigungsgrund sein. So kann man es jetzt lesen. Aber man muss schon genauer hinschauen, beispielsweise in die Mitteilung der Deutschen Bischofskonferenz: »Die erneute standesamtliche Heirat nach einer zivilen Scheidung ist zukünftig grundsätzlich dann als schwerwiegender Loyalitätsverstoß zu werten, wenn dieses Verhalten nach den konkreten Umständen objektiv geeignet ist, ein erhebliches Ärgernis in der Dienstgemeinschaft oder im beruflichen Wirkungskreis zu erregen und die Glaubwürdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen. Dasselbe gilt für das Eingehen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.«
Man muss das mal eine Zeit lang auf sich wirken lassen – ein „erhebliches Ärgernis in der Dienstgemeinschaft“. Klarheit sieht anders aus. Nicht Fisch, nicht Fleisch.
Angekündigt werden auch Verbesserungen im kollektiven Arbeitsrecht – und da geht es vor allem um die (Nicht-)Rolle der Gewerkschaften. Hierzu erfahren wir:
Öffnungen gibt es auch mit Blick auf die Beteiligung der Gewerkschaften, die bei der Gestaltung der kirchlichen Arbeitsbedingungen mit am Tisch sitzen wollen. In Zukunft sollen sie – je nach gewerkschaftlichem Organisationsgrad der kirchlichen Angestellten – in den arbeitsrechtlichen Kommissionen von Kirche und Caritas repräsentiert sein. Zugleich heißt es aber in der neuen Grundordnung, dass «kirchliche Dienstgeber keine Tarifverträge mit Gewerkschaften abschließen. Streik und Aussperrung scheiden ebenfalls aus.»
Fortschritt sieht anders aus. Bewegung ja, aber eben eher tänzerische Pirouetten.
Aber man kann es auch gelassen sehen. Spätestens, wenn der „doppelte Fachkräftemangel“ die konfessionell gebundenen Einrichtungen immer stärker erreicht, wird es weitere Bewegungen geben müssen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.