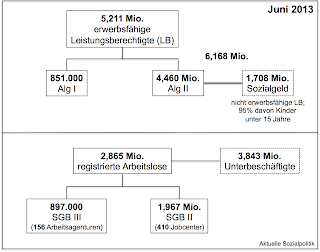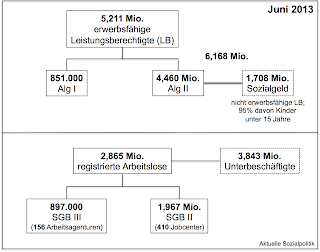Früher war nicht alles, aber vieles einfacher. Auch in der Welt der Absicherung gegen das Risiko Krankheit. Die meisten Menschen waren automatisch in der Gesetzlichen Krankenversicherung, der GKV, versichert. Lange Zeit sogar getrennt nach Arbeitern und Angestellten, seit den 1990er Jahren gibt es auch zwischen den Krankenkassen zunehmend Wettbewerb um die Versicherten. Wenn man Arbeitnehmer war – und das waren und sind die meisten – dann hat der Arbeitgeber die eine Hälfte des Beitrags überwiesen und die andere Hälfte wurde einem vom Lohnzettel gleich abgezogen und ebenfalls vom Arbeitgeber an die Kasse weitergereicht. Irgendwie einfach und geräuschlos.
Und dann gab es noch die anderen, die sich die „Premium-Klasse“ der Absicherung gegönnt haben, also die Selbständigen, denen man die eigene Absicherung überlassen hatte, weil der Regelfall ja auch der war, dass man als Selbständiger über genügend Mittel verfügte, um selbst für den Ruhestand und gegen das Krankheitskostenrisiko vorzusorgen. Die gingen dann in die Private Krankenversicherung (PKV), wo sie anders als in der GKV zwar keine einkommensabhängigen Beiträge zahlen müssen (was ja eine sozialpolitisch gewollte Umverteilung zugunsten der unteren Einkommen bedeutet), sondern einkommensunabhängige Prämien, die von den Versicherungen auf für die Betroffenen zumeist geheimnisvollen Wegen kalkuliert wurde. Die aber gerade in dem Moment, wo man sich für einen Eintritt in die schöne Welt der PKV entscheiden sollte, zumeist unschlagbar günstig daherkamen, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass gleichzeitig ein Leistungsversprechen gegeben werden konnte, das weit schöner aussah als das, was die „Holzklasse“ der GKV anzubieten in der Lage war: Chefarztbehandlung, Ein- oder Zweibettzimmer usw. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle angemerkt, dass neben denen zumeist Selbstständigen, die eine Vollversicherung abgeschlossen haben, auch die Beamten in der PKV ergänzend zu ihrer Beihilfe versichert sind.
Nun wird schon seit längerem davon berichtet, dass die Zahl derjenigen Menschen kontinuierlich ansteigt, die aus ökonomischen Gründen nicht in der Lage sind, die notwendigen und eben einkommensunabhängigen Prämien für die PKV bezahlen zu können. Rainer Woratschka berichtet in seinem Artikel „Wege aus der Beitragsfalle“ über ein ganz neues Geschäftsmodell, das sich in dem fruchtbaren Boden der „PKV-Überforderten“ entwickelt hat und nun aus dem Boden sprießt. Es bildet sich ein neuer Typus des Versicherungsberater heraus, der „Wechselhelfer“: Gegen eine Gebühr helfen Honorar- und Versicherungsberater betroffenen Privatversicherten, in günstigere Tarife mit vergleichbarem Leistungsangebot zu wechseln. Dass es solche Alternativen fast immer gibt, wird den Kunden seitens vieler Versicherungsunternehmen nämlich gern verschwiegen. Was rein rechtlich nicht in Ordnung ist, gibt es doch den § 204 des Versicherungsvertragsgesetzes, der jedem das Recht zum Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Schutz garantiert. Unter Mitnahme aller bisher erworbenen Rechte. Aber grau ist alle Theorie und wer kennt sich schon aus in den Tiefen des Versicherungsrechts. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass sich eine eigene Helferbranche zu etablieren beginnt: »Tatsächlich schießen solche Wechsel-Agenturen wie Pilze aus dem Boden. Die Nachfrage belegt die Not der Kunden.«
Diese Not macht Woratschka an einem Beispiel deutlich:
»Monika Schmidt (Name geändert) aus Leipzig, 61 Jahre alt, bis 1990 Bauingenieurin in einem DDR-Betrieb, nach der Wende arbeitslos. Bis heute schlägt sie sich als Kleinselbstständige durch. Was sie verdient, reicht gerade so zum Leben. Ihr Rentenanspruch: 300 Euro. Von zusätzlichem Altersvermögen keine Spur. Dafür ist Frau Schmidt privat krankenversichert. Das kostet sie im Monat 575,10 Euro. Plus 1250 Euro Selbstbeteiligung im Jahr. Das ist schon jetzt fast doppelt so viel wie ihre zu erwartende Rente. Ein Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung ist nicht möglich.«
Der PKV-Verband warnt sogleich vor diesen Helferstrukturen: Da die kommerziellen Wechselhelfern allein an der Beitragsersparnis verdienten, manövrierten sie ihre Kunden oft in Billigtarife mit erheblicher Leistungsverschlechterung, so der Vorwurf des Verbandes der Versicherungsunternehmen. Aber da gibt es auch eine andere Realität auf der Anbieterseite: So gibt es Unternehmen, die von den Beratenen im Erfolgsfall zwar auch eine Jahresersparnis als Gebühr nehmen. Doch sie offerieren nur günstigere Tarife mit vergleichbarem Leistungsspektrum.
Wie dem auch sei. Aus der Sicht eines Wechselhelfers stecken viel zu viele bei den Privatversicherern, obwohl sie dort gar nicht hingehören, weil sie finanziell nicht unabhängig sind. Anders als in der gesetzlichen Krankenversicherung werde die individuelle Leistungsfähigkeit bei den Privaten nun mal nicht berücksichtigt. Und gerade im Alter wird das für viele, die aus welchen Gründen auch immer nicht über das erforderliche Gesamteinkommen verfügen, zu einem existenziellen Problem. Das auch die „guten“ Wechselhelfer nur abmildern, nicht aber lösen können. Zu dem Beispielfall der Monika Schmidt schreibt Woratschka in seinem Artikel:
»Frau Schmidt immerhin konnte geholfen werden. Durch einen Tarifwechsel zahlt sie nun nur noch 308,94 Euro plus 960 Selbstbehalt. Das ist fast die Hälfte weniger als bisher. Aber es ist immer noch deutlich mehr als ihre erwartete Rente.«
In diesen Kontext passen die zunehmend kritischer werdenden Anfragen an das Geschäftsmodell der PKV insgesamt. Eine interessante und differenzierte Zahlenanalyse hierzu findet man in dem lesenswerten Beitrag „Der Lockruf der Krankenkassen wirkt“ von Thomas Schmitt, der auf Handelsblatt Online veröffentlicht wurde. Seine Beobachtung: »Die private Krankenversicherung (PKV) kämpft verzweifelt um neue Kunden. Um hohe Abgänge auszugleichen, steckt die kleine Branche immer mehr Geld in die Anwerbung von Angestellten und Selbstständigen. Trotzdem gingen im vergangenen Jahr erstmals mehr Privatpatienten zurück zu den Krankenkassen als umgekehrt neue angelockt wurden. Die Folge: Die Kosten für einen neuen Kunden schossen hoch – auf einen Rekordwert.« Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind die neuen Kunden, denn sie zahlen die enormen Abschlusskosten über ihre Prämien. Betrachtet man die Entwicklung über die letzten 15 Jahre, dann kann man die folgenden Befunde erkennen, die Schmitt herausarbeitet: Die Abschlusskosten in der Branche haben sich – bezogen auf neue PKV-Versicherte – verdoppelt. Etwa die Hälfte der Kosten für Vermittler und Vertrieb entfallen auf den brancheninternen Wettbewerb. Die Abschlusskosten in konkreten Zahlen: »Innerhalb der vergangenen 15 Jahre stiegen sie von knapp 3.000 Euro je Neukunde auf aktuell mehr als 6.000 Euro. Ein großer Teil dieser Kosten entfällt auf Provisionen für Vertreter und Vertriebe.« Das heißt, diese Kosten für die Eiwerbung eines neuen Vertrages müssen erst einmal über die Beitragszahlungen des Neukunden refinanziert werden, bevor überhaupt ein Cent für die eigentliche Versicherungsleistung zur Verfügung steht.
Und Schmitt spricht eine zweite Problemdimension für die PKV an: Jedes Jahr wechseln rund 150.000 Privatpatienten zurück zu den Krankenkassen – obwohl die Rückkehr doch eine Ausnahme sein soll und sehr schwierig ist. Die Zahl der neuen Privatpatienten, die aus der GKV kommen, ist seit 1998 um ein Drittel gesunken. » In den vergangenen 15 Jahren wendeten sich mehr als 2,2 Millionen Privatpatienten ab und versicherten sich wieder bei einer gesetzlichen Kasse«, kann man den Rechenschaftsberichten des PKV-Verbandes entnehmen (vgl. hierzu die tabellarische Aufarbeitung „Wie viele wechseln und was das kostet„). Die Größenordnung der Rückwanderung ist deshalb so irritierend, weil die Rückkehr in die GKV nur eine Ausnahme von der Regel sein soll.
Den Abflüssen an Versicherten aus der PKV stehen aber auch die Wechsel aus der GKV in die PKV gegenüber: »Im gleichen Zeitraum kamen etwa 4,3 Millionen Menschen aus der GKV in die PKV. Im Saldo sieht sich die PKV also auf der Erfolgsseite.« Einen Teil der Abwanderungen aus der PKV kann man für die Branche sogar als „Geschäft“ zu ihren Gunsten interpretieren, vor allem, wenn es sich um ältere Versicherte handelt, die ja auch höhere Kosten verursachen, denn oft lassen sie mit dem Wechsel in die GKV wertvolle Ansprüche zurück, etwa wenn über die Jahre bereits beträchtliche Altersrückstellungen aufgebaut worden sind. Dieses Geld legen die Krankenversicherer zurück, um den Beitragsanstieg im Alter zu dämpfen, so Schmitt. Nur wenn sie innerhalb der PKV wechseln, können sie die Altersrückstellungen mitnehmen.
Das eigentliche Problem für de PKV zeigt sich erst in einer langfristigen Betrachtung der Daten: »Vor 15 Jahren verzeichnete die Branche noch neue Verträge in einer Anzahl von mehr als 600.000 pro Jahr. Bis 2009 hielt sich der Neuzugang immerhin über der Marke von 500.000. Doch in den vergangenen drei Jahren fiel er darunter und erreichte mit 413.000 im vergangenen Jahr sein Tief. Die langfristige Entwicklung belegt: Gegenüber 1998 ist ein Rückgang um ein Drittel zu verzeichnen.«
Und ein weiteres Strukturproblem wird in dem hier zitierten Beitrag gar nicht thematisiert: Die Kostensteigerungsfalle, in der die PKV steckt: Zum einen wird die Luft im Vollversicherungsbereich für die PKV immer dünner (und damit die Grundgesamtheit für die Finanzierung der Ausgaben), gleichzeitig steigen die Ausgaben stark an, dies auch, weil die PKV über so gut wie keine Steuerungsinstrumente auf der Ausgabenseite verfügt. Und auch im politischen Bereich wird das Klima PKV-feindlicher, damit ist hier nicht nur die immer wieder auftauchende Forderung nach einer „Bürgerversicherung“ gemeint. Absehbar ist eine Tendenz des Umbaus des dualen Krankenversicherungssystems hin zu einem System, in dem die Privaten auf den Bereich der Zusatzversicherungen verwiesen werden. Aber auch wenn sich dieser Umbau durchsetzen sollte – schwierig wird es für die „Altfälle“ im bestehenden System der PKV, denn ein Wesenselement der Funktionsfähigkeit des PKV-Modells war und ist die permanente Nachlieferung neuer Kunden. Sollte diese Zufuhr aus welchen Gründen auch immer richtig stocken, dann bricht das Kartenhaus schnell in sich zusammen.