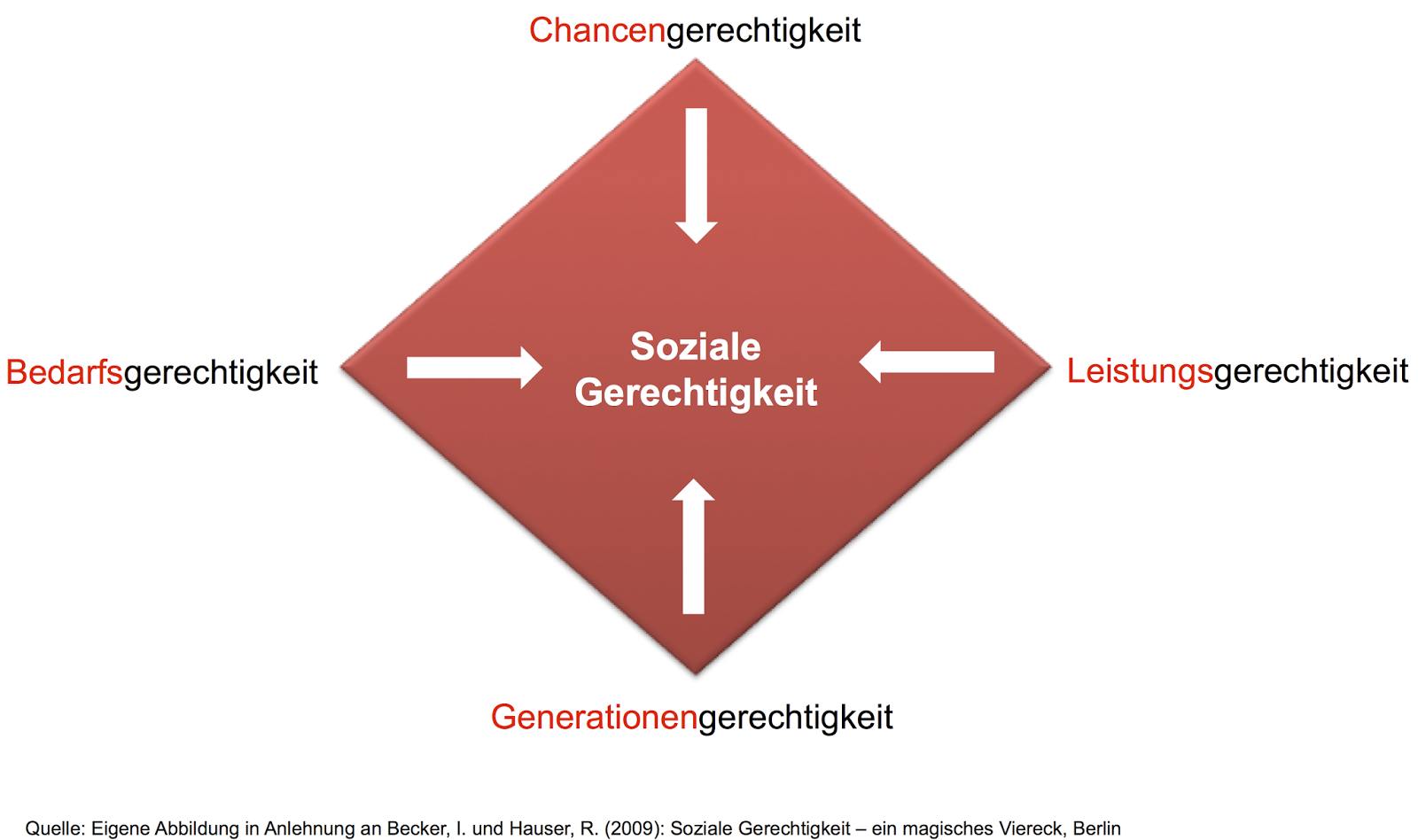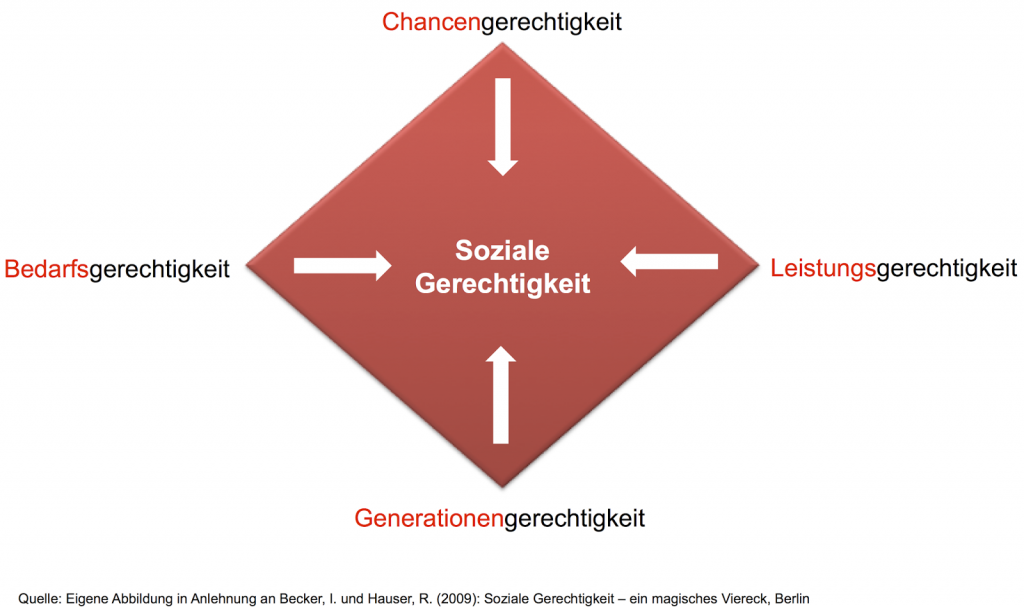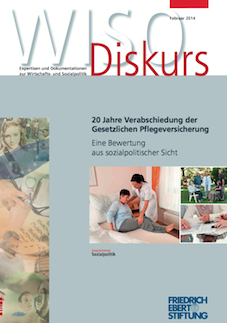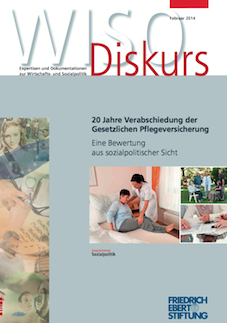Seien wir ehrlich – es gibt Institutionen und Begriffe, die bei vielen Menschen eine zwischen resignativer Frustration und Aggression schwankende Grundstimmung auslösen. In Deutschland gehören dazu die „Kultusministerkonferenz“ und der Terminus „Schulreformen“. Beides steht zumindest aus der Perspektive vieler Eltern für leidvolle Erfahrungen, die man in einem komplexen föderalen System mit 16 teilweise erheblich voneinander divergierenden Schulsystemen machen kann bzw. muss. Und es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass man ein intensives Studium betreiben muss, um die Vielfalt der Schularten und Schulformen sowie die unterschiedlichen Wege zu unterschiedlichen Abschlüssen auch nur ansatzweise nachvollziehen zu können. Eines der Top-Themen, die zu wahren Hyperventilationen bei den Beteiligten führen konnte, war die Schulzeitverkürzung von dreizehn auf zwölf Jahre, um den heiligen Gral des deutschen Bildungssystems, also das Abitur, erreichen zu können – von G9 auf G8, so heißen die entsprechenden Kürzel. Die haben sogar Eingang gefunden in die Wahlforschung, dort spricht man von den „G9-Mamas“ bzw. „G9-Papas“ als ziemlich wirkkräftige – und das kann bedeuten: wahlentscheidende – Kategorie für die Parteien. Doch nunmehr ist eine veritable Kehrtwendung zu beobachten: Immer mehr Bundesländer, die im vergangenen Jahrzehnt das achtjährige Gymnasium einführten, drehen diese umstrittene Reform zurück.
So kommen die aktuellen Schlagzeilen daher: „Spekulation über Kehrtwende bei G8“ wird aus Bayern gemeldet, wo Seehofers Regierung vor dem Hintergrund eines anlaufenden Volksbegehrens zur Wiedereinführung von G9 offenbar an einer Exit-Strategie arbeitet. Und aus dem Norden des Landes wird berichtet: „Niedersachsen schafft Turbo-Abi wieder ab„. Das Besondere hier: »Zum Schuljahr 2015/16 will Niedersachsen das Turbo-Abi kippen. Erstmals kehrt damit ein Bundesland flächendeckend zum neunjährigen Gymnasium zurück, das Abitur nach acht Jahren bleibt aber als Option erhalten. Andere Länder könnten dem Beispiel folgen.«
Nun könnte man zu dem Ergebnis gekommen, dass die hier erkennbare Rückentwicklung eine positive Sache ist, da die Politik endlich mal auf die offensichtliche und überwältigende Ablehnung eines ihrer Reformprojekte bei einem Teil der davon Betroffenen, hier vor allem bei den Eltern, reagiert und eine Entscheidung, die zu großem Unmut geführt hat, revidiert. Hinzu kommen könnte eine klammheimliche Freude über die offensichtliche Niederlage der neoliberal fundierten „Bildungszeitoptimierer“ und damit letztendlich der Erfolg eines Widerstands gegen die zunehmende Ökonomisierung unserer Gesellschaft. Vielen Eltern wird es an dieser Stelle herzlich egal sein, in welche ideologische oder soziologische Schublade ihrer Abneigung bis hin zu ihrem Protest gesteckt wird. Sie werden argumentieren, dass es ihren Kindern besser gehen wird, wenn sie nicht unter schulzeitverkürzten Bedingungen den heiligen Gral der bildungsnahen Schichten erreichen müssen. Aber an dieser Stelle soll dennoch ein genauerer Blick auf das Thema geworfen werden.
Viele gesellschaftliche Strukturen, Prozesse und vor allem Institutionen sind nur zu verstehen, wenn man sie historisch einordnet, denn auch die aktuellen Entwicklungen sind immer stark pfadabhängig. An dieser Stelle mögen einige kursorische Stichworte genügen: Die Existenz einer 13 Jahre andauernden Schulzeit bis zum Abitur ist keine alttestamentarische Überlieferung, sondern entspringt einem typischen Kompromiss, wie wir ihn in der Bildungspolitik immer wieder antreffen, und er datiert auf die Zeit der Weimarer Republik: »Die Sozialdemokraten der Weimarer Republik wollten Arbeiterkindern mehr Bildung ermöglichen – die Grundschulzeit wurde 1920 auf vier Jahre verlängert. Die Lehrer an den Gymnasien wollten aber ihre Wirkungszeit nicht beschnitten sehen, so verlängerte sich die Schulzeit für Abiturienten insgesamt auf 13 Jahre«, so Jonas Leppin und Oliver Trenkamp in ihrem Artikel „Turbo-Abi in der Reifeprüfung„.
- Man sollte gerade im Zusammenhang mit der gegenwärtig so umstrittenen Schulzeitverkürzung im letzten Jahrzehnt darauf hinweisen, dass es bereits vorher eine Abkehr von der 13 Jahre umfassenden Schulzeit bis zum Abitur gegeben hatte: Mit Erlass vom 30. November 1936 wurde die höhere Schulzeit auf zwölf Jahre verkürzt. Diese Maßnahme der Nationalsozialisten stand im damaligen Kontext der Wiederaufrüstung, da die Offiziersanwärter durch die Schulzeitverkürzung schneller zur Verfügung standen.
- Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann eine geteilte Entwicklung in Deutschland. Während in Westdeutschland das G9 restauriert wurde, bildete sich in der DDR ein anderes System heraus: für relativ wenige Schüler gab es die EOS mit einer zwölf jährigen Schulzeit und Samstagsunterricht, die zum Abitur führte. Daneben wurde eine einphasig ausgestaltete Berufsausbildung mit Abitur mit einer Laufzeit von drei Jahren installiert, im Anschluss an die zehnte Klasse der POS.
- Nach der Wiedervereinigung sind von den neuen Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zum G9 gewechselt, weniger aus innerer Überzeugung, sondern angesichts der Wochenstundenvorgabe der Kulturministerkonferenz (nach dieser Vorgabe muss es 265 Jahreswochenstunden geben, was bei G8 im Durchschnitt 33 statt ansonsten 30 Stunden Unterricht pro Woche bedeutet). Im Jahr 2000 sind die genannten Bundesländer dann wieder zu der 12jährigen Schulzeit zurückkehrt. In Sachsen und Thüringen übrigens wurde zu keinem Zeitpunkt die 12jährigen Schulzeit bis zum Abitur aufgegeben.
Vor diesem Hintergrund ist die Überschrift des Artikels von Barbara Kerbel „Mehr Zeit für Westschüler“ ein Volltreffer: Sie verweist darauf, dass in den ostdeutschen Bundesländern die Schüler, Eltern und die Lehrer offensichtlich gut zurechtkommen mit der zwölfjährigen Schulzeit. Streng genommen haben wir es offensichtlich mit einem „West-Problem“ zu tun. So auch die Wahrnehmung bei Barabra Kerbel, die darauf hinweist: »Vor allem die Eltern in den westdeutschen Flächenstaaten laufen Sturm gegen G8. Sie beklagen lange Schultage, ein kaum zu bewältigendes Lernpensum und immensen Leistungsdruck. Lehrer und einige Bildungsforscher kritisieren, die Reform sei überstürzt eingeführt, die Lehrpläne nicht entsprechend entrümpelt worden. Die Debatte ist aufgeheizt und emotional, von „gestohlener Kindheit“ ist bei vielen Eltern die Rede.«
Angesichts dieser massiven und weit verbreiteten Kritik an einem der Kernstücke der „Bildungsreformen“ muss diskutiert werden, wie es überhaupt zu der in Westdeutschland fast flächendeckenden Schulzeitverkürzung kommen konnte. »Das Saarland war das erste westdeutsche Land, das zum Schuljahr 2001/02 die Gymnasialzeit reformierte. Einzig Rheinland-Pfalz, wo das Gymnasium traditionell nur 12,5 Jahre dauert, ging einen Sonderweg und führte G8 nicht flächendeckend, sondern nur an einzelnen Ganztagsgymnasien ein«, so Kerbel.
Es ist an dieser Stelle nicht ohne eine gewisse Ironie, dass der Aspekt der „verlorenen Zeit“ für die jungen Menschen, der sich heute in der Formulierung von der „gestohlenen Kindheit“ Ausdruck verschafft, auch von einem der großen politischen Befürworter einer Verkürzung der Schulzeit verwendet wurde, allerdings ganz im Gegenteil von „verlorener Kindheit“ im Sinne einer „verlorenen Zeit“ im Schulsystem. In seiner „Berliner Rede“ von 1997 hatte der damalige Bundespräsident Roman Herzog mit den folgenden Worten Stellung genommen:
»Wie kommt es, daß die leistungsfähigsten Nationen in der Welt es schaffen, ihre Kinder die Schulen mit 17 und die Hochschulen mit 24 abschließen zu lassen? Es sind – wohlgemerkt – gerade diese Länder, die auf dem Weltmarkt der Bildung am attraktivsten sind. Warum soll nicht auch in Deutschland ein Abitur in zwölf Jahren zu machen sein? Für mich persönlich sind die Jahre, die unseren jungen Leuten bisher verloren gehen, gestohlene Lebenszeit.« (Berliner Rede 1997 von Bundespräsident Roman Herzog, „Aufbruch ins 21. Jahrhundert“, Hotel Adlon, Berlin, 26. April 1997)
Wir sehen in dieser Formulierung des damaligen Bundespräsidenten zum einen den Ausdruck des Zeitgeistes der Neunzigerjahre, der – wenn auch holzschnittartig – als ein neoliberaler Zeitgeist charakterisiert werden muss. Es waren die Hochjahre eines „naiven Ökonomismus“ mit seiner Verherrlichung der Beschleunigung und dem Leitbild einer Effizienzoptimierung, die auch vor den Schulen nicht Halt machen sollte. Vereinfacht gesagt stand hinter der Vorstellung des Bundespräsidenten das Modell einer permanenten Produktivitätssteigerung, von der man auch die Schüler nicht ausnehmen wollte. Auf der anderen Seite reflektierte seine damalige Kritik durchaus auch reale Abweichungen von der Situation in den meisten Bundesländern. Denn im internationalen Vergleich gab und gibt es mehrheitlich zwölfjährige Schulsysteme.
Meine kritische Anfrage an diejenigen, die mit der nun beobachtbaren Rückkehr zum alten 13 Jahre Schulzeit umfassenden System in den westdeutschen Bundesländern einen gesellschaftlichen Fortschritt im Sinne der betroffenen jungen Menschen sowie ihre Eltern sehen, lässt sich folgendermaßen auf den Punkt bringen: Ist es wirklich so, dass die Kinder und Jugendlichen mit einer längeren Schulzeit per se vor den Widrigkeiten einer immer schnelllebigeren, sich permanent beschleunigenden Gesellschaft geschützt werden, dass sie die Chance bekommen, mit der Zeit lernen zu können? Wenn man diese Frage spiegelt an der Realität in den meisten Schulen, dann muss man leider zu einer differenzierten Einschätzung kommen. Die von vielen Eltern wahrgenommene und deutlich kritisierte „Überlastung“ der Schüler resultiert zum einen aus dem Tatbestand, dass man die Schulzeit von 13 auf zwölf Jahre verkürzt hat, ohne substantielle Veränderung am Lehrplan und vor allem nicht am Volumen des Lernstoffs vorzunehmen. Zum anderen wurde die Beschleunigung und Verdichtung an vielen Schulen vollzogen, die nicht im Format einer Ganztagsschule gleichzeitig über deutlich mehr Zeitressourcen verfügen als die klassische Halbtagsschule.
Aber der aus meiner Sicht entscheidende Punkt ist ein anderer: Was wird in welcher zur Verfügung stehenden Zeit unterrichtet bzw. soll den jungen Menschen beigebracht werden? Das ist die entscheidende Frage, die man stellen muss: hier hätte man sich gewünscht, dass vor einem einfachen zurückdrehen der Verhältnisse die Debatte nachgeholt wird, die man bei der Schulzeitverkürzung eigentlich hätte führen müssen. Um es deutlich zu sagen: Das Problem in vielen deutschen Schulen besteht doch darin, dass wir es mit einer quantitativ gesehen voluminösen Ausgestaltung des abzuarbeiten Lehrplan zu tun haben, gleichzeitig die eigentlich zur Verfügung stehenden Lernzeiten im Laufe eines Jahres aufgrund der vielen Unterbrechungen und der langen Ferienzeiten auf ein sehr überschaubares Maß zusammengeschrumpft sind, so dass die Schüler in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen sollen/müssen und ansonsten konfrontiert sind mit durchaus sehr generös ausgestalteten Zeiten des Leerlaufs. Dies kann und muss zu erheblichen Schwierigkeiten für diejenigen Schüler führen, die schlichtweg mehr Zeit brauchen, um bestimmte Dinge lernen und wiedergeben zu können. Gleichzeitig führt die enorme Verdichtung der eigentlichen Lernzeit in Verbindung mit vielen Inhalten, die abgearbeitet werden müssen, dazu, dass kaum etwas Substantielles gelernt wird, denn das bedeutet auch immer, dass man die Lerninhalte wiederholt und vor allem übt. Dass man sie transferiert auf Sachverhalte aus der Realität.
Insofern wäre erst dann von einem tatsächlichen Geländegewinn gegenüber der Ökonomisierung unserer Gesellschaft und damit auch unseres Bildungssystems auszugehen, wenn es uns gelingen würde, zum einen die Lerninhalte neu zu adjustieren und vor allem die Inhalte zu verdichten und neu auszurichten nach dem Motto „weniger ist mehr“. Meine Befürchtung ist, dass man mit einer reinen Schulzeitverlängerung in Umkehrung der bisherigen Entwicklung lediglich das Gefühl vermittelt, man hätte Probleme, die wir in unserem Schulsystem ganz offensichtlich haben, beseitigt. Letztendlich sind wir an dieser Stelle mit der gleichen Problematik konfrontiert, auf die Bildungsforscher hinweisen, wenn es um die Verkleinerung von Klassen geht, denn die rein quantitative Reduzierung der Klassengröße ist nach dem Stand der Bildungsforschung keine Garantie für bessere Lernleistungen, wenn die Lehrer genauso weitermachen wie vorher. Anders formuliert – den jungen Menschen mehr Zeit in einem vielfältig ineffektivem System zu gewähren, ist unter dem Strich keine Verbesserung der Situation. Möglicherweise führt ein solcher „Pyrrhussieg“ über das G8 in Westdeutschland dazu, das man erneut einige Jahre verschenkt auf dem Weg der notwendigen Debatte über die Frage der Ausgestaltung des Unterrichts sowie der Inhalte.
Aber selbst wenn man nicht so weit gehen und Grundsatzfragen der Bildungspolitik aufrufen möchte: Jan Friedmann weist in seinem Kommentar „Den Preis zahlen nun Schüler und Lehrer“ zur neueren Entwicklung auf erwartbare „Kollateralschäden“ hin:
»Der Anspruch auf einigermaßen einheitliche, vergleichbare Gymnasialstrukturen in den Bundesländern ist auf Jahre passé. Die Schullandkarte der Bundesrepublik wird mehr denn je zum Flickenteppich … Rund 70.000 bis 80.000 Schülerinnen und Schüler wechseln jedes Jahr das Bundesland. Sie und ihre Familien müssen sich im Dschungel der föderalen Regeln zurechtfinden. Und selbst der Schulwechsel innerhalb eines Landes wird künftig aufwendiger, etwa wenn die einzelnen Schulen unterschiedliche Optionen anbieten.«
Nur müssen mit den Folgen dieser Entwicklung die einzelnen Familien irgendwie zurechtkommen. Meistens alleine.